Die Stadt Yal-Mordai
“Dabei ist Rakshazastan kein einiges Reich, sondern ein Bund von Emiren, Mogulen und Satrapen, deren oberster Sultan sich gar Diamanten nennt und auf die Herrscher in Khunchom beruft. Seine Würde beruht jedoch nicht auf Waffenmacht, sondern auf seiner Rolle als Herr der größten Handelsflotte, der jeden widerspenstigen Fürsten aushungern könnte. Nach seinem Vorbild huldigen die Rakshazastani besonders dem Phex als Herr der Juwelen und der Schatten. Schatten nennt man auch die unheimlichen Beamtenpriester des halbgöttlichen Diamantenen Sultans, die ihr Menschsein für eine übernatürliche Schattengestalt geopfert haben.
Die meisten Städte tragen Namen wie Yal-Mordai oder Yal-Kharibet nach den Sultanen, die sie gründen ließen. Ihre Oberschicht lebt außerhalb der echten Stadt in einer Flotte mächtiger Palastschiffe und Hausboote, die bei Revolten den Ort beschießen oder in Sicherheit fahren können.“
—— eine Basargeschichte aus Khunchom, zitiert nach den bislang unveröffentlichten Tage- und Logbüchern Ruban des Rieslandfahrers (Kap. 2: Historische Einleitung) (Zitiert nach der Geographia Aventurica, S. 99f.)
Juwel des Amazth, Stadt des Hexersultans, Geißel des grünen Halbmondes, die Mächtige, die Verdorbene, die Alte – viele Beinamen kennt diese Metropole, die vom tulamidischen Sultan Mordai ibn Dhuri auf den monumentalen Ruinen einer vorzeitlichen Zivilisation gegründet worden ist, und fast allen wird sie gerecht. Als Zentrum des Amazth-Kultes in Rakshazar und Machtbasis des gefürchteten Hexersultans Al’Hrastor vereint sie wie wohl keine andere Sehnsüchte und Hoffnung auf Erlösung auf der einen Seite mit der Angst vor völliger Unterwerfung und dem Tod auf der anderen Seite. Im Laufe von Al’Hrastors nun schon mehr als vierhundert Jahre währender Herrschaft mehrten sich seine persönliche Macht und sein Einfluss von Generation zu Generation, nur allzu oft auf Kosten der Stadt und ihres Herrschaftsgebietes. Es heißt, all dies sei im Sinne Amazth’, der durch Al’Hrastor nicht diesseitige, vergängliche Ziele verfolge, sondern seinen Blick jenseitigen, ewigen Zielen zuwende. Al’Hrastor selbst verkörpert den Zustand der Stadt perfekt: Seine unsterbliche Seele wächst und wirkt im Namen Amazth’, während sein Körper seit Jahrhunderten vor sich hinschimmelt und -fault. Ebenso wie Yal-Mordai dem „Gott“ zu Diensten ist, während die Stadt verrottet, weil die amazäische Lehren ihre Instandsetzung verbieten. Das stolze Yal-Mordai liegt darnieder, die hohen Türme und Minarette verfallen, und dem Volk geht es nun noch dreckiger als zuvor. Nur Soldaten und Hexer sind in dieser Stadt des Verfalls einigermaßen gut dran.
Das Leben in der Stadt Yal-Mordai drängt sich in einem vergleichsweise engen Bereich um die Keshals, antike Bauten marhynianischer Herkunft. Diese liegen auf einem Areal, das durch uralte Schutzzauber von dem verderbten Einfluss des im Zentrum der Stadt gelegenen Unheiligtums des Amazth abgeschirmt wird. Überall dort, wo dies nicht der Fall ist, ist ein Überleben auf lange Sicht kaum möglich, jedenfalls nicht in Form rakshazarischer Kulturschaffender.
Die Sanskitaren übernahmen die enormen Marhynianerbauten, welche schlicht „Keshal“ genannt werden, wie Ratten, die ein der Ewigkeit überlassenes Heiligtums Amazths eingedrungen waren, es mit ihrer unwürdigen Präsenz überschwemmten und es doch nicht schafften, es zu entweihen und ihm seine Würde ganz zu nehmen, jedenfalls nach Ansicht der Zelothim. Neunzehn dieser riesigen, trapezoiden Steinkolosse bilden das Zentrum der Stadt. An ihre gewaltigen Mauern haben die Yal-Mordaier Lehmziegelhäuser und gewagte Holzkonstruktionen auf mehreren Ebenen übereinander gebaut, die durch simple Aufzüge und Strickleitern miteinander verbunden sind.
Zwischen den Keshals führen breite Alleen zu weiten Plätzen, in deren Zentren merkwürdig geknickte Stelen und vieleckige Säulen steinerne Labyrinthgärten bilden. Im Schutz dieser Stelen-Labyrinthe leben die ärmeren Yal-Mordaier, die sich keinen Platz an oder gar in den Keshals erkämpfen konnten.
Im Bereich zwischen Keshals und Stadtmauern befindet sich eine Menge freier Raum. Mauerreste und halb verfallene Kellergewölbe legen Zeugnis davon ab, dass hier zu Zeiten der vergangenen Hochkultur weitere Keshals gestanden haben müssen, welche seit vielen hunderten von Jahren verfallen sind. Die Stadt erscheint trotz der vielen Menschen (rund 280.000 Einwohner, davon 220.000 Sanskitaren) beinahe immer merkwürdig leer, und wenn man durch die weiten Alleen streift, fühlt man sich von hunderten von Augenpaaren beobachtet.
Trotz allem Elend und ihrem desolaten Zustand bleibt Yal-Mordai ein Machtfaktor, mit dem zu rechnen ist. Zwischen den steilen Klippen der Blutigen See, in einer seichten Bucht gelegen, ist das Stadtsultanat Yal-Mordai eine der größeren Seemächte des Rieslands. Da wäre die Kriegsflotte, die den meisten Seemächten Rakshazars die Stirn bieten kann. Die Galeeren aus Yal-Mordai zählen zu den schnellsten Wasserfahrzeugen in der Blutigen See – auch Meer der Schatten genannt – und im Gelben Meer. Wer es sich leisten kann, lebt außerhalb der eigentlichen Stadt auf Palastschiffen oder Hausbooten. Das Hafenviertel liegt außerhalb des verderbten Einflusses der Sternensenke, und die Schiffe unterliegen nicht dem Instandsetzungsverbot, dessentwegen die Stadt mehr und mehr verfällt.
Wie die Städte Ribukan und Shahana verfügt Yal-Mordai über ein bemerkenswertes Artefakt aus der Zeit des antiken Rakshazars: Eine Schwimmende Festung, gebaut von den Marhynianern. Yal-Mordais Herrscher, der Hexersultan Al’Hrastor, benutzt sie nur zu gern für Seeschlachten und Angriffe auf Küstensiedlungen. Da aber selbst die Schwimmenden Festungen keinesfalls unbesiegbar sind, hat Al’Hrastor bereits umfassende „Reparaturen“ durchführen lassen müssen. Yal-Mordais Artefakt wirkt im Vergleich zu den beiden anderen Seefestungen in sanskitarischer Hand seltsam primitiv und geflickschustert. Es verfügt über keine große Primärwaffe. Um anzugreifen, verwendet die Besatzung Steinschleudern auf den vier Ecktürmen, oder es werden Bogenschützen auf der Festungsmauer postiert. Zwar hat dieser Palast, der mittels einer magischen Krone bewegt werden kann, im letzten Jahrhundert schwer gelitten, doch noch immer dominiert dieses riesige, uralte Ungetüm den Hafen Yal-Mordais und damit auch die restliche Stadt.
Von den Soldaten des Stadtsultanats Yal-Mordai sagt man, dass für sie ein Leben in Belagerungsgräben und auf Kriegszügen fernab ihrer schrecklichen Heimatstadt ein Privileg sei. Vor allem aber ist Yal-Mordai für seine magische Macht bekannt. Die Amazäer lehren in ihrer Akademie eine Zaubertradition, die lose auf den Lehren der tulamidischen Kophtanim fußt. Ihr radikaler Zweig, die Zelothim des Hexersultans, gelten als machtvolle Magiewirker, welche keine Skrupel haben, den Schleier, der das Diesseits vom Jenseits trennt, zu zerreißen und Schrecken heraufzubeschwören, die sie und ihre Feinde gleichermaßen in den Abgrund ziehen.
Einstmals beherrschte Yal-Mordai als Hauptstadt des Sanskitarischen Städtebundes fast die gesamte Küste der Blutigen See. Doch die Karten wurden neu gemischt, als der skrupellose Sultan Al’Hrastor die Macht ergriff. Al’Hrastor zählt zu den mächtigsten Magiern des Rieslands und kann auf über 400 Jahre praktische Erfahrung mit okkultem Wissen zurückgreifen. Man hält ihn gemeinhin für den absoluten Meister in Hexerei und verdorbener, schwarzer Alchimie. Trotzdem scheiterten seine hochtrabenden Pläne, den gesamten Süden zu beherrschen, geradezu furios. In der Folge liegt das stolze Yal-Mordai darnieder, die hohen Türme und Minarette verfallen, und dem Volk geht es noch dreckiger als sonst. Nur Soldaten und Hexer sind in dieser Stadt des Verfalls einigermaßen gut dran. Die ehemalige Kolonie Yal-Kalabeth ist autonom und einer der ärgsten Feinde geworden. Die ehemals unterworfenen Ipexco sind ebenfalls abspenstig
Yal-Mordai ist auf allen Seiten von Gegnern umgeben, wobei besonders das Verhältnis zu den durch Sultan Arkamin IV. von Shahana beherrschten Ländereien beständig schlechter wird. Al’Hrastor träumt noch immer davon, einst den ganzen Süden des Rieslandes unter seiner Herrschaft zu vereinen, doch an das Angreifen und Erobern ist momentan in der Praxis nicht zu denken; selbst Arkamin IV. allein versteht es, ihm die Stirn zu bieten. Die Nahrungsmittel in der Stadt werden streng rationiert, um die übergroße Armee versorgen zu können.
Überregionale Bekanntheit erlangt hat Nagah Kai. Es handelt sich um eine Kampfschule, die den Waffenlosen Kampf lehrt, eine Fähigkeit, die in einer Stadt wie dieser nicht selten lebenswichtig ist. In der Schule wird der einst von den Nagah entwickelte Sirista-Schlangenstil in einer besonderen Variante, die auf Effizienz und Geschwindigkeit setzt und keine Gnade kennt, praktiziert. Ihr Leiter ist Teratius Silber, ein fast zwei Schritt großer Mann mit einer schwer greifbaren und mitunter beunruhigenden Ausstrahlung, die von seiner narzisstischen, manipulativen und gewalttätigen Ader herrührt. Diese passen so gar nicht zu seiner oft übertriebenen Freundlichkeit, die blitzschnell in kalte Wut und Zornesausbrüche umschlagen kann, seinem brillanten Verstand und einer für das Riesland ungewöhnlichen Anbiederung an Benimmregeln und Etikette, die seinem sonstigen Verhalten Hohn spricht. Es heißt, er habe einst in einer Armee gedient, in welcher, weiß niemand zu sagen, und habe dort Schreckliches erlebt, das ihn für immer verändert habe. Insbesondere unter den jüngeren Schülerinnen und Schüler herrscht ein bizarrer Personenkult um Silber vor, der ihm einen quasigöttlichen Status einzuräumen bereit ist. Silber soll eine Erzfeindin namens Mista Migaji haben, die Leiterin einer Kampfschule der Kentaishi, die sich in einem geheimen Tempel mitten im Nagahdschungel befinden soll. Wo sie zu verorten sein könnte, ist selbst Silber unbekannt. Silbers eigentliches Geheimnis besteht darin, dass er ein Hohepriester des Widersachers ist, der die Kampfschule nutzt, um Anhänger für seinen Gott zu rekrutieren und mitten unter den Augen Al’Hrastors und des Amazth-Kultes den Einfluss des Dreizehnten zu mehren. Darüber hinaus sammelt er Informationen über den Status der Stadt und die Pläne ihrer Mächtigen und leitet sie an andere Anhänger des Namenlosen weiter.
Haupteinamequelle der Metropole ist das größte Amazth-Heiligtum des Kontinents, das alljährlich Pilger aus fast allen größeren Städten Rakshazars anzieht: Sach Ard’m, der Fels der Erleuchtung.
Sach Ard’m, der Fels der Erleuchtung; Amazth-Heiligtum und Akademie der Amazäer und der Zelothim zu Yal-Mordai
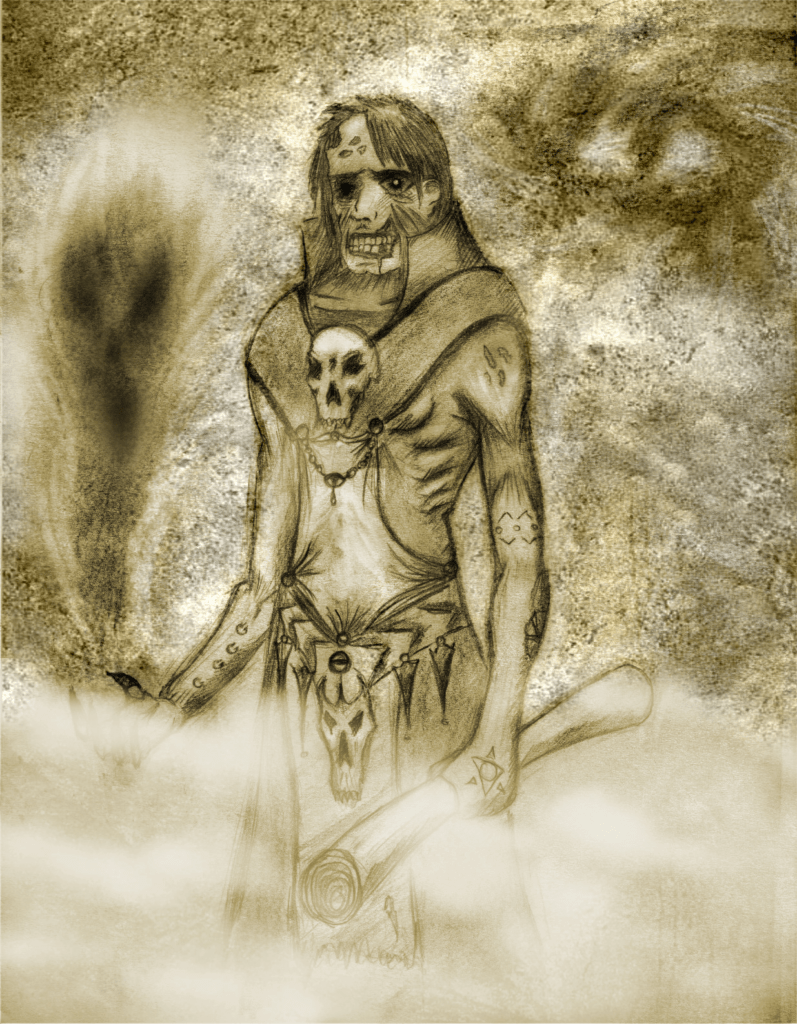
Sach Ard’m, Amazth-Heiligtum und seit der Schließung der Akademie der Schatten zu Ribukan im Jahre 992 BF die einzige Magierakademie des Rieslands, ist in der Anfangszeit des Mittleren Reiches der Sanskitaren errichtet worden, um eine Einigung der Religion zu realisieren. In welcher Form dies eines Tages geschehen würde, hätten sich die damaligen Erbauer gewiss nicht träumen lassen. Das Bauwerk steht auf den Ruinen einer weit älteren, aus marhynianischen Zeiten stammenden Anlage. Sein Sockel stammt noch aus diesen alten Tagen, hat alle Höhen und Tiefen der Stadt überstanden und weist bis heute kaum Abnutzungserscheinungen auf. Er wird durch eine trapezförmig zugeschnittene Felsenbasis gebildet, welche glatt und fugenlos ist und etwa fünfzehn Schritt in die Höhe ragt. Zahlreiche Winkel und Alkoven an den vier Seiten lassen die Basis wie eine titanische Zierborte erscheinen. Die seltsamen kubischen Arabesken und die versenkten Obelisken erwecken den Eindruck, sie seien erst gestern aus dem Stein geschnitten worden. Eine einzelne, riesige, in den Fels eingelassene Treppe führt von Süden her hinauf auf den Sockel. Sie wird Tag und und Nacht von zwei Kämpfern der Kristallgarde von Sach Ard’m bewacht. Der Ruf der geblendeten Krieger und die Furcht vor dem Zorn der Diener Amazth-Anhänger lassen eine strengere Bewachung überflüssig erscheinen.
Am Ende der Treppe betritt man einen gewaltigen Innenhof, der tagsüber voller Leben ist. Die Garde benutzt ihn für ihre Übungen, Pilger, darunter zahlreiche Mystiker, strömen zur Sternensenke, die Amzath-Priester halten zuweilen Gottesdienste für Besucher ab, und vor der Magierakademie finden gelehrte Vorträge statt.
Die Sternensenke
Von der Treppe aus kommend blickt man auf einen riesigen Torrahmen im Norden, der zum Amazth(un)heiligtum führt, der sogenannten Sternensenke. Es handelt sich um eine siebzehn Schritt durchmessende, halbkugelförmige Senke im Boden, die Tag und Nacht den Sternenhimmel zeigt. Faustgroße Kristalle repräsentieren die wichtigsten Sterne. Sie sind an riesigen, hauchdünnen Metallringen befestigt, die – angetrieben von einer unbekannten Macht – langsam ineinander rotieren und so die Bewegung der Sterne imitieren. Die Kristalle durchlaufen den bevorstehenden Sternenlauf des jeweiligen Mondzyklus rückwärts, wobei im Falle besonderer Konstellationen ein metallisches Summen durch die Konstruktion geht. Auch die Wandelsterne werden durch Kristalle unterschiedlicher Farbe symbolisiert, jedoch sind diese von etwa der Größe eines Kinderkopfes.
Es muss erstaunen, wie präzise die auch Astrolabium genannte Anlage ihren Zweck erfüllt. Selbst die sternkundlichen Tafeln einer Niobara von Anchopal waren nie so genau. Erschreckenderweise bildet das Modell sogar den Sternenfall korrekt ab, ohne dass eine Nachkalibrierung erforderlich gewesen wäre. Nicht minder erschreckend ist die Tatsache, dass auch der heute unsichtbare Augenstern, welcher die Tulamiden einst ins Riesland geführt hat, unbeirrbar seine Bahn zieht und dabei als Auge Amazeroths dargestellt ist, welcher im Zentrum der Senke über die Schöpfung wacht.
Um die Senke herum machen Pilger ihre Aufwartung. Manche von ihnen werfen sich siebenundsiebzigfach vor dem Heiligtum nieder und bringen dann ihre Opfergaben dar. Die Akoluthen, in Ausbildung befindliche Priester Amazths, Priester, Amazäer oder Zelothim halten sich hier eher in den Abend- und Nachtstunden auf, wenn der Pilgerstrom sich verlaufen hat, und nutzen die nächtliche Stille, um in tiefe Meditation zu versinken und nach Erleuchtung zu suchen. Zuweilen stürzt sich ein Fanatiker in das Heiligtum – es heißt, man könne durch eine Öffnung in der Mitte des im Boden eingelassenen Sternenhimmels direkt in Amazth‘ Paradies gelangen – und findet dabei in aller Regel ein grausiges Ende durch die Metallringe. Die Sternengrube ist so konstruiert, dass sie durch solche Vorstöße stets unbefleckt bleibt, gern gesehen sind diese dennoch nicht. Der Tempel bietet geeignetere Orte, sich Amazth zu opfern, wenn man denn unbedingt möchte. Daher finden sich neben dem blassgrünen Nephriit, welcher das Heiligtum vor Vandalismus schützt, stets auch einige Vertreter der Kristallgarde, um allzu enthusiastische Gläubige am Freitod zu hindern.
Die Sternensenke ist nicht von Kunkomern, Remshen oder Sanskitaren geschaffen worden. Sie existiert bereits seit Marhynianischen Zeiten. So es denn stimmt, was die Senke selbst andeutet, dass nämlich der Augenstern, der die Kunkomer ins Riesland geführt hat, ein Werk des Amazth’ war, wirft dies die Vermutung auf, dass der Erzdämon die Aventurier unter anderem deshalb nach Rakshazar geführt hat, damit sie sein Unheiligtum wieder in Gang setzen. Schließlich haben die Riesländer die alten Marhynianischen Bauten meist abergläubisch, in diesem Fall allerdings vollkommen zu Recht gemieden. Der verderbte Einfluss der Sternensenke verbreitet sich über die ganze Stadt und darüber hinaus. Lediglich der Hafenbezirk liegt weit genug entfernt, und im Stadtkern schützen die Stelen-Labyrinthe einen streng abgesteckten Bereich. Es darf als gesicherte Erkenntnis gelten, dass es zu imperialen Zeiten sehr viel mehr solcher Einrichtungen gab und sie auf dem gesamten früheren Stadtgebiet die schädliche Aura eingedämmt haben. Dummerweise haben die Sanskitaren keinerlei Vorstellung, was zur Errichtung eines Stelen-Labyrinths erforderlich ist, und die Zelothim hätten ohnehin keinerlei Interesse daran, die Macht ihres Gottes weiterhin zu beschränken. Ein Ausbau der Schutzanlagen scheint somit momentan schier unmöglich zu sein.
Das Spiegellabyrinth
Nur Eingeweihten ist bekannt, dass sich direkt unterhalb der Sternensenke ein Spiegellabyrinth befindet, welches das Zentrum einer weit verzweigten unterirdischen Anlage bildet. Der Sage nach geht derjenige, welcher das Labyrinth sehenden Auges betritt, unrettbar in ihm verloren. Die Kristallgarde jedoch und die geblendete Diener finden sich offenbar in seinen Außenbereichen zurecht, ebenso wie Akoluthen, Amazäer- oder Zelothim-Anwärter, welche mit verbundenen Augen in einen der „Säle der Erkenntnis“ geführt werden, um dort ihre Abschlussprüfung abzulegen.
Die Spiegelgänge sind nicht nur verwirrend für das Auge und erschweren die Orientierung im Labyrinth. Je weiter man in Richtung des Zentrums vordringt, desto häufiger finden sich magische Spiegel, durch die ganz in Amazeroth-Manier die Realität verschwimmt und mit wahnsinniger Illusion eine aberwitzige Symbiose eingeht. Aus einigen der Zauberspiegel steigen exakte Replikate der gespiegelten Personen, die meist durch Quitslinga-Dämonen verkörpert werden. In manche wird man hineingesogen, um anstelle seines eigenen Spiegelbildes zu erscheinen, manche führen in Traumwelten, erlauben Sphärensprünge oder verwandeln den, der in sie blickt. In seinem Innersten geht das Spiegellabyrinth dann mehr und mehr in Amazeroths Domäne selbst über, bis man keinen Weg mehr findet, der aus ihr herausführt.
Auch das Spiegellabyrinth stammt aus Marhynianischen Zeiten und ist durch die Bewohner Yal-Mordais wieder in Kontakt mit Sterblichen gekommen.
Die Ministerien
Die West-, Ost- und Südseite des Innenhofs bieten Zutritt zu den unterschiedlichen Bereichen des eigentlichen Turms, ein gigantisches, fensterloses, steinernes Bauwerk, welches den Rest der Stadt um ein Vielfaches überragt.
Die Eingänge im Süden, die sich rechts und links neben der Treppe befinden, dürfen von Fremden betreten werden. Hier residieren die Wesire von Yal-Mordai, die jede Woche zu festgelegten Zeiten dem Volk eine Audienz gewähren, und ihr aufgeblähter Beamtenapparat, der in Verwaltungsbelangen konsultiert werden kann, wobei sich die einzelnen Bereiche nicht immer einig sind, wer in welcher Angelegenheit zuständig ist.
Folgende Ministerien stehen zur Verfügung:
Pandämonium der Seher
Panoptikum – Staatskunst & Spionage
Prätoriat – Angriff & Verteidigung
Panthegon – Kirche & Religion
Paradigma –Bildung & Erziehung
Propagastios – Öffentlichkeit & Medien
Prinzidium – Forschung & Entwicklung
Prospektorat –Wirtschaft & Finanzen
Diese sind wiederum in verschiedene Ränge gegliedert:
Perzeptionist – Spitzel, Handlanger, Kontakte
Replikant – erwachtes Mitglied
Revisor – Vorsteher eines Zirkels
Tutorist – Vorsteher eines Dezernats
Dementor – Inquisitor mehrerer Dezernate
Prokurator – operativer Ministeriums-Leiter
Ägidär – Schirmherr der Erzenen
Mundane Priester des Amazth, Handlanger der Wesire, ziehen in weißer Kleidung und mit einem dünnen Tuch vor dem Gesicht durch die Stadt, um unablässig neue Gesetze und Verordnungen zu verkünden, die nicht selten den Anordnungen anderer Wesire widersprechen – und so gut wie immer denen, die durch Yal-Mordais Sultan Al’Hrastor selbst erlassen wurden. Die Gesetze und Erlasse des Sultans sind bestenfalls unverständlich, meistens widersinnig, schlimmstenfalls unmenschlich. In Yal-Mordai ist mittlerweile eigentlich jeder konstruktive Aspekt des normalen Lebens verboten, entweder durch Al’Hrastor selbst oder durch einen seiner Wesire. Strenggenommen gilt dies selbst für essen, heiraten und Kinder bekommen. Diese Rechtslage ist bizarr und vollkommen lebensfern, und natürlich finden all diese Dinge statt, so wie überall anders auch, nur eben ohne staatliche Zustimmung. Al’Hrastor ist inzwischen der Welt so weit entrückt, dass sich die Wesire weitestgehend von ihm emanzipiert haben. Auch untereinander besteht kein Zusammenhalt, bestenfalls bilden sich temporäre Zweckbündnisse. Einerseits fungieren sie als Puffer zwischen den sinnlosen Befehlen des Sultans und der Bevölkerung, andererseits hintertreiben sie auch die Politik der Kollegen, sodass jemand, der mit dem einen Wesir Probleme hat, gut beraten sein kann, sich einen anderen zum Freund zu machen. Die Wesire sind somit die heimlichen Herrscher Yal-Mordais, auch wenn sie ihre Eigenmächtigkeiten gut kaschieren müssen. Der Sultan bekommt in seinem Zustand diese Dinge kaum noch mit oder reagiert auf eine Weise darauf, die den Wesiren keine Rückschlüsse erlaubt, was er begriffen hat und was nicht und wie er die Angelegenheit bewertet. Dann wieder scheint es plötzlich so, als würde Al’Hrastor mit seinem scheinbaren Gewährenlassen klar umrissene Ziele verfolgen. Die scheinbare Eigenmächtigkeit des Wesirs endet in solchen Fällen in nicht vorhersehbaren, für die Diener Amazeroths aber durchweg positiven Wirkungen, so wie den Tod eines Feindes, die Schändung eines konkurrierenden Heiligtums oder eine großzügige Spende an den Tempel. Man könnte dies als Zufälle abtun, wenn dergleichen nicht inzwischen mehr als einmal zu oft geschehen wäre.
Das Ordenshaus
Auch ein Eingang im Osten des Innenhofs steht Besuchern offen. Er führt in einen großen, opulent eingerichteten Tempel, in dem die Gläubigen Amazth huldigen oder Opfergaben hinterlassen können. Der Zutritt zum Ordenshaus – der Residenz der Hexer von Yal-Mordai –, welcher ebenfalls im Osten liegt, ist Fremden strengstens untersagt. Hier gehen nur die Amazäer, die Priester, die Gardisten und die ebenfalls geblendeten Tempeldiener ein und aus.
Die Akademie
Dasselbe gilt für den im Westen gelegenen Eingang zur Akdemie, welche sich Amazäer und Zelothim teilen.
Vor dem riesenhaften Tor der Magierakademie kann man tagsüber so gut wie immer mehr oder minder wissenschaftlichen Vorträgen lauschen. Gelehrte aus aller Herrn Länder suchen Sach Ard’m auf, weil hier ein Zugang zum Spiegelthron des Amazth vermutet wird. Wer sich berufen fühlt, müht sich, an Amazth‘ heiligem Ort, wo der Gott ihn hören kann, seine Weisheit und sein Wissen unter Beweis zu stellen. Der Legende nach beruft Amazth die größten Denker der Welt vor seinen Thron in die Bibliothek von Xamanoth, um an der Weisheit der Schöpfung teilzuhaben und andere daran teilhaben zu lassen. Die einzelnen Lehrmeister wirken dabei nur allzu oft wie besser gekleidete Straßenpropheten, die ihren Adepten eine Predigt halten, zumal nicht selten mehrere von ihnen zeitgleich zum selben Thema dozieren. Der scheinbar marktschreierische Charakter dieser Veranstaltungen täuscht jedoch. Dozenten und Adepten halten sich an einen strengen Verhaltens- und Diskussionskodex. Verstöße dagegen führen nicht selten zu Hieben oder Steinwürfen durch die aufgebrachte Menge. In schweren Fällen schreitet die Kristallgarde ein, die derartig „frevelhafte Ignoranz“ gegenüber dem Amazthheiligtum gar nicht zu schätzen weiß. Die Zelothim, deren Ausbildung sonst eher vor den Augen der Öffentlichkeit verborgen bleibt und von reichlich Geheimniskrämerei und Mystizismus begleitet wird, nehmen überraschenderweise an den „Essays vor dem Spiegelthron“ teil. Offenbar ist dies obligatorischer Bestandteil ihres Ausbildungsplans.
So undurchdringlich die Wände der Magierakademie von außen nach innen auch wirken mögen – schließlich handelt es sich um massiven Stein ohne Fenster oder Schießscharten –, umso transparenter wirken sie von innen. Man kann durch sie hindurchsehen wie durch Glas. In Wahrheit handelt es sich um einen zweifachen Spiegeleffekt, welcher das Außen auf die Wände spiegelt. Die Intensität des einfallenden Lichts kann dabei durch die Amazäer reguliert werden.
Die Akademie gliedert sich in zahlreiche Geschosse:
4. OG – Persönlicher Ritualsaal Al’Hrastors (inklusive seines gesamten Wohnbereichs)
3. OG – Forschungslaboratorien und Wohngemächer der Lehrkräfte
2. OG – Lehrräume Amazäer/Zelothim
1. OG – Bibliothek und Staats-Archiv
0 – Zentrale Ebene: Unterkünfte für Lehrlinge, Küche, Vorratsräume
1. UG – ein steinernes Labyrinth aus gigantischen Hallen, Treppen und Tunneln. Urtümliche Bibliothek aus Wandbildern und Steinformationen in Trollisch.
2 UG – Die Visionskammern: Unzählige, in wirren Spiralen angeordnete, wabenförmige Einlassungen im Fels voll halluzinogenem Nebel, der dem kundigen Erleuchtung bringen soll.
3 UG – Kristall- oder Spiegellabyrinth, wo Tempelschätze versteckt werden. Gilt als unüberwindliche Barriere für Sehende ohne einen blinden Führer der Kristallgarde oder deren Diener.
4. UG und weitere Untergeschosse – Geheimräume des Rats der Schemenhaften und ähnliche Mysterien.
Genauer Name der Akademie: Halle der Eiferer der Erleuchtung am Sockel von Sach Ard’m, geweiht dem Herrn der Sternengrube und seinem diesseitigen Wirker Al’Hrastor
Haupt-Merkmale: Illusion, Einfluss, Invokation, Kampfmagie, Magietheorie, Metamagie
Ausrichtung: Ausbildung der Amazäer/Zelothim Sultan Al‘Hrastors und magische Forschung
Akademieleiter: Al’Hrastor
Größe: groß
Beziehungen: groß (die Akademie gilt als Herz Yal-Mordais und steht auf der zentralen Amazthpilgerstätte der Sanskitarenlande)
Ressourcen: groß (vor allem für die Forschung und Expeditionen)
Die Kristallgarde des Sach Ard‘m
Die Kristallgarde des Sach Ard’m ist die wohl geheimnisumwittertste Militäreinheit Rakshazars. Ihre Hauptaufgabe besteht im Schutz des Heiligtums Ard’m. Sie ist den Hexern von Yal-Mordai unterstellt, also den Priestern des Amazth-Staatskults. Trotz der politischen und magischen Macht Al’Hrastors ist es dem Amazth-Kult nicht zuletzt aufgrund seines militärischen Arms gelungen, seine Unabhängigkeit zu bewahren und sich auf diese Weise als weitere Macht in der Stadt zu etablieren, neben Al’Hrastor selbst, dem reichen Bürgertum (das mit voranschreitender Herrschaft Al’Hrastors und dem ihr folgenden Verfall Yal-Mordais immer mehr an Bedeutung verloren hat), den Wesiren, den Amazäern, den Zelothim und dem Rat der Schemenhaften. Dies führt nicht selten zu Spannungen zwischen den einzelnen Interessengruppen, welche nominell allesamt Al’Hrastors Kontrolle unterstehen.
Die Kristallgardisten haben in der Vergangenheit den Hexersultan immer wieder auf seinen Kriegszügen und Expeditionen begleitet und ihm als Leibgarde gedient, doch dies geschah immer im Auftrag des Kultes. Oft waren die Offiziere der Garde mit geheimen Zusatzaufträgen versehen, von denen Al’Hrastor nichts wusste. Die Gardisten schützen auch die Tempel in anderen Sanskitarenstädten und gewähren Reisenden aus verfeindeten Regionen, welche zum Heiligtum Amazth‘ pilgern, Geleitschutz. Selbst in Rimtheym will man schon auf einzelne von ihnen gestoßen sein, wo sie geistig verwirrte, in der Gosse lebende Propheten behütet haben sollen.
Niemand weiß genau, wie viele Individuen in der Kristallgarde dienen, wer sie anführt oder wie sie ihren Nachwuchs rekrutiert. Ruchbar geworden ist jedoch, dass den neuen Rekruten in einem geheimen Heiligtum außerhalb Yal-Mordais die Augen ausgestochen und durch Kristalle ersetzt werden. Außerdem werden ihnen die Ohren und Nasen abgeschnitten. Im Anschluss daran erhalten sie ihre schwarz-grüne, stachelbewehrte Ganzkörperrüstung und ihre Waffen. Dazu gehört ein Helm mit einer Maske aus Narrenglas. Diese ersetzt offenbar die Wahrnehmung, welche den Gardisten genommen worden ist, durch eine, die ihren Aufgaben eher dienlich ist, auch wenn kein Außenstehender weiß, in welcher Form und auf welche Weise dies geschieht. Auch die Rüstung beinhaltet Schuppen aus Narrenglas, das selbst bei starker Gewalteinwirkung nicht splittert und Dinge reflektiert, die scheinbar gar nicht anwesend sind. Es überwiegen jedoch solche aus poliertem Messing oder Silber. (Zu den Rüstungen siehe “Buch der Klingen”, S. 172.)
Die bevorzugten Waffen der Gardisten sind reich mit Kristall- und Spiegelsplittern verzierte Glefen, welche bei der Wache und zu Repräsentationszwecken getragen werden, und das traditionelle Sichelschwert, ergänzt um einen polierten Spiegelschild, um sich damit in den Nahkampf zu begeben.
Nominell residiert die Garde in den Tiefen von Sach Ard’m, in den Außenbereichen des Spiegellabyrinths, umgeben von Tempelschätzen, spiegelnden Kristallwänden und flüsternden Stimmen, die aus der Tiefe heraufdringen. Die meiste Zeit verbringen die Gardisten jedoch innerhalb des Ordenshauses, wo ihnen im Erdgeschoss ein ausgedehnter Zimmerkomplex zur Verfügung steht, in dessen Zentrum eine Treppe nach unten in die Tiefen des Heiligtums führt.
Die Amazäer fürchten die Gardisten als Spitzel der Priester, und so hat jeder Lehrmeister eine eigene Geheimsprache entwickelt, um seine Lehren vor unbefugten Ohren zu schützen. Diese Praxis treibt die Anwärter regelmäßig zur Verzweiflung. Jedes Jahr soll sich mindestens einer der jungen Hexer selbst entleiben, weil er von dem Sprachwirrwarr in den Lehrräumen verrückt geworden ist.
Die Nephritiim, Diener des Alten Imperiums
Im Dienste des Amazth-Heiligtums stehen mehrere Nephritiim, welche die Stadt, die heute Yal-Mordai heißt, seit Marhynianischen Zeiten bewachen. Als die Sanskitaren die Städte des alten Imperiums in Besitz nahmen, mussten sie zahllose Monstren überwinden. Die Nephritiim indes, welche ebenfalls in den verlassenen Ansiedlungen lebten, waren dienstbare Geister, welche einzelne Paläste und Herrenhäuser instand hielten und sich, da ihre alten Herren so lange fort waren, den Kunkomern als ihren neuen Herrschaften unterwarfen. Sie waren im Alten Imperium von den Vorbesitzern eingesetzt worden. Freie Nephritiim leben noch in der Geistersteppe in größerer Zahl. Gebundene indes, die für Sterbliche arbeiten, gibt es nur noch eine Handvoll, und so gelten sie ihren Besitzern als Zeichen der Macht und des Reichtums.
Gestalt und Wesen:
Nephritiim gleichen im Allgemeinen zwei bis vier Schritt hohen, beleibten Hominiden. Manche haben mehrere Armpaare und ungewöhnliche Hautfarben wie etwa blau, rot, grün oder ockergelb. Vereinzelt fehlt ihnen gar der Unterleib, so dass sie schwerelos über den Boden zu schweben scheinen. Nichtsdestotrotz sind sie massiv, nicht etwa ätherisch. Die Körper der meisten Nephritiim weisen schwere, nicht verheilende Wunden auf: Risse, in denen man weder Blut noch Fleisch sehen kann, nur ein unruhiges Wabern wie von Rauch oder Nebel. Sie wirken stets ruhig, selbst im Kampf bewahren sie einen apathischen Gesichtsausdruck. Obwohl sie die menschliche Sprache beherrschen, ist es fraglich, ob sie überhaupt über einen eigenen Willen verfügen, auch wenn manche merkwürdigen Zeitvertreiben nachgehen, wie z. B. dem Brettspiel oder dem Sammeln bestimmter Gegenstände. Weitaus seltener als die Nephritiim selber sind Artefakte, die ihnen erlauben, körperliche Schäden zu heilen (Nephritiim haben keine natürliche Regeneration). Selbst die pure Existenz der „Nabel“ genannten Artefakte ist bereits ein wohlgehütetes Geheimnis.
Vollkommene Diener:
Nephriitim sind Geisterwesen, die im Allgemeinen zwei bis vier Schritt hohen, beleibten Homininen gleichen. Manche haben mehrere Armpaare und ungewöhnliche Hautfarben wie etwa blau, rot, grün oder ockergelb. Vereinzelt fehlt ihnen der Unterleib, sodass sie über den Boden zu schweben scheinen. Nichtsdestotrotz sind sie massiv, nicht ätherisch. Die Körper der meisten Nephriitim weisen schwere, nicht verheilende Wunden auf: Risse, in denen man weder Blut noch Fleisch sehen kann, nur ein unruhiges Wabern wie von Rauch oder Nebel. Sie wirken stets ruhig, selbst im Kampf bewahren sie einen apathischen Gesichtsausdruck. Obwohl sie die menschliche Sprache beherrschen, ist es fraglich, ob sie über einen eigenen Willen verfügen, auch wenn manche merkwürdigen Zeitvertreiben nachgehen, wie z. B. dem Brettspiel oder dem Sammeln bestimmter Gegenstände. Weitaus seltener als die Nephriitim selber sind Artefakte, die ihnen erlauben, körperliche Schäden zu heilen – Nephritiim haben keine natürliche Regeneration. Selbst die pure Existenz der „Nabel“ genannten Artefakte ist bereits ein wohlgehütetes Geheimnis.
Der Besitz eines Nephriitim gilt unter den sanskitarischen Städtern als das Statussymbol schlechthin. Er zeugt nicht nur von großem Reichtum, sondern vor allem von überragender Macht. Alle Nephritiim entwickelten im Laufe der Zeit bedingungslose Loyalität zu ihren neuen Meistern, was einen kaum zu unterschätzenden Vorteil darstellt. Einen Nephriit kann man weder durch magische, mundane noch göttliche Mächte dazu veranlassen, seinem Meister zu schaden. Er wird eher vergehen, als sich einem Bann zu unterwerfen. Selbst der Tod des Meisters ändert nichts an seiner Loyalität: Die letzten Befehle des Meisters werden auch weiterhin wortgetreu ausgeführt. Sollte ein Nephriitim vererbt werden, wird er kein Wort über seinen alten Meister verlieren – eine Regel, welche anfangs bei Kunkomern und Sanskitaren für Enttäuschung gesorgt hat, hätten sie doch gerne mehr über die Marhynianer erfahren, in deren Besitz ihre Nephritiim vor ihnen standen.
Sagen und Legenden:
Natürlich kursieren beim einfachen Volk vielerlei Legenden über die Nephriitim.
* In Ribukan heißt es, Malhubim, der verschollene Nephrit des verstorbenen Sultans Sabu-Amim ay Djiassamid, sei von diesem an seinen wahren Erben vererbt worden.
* In Yal-Mordai geht das Gerücht um, dass der Sultan auf der Suche nach dem letzten weiblichen Nephrit sei, um sich eine Armee aus Nephritiim zu züchten. (Das Gerücht bleibt hinter der Wahrheit zurück. Nicht nur Al’Hrastor, sondern auch der Rat der Schemenhaften und die Zelothim sind an dieser Möglichkeit interessiert.)
* Eine weitverbreitete Legende besagt, Nephritiim seien durch einen einzigen Wunsch im Diesseits gebannt. Sollten sie diesen erfüllen können, befreie sie das aus ihrem endlosen Dienst.
Militär, Geheimpolizei und Dämonenzirkel
Die regulären Truppen Yal-Mordais, die Milizen und die Stadtgarde sind nicht innerhalb der Mauern Sach Ard’m ansässig. Hartnäckig halten sich Gerüchte über eine geheime Staatspolizei, die in den Tiefen der Zitadelle residiere und jeden Schritt der Einwohner der Stadt kontrolliere. Ihre Existenz ist weder bewiesen noch widerlegt, aber unwahrscheinlich. Vermutlich spiegeln die Legenden den Rat der Schemenhaften, dessen Anführer Hrastor über alle wichtigen Vorgänge in der Stadt bestens informiert ist und notfalls korrigierend eingreift, der am Alltagsleben der Bürger aber ebenso desinteressiert ist wie an den verrückten Verboten Al’Hrastors oder der Wesire. Die Gerüchte arbeiten den Herrschenden dennoch in die Hand, sorgen sie doch dafür, dass die Bürger sich angstvoll zurückhalten und ihre Handlungen selbst beschränken.
Das bedeutet aber nicht, dass es in Yal-Mordai keine Kontrolle geben würde. Dafür sorgen kleine unabhängige Zirkel von Dämonenbeschwörern, welche Aufträge für Al’Hrastor selbst oder für einen oder mehrere der Wesire übernehmen. Diese setzen auf Wunsch unsichtbare, heimlich lauschende Spione auf Verdächtige an und sorgen im Fall, dass sich ein Verdacht erhärtet, für das Verschwinden des Delinquenten oder für seine „Umerziehung“. Dazu wird ihm ein kleiner Dämonenparasit ins Gehirn gesetzt, der von nun an sein Denken und Handeln kontrolliert. Seine Verwandten, Freunde und Bekannten werden ihn daraufhin kaum noch wiedererkennen, und oftmals wird er für sie zu einer tödlichen Gefahr. Gotongis fliegen über die Stadt und halten sie im Auge. Fremde verschwinden, werden durch Gestaltwandler ersetzt und dann in ihre Heimat zurückgeschickt, um Feinde auszuspionieren. Zuweilen passiert dasselbe mit Einheimischen. ”Du kannst niemandem vertrauen, dein Sohn könnte ein Gestaltwandlerdämon sein, deine Mutter eine Spionin oder gehirngewaschen. Und selbst die geheime Widerstandszelle, in der du dich mit anderen Unzufriedenen verbündet hast, könnte bereits unterwandert sein“, ist ein gängiges Credo der Yal-Mordaier. Die Chancen, Opfer einer solchen Bedrohung zu werden, sind tatsächlich eher gering. Sowohl der Sultan als auch Al’Hrastor greifen nur wohldosiert auf die Dienste der Dämonenzirkel zurück, schon allein, um keine unwägbaren Gefahren auf die Stadt herabzubeschwören – und um nicht zu abhängig von den Beschwörern zu werden, die nicht selten eigene Ambitionen verfolgen das Machtgefüge der Stadt betreffend. Die Wirkung des sporadischen Einsatz jenseitiger Mächte indes könnte durchschlagender kaum sein, und sie ist eines Amazeroth würdig. Die Einheimischen steigern sich derartig in Angst und Paranoia, dass eine umfassende Kontrolle gar nicht mehr vonnöten ist. Das erledigen sie ganz von selbst.
Nach außen hin geben sich die Bürger glücklich und zufrieden, doch das Lächeln wirkt wie ihnen aufgemalt, die Augen verraten Angst, hinter der weiß getünchten Fassade der Häuser befindet sich loses Blätterwerk, die Statuen scheinen sich zu bewegen und jeden Schritt der Bewohner zu verfolgen. Es haben sich Geheimsprachen entwickelt, die nur darauf abzielen, die eigenen Worte so zu tarnen, dass sie möglichst unauffällig wirken, auch wenn von Verfänglichem geredet wird. Die Stadt treibt ihre Bewohner über kurz oder lang in den Wahnsinn, bis sie sich in paranoiden Anfällen selbst umbringen oder Massaker veranstalten. Nicht dämonisches Wirken frisst ihre Seele, sondern ihre eigenen Ängste.
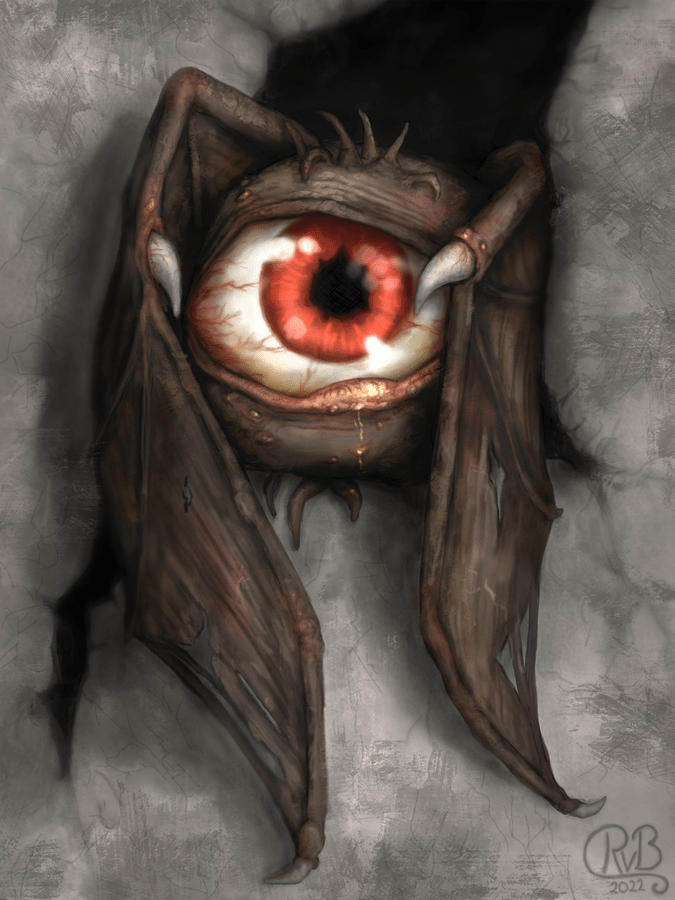
Bild verwendet mit freundlicher Genehmigung durch Ramona von Brasch
Die weiße Stadt
Es gibt einen abgeschotteten Stadtteil um den Tempelberg von Sach Ard’m, in dem nur Machthaber und Beamte wohnen. Dieser Stadtteil wird als ‚die Weiße Stadt‘ bezeichnet, weil alle Fassaden mit weißem Kalkstein aufrechterhalten werden. Anders als der Rest Yal-Mordais werden die Gebäude der Weißen Stadt den Lehren der Zelothim zum Trotz instandgehalten. Damit demonstrieren die hier lebenden Machthaber ihren Anspruch darauf, den Zelothim vorgesetzt zu sein.
Der Ächzende Wall
Umgeben ist die Siedlung von einer Stadtmauer, die ebenfalls aus imperialen Zeiten stammt. Sie besteht aus wenigen, dafür aber umso imposanteren Marhynianerwehrtürmen, welche in verschiedenen Epochen durch Mauern miteinander verbunden wurden und am besten als ein gewaltiges architektonisches Flickwerk beschrieben werden konnten. Einige Stellen würden kaum die ersten Tage einer ernsthaften Belagerung überstehen, aber beeindruckend ist die Wehranlage allemal.
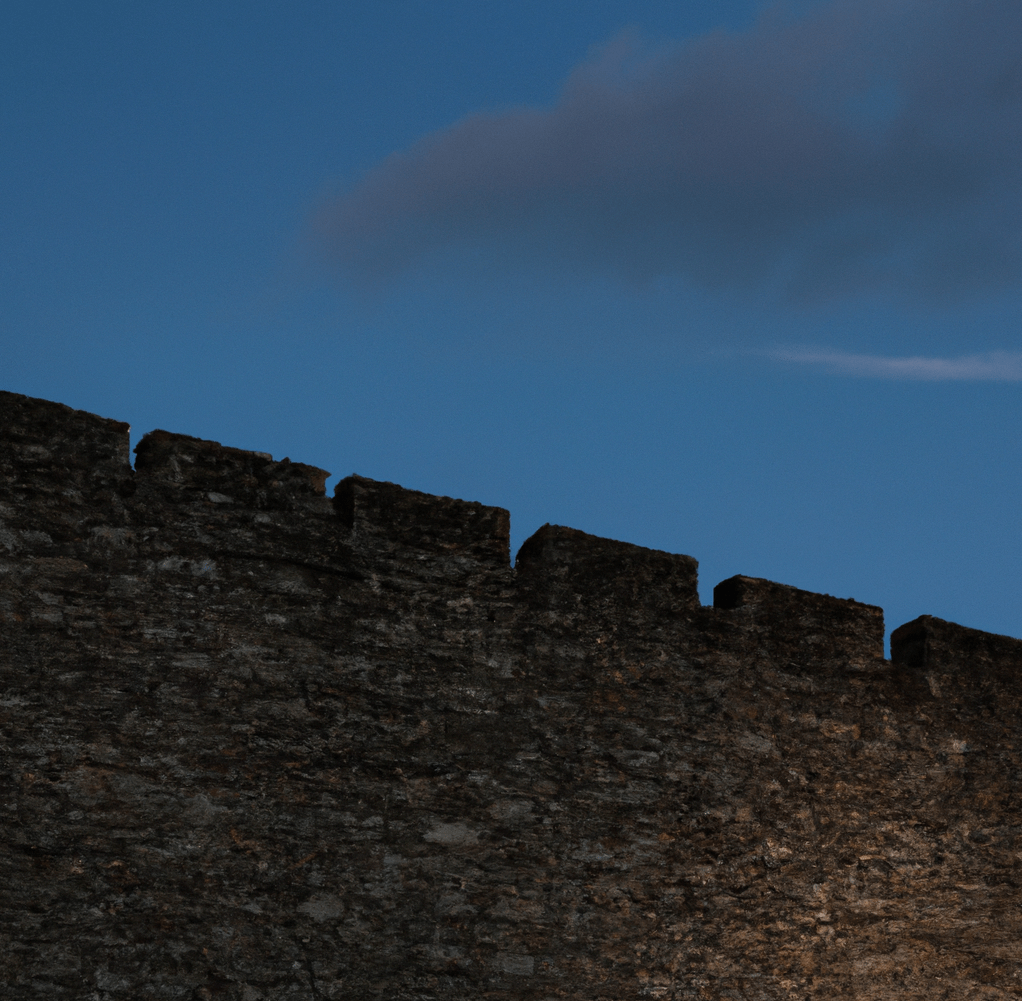
Es scheint, als ob die Stadtmauer Yal-Mordais Pilger, welche zum ersten Mal die Stadt besuchen, auf das vorbereiten möchte, was sie im Inneren erwartet. Ihren Beinamen hat sie von den Sklavenkolonnen, die bei der nie enden wollenden Arbeit an der Mauer bis aufs Blut ausgequetscht werden. Es handelt sich bei ihnen um Kriegs-und Strafgefangene Yal-Mordais, und ihr Dienst an der Mauer ist praktisch ein in die Länge gezogenes Todesurteil, so dass die Aufseher auch nicht davor zurückschrecken, im Fall von Widerworten oder Aufwiegelei die Exekution sofort zu vollstrecken.
Leben in Yal-Mordai
Die sichtbare Stadt wirkt bieder und aufgeräumt. Da es unmöglich ist, allen widerstreitenden Ge- und Verboten gerecht zu werden, versucht man den Ball flachzuhalten und nicht aufzufallen. Unter der spießig wirkenden Oberfläche jedoch kocht es. Zahllose Unterweltbosse haben die Stadt in Reviere aufgeteilt, und die meisten der Bosse haben einen mehr oder minder schweren psychischen Schaden. Am normalsten wirkt noch die “Schwarze Hand”, eine üble Kaschemme im Hafenviertel, wo Piraten und anderes Gesindel verkehren. “Der Feuervogel” hingegen führt ein erfolgreiches Etablissement, in dessen geheimen Kellerebenen dem Glücksspiel und der Prostitution gefrönt wird, und ist berüchtigt dafür, die Besitztümer seiner Konkurrenten in Brand zu stecken. “Der Rätselkönig” ist ein gedungener Mörder und Attentäter, der stets kleine Rätsel am Tatort hinterlässt, um zu testen, ob seine Häscher ihm darüber auf die Spur kommen. In der Regel jedoch weiß er seine Spuren besser zu verwischen als die Ermittler arbeiten. “Die Schattenkatze” ist eine berüchtigte Diebin und Einbrecherin, die sich wie eine Katze zu bewegen weiß und mit den Schatten zu verschmelzen versteht. “Der Trumpf” hat eine offene zutage tretende massive psychische Erkrankung. Sein Erscheinen endet oft mit einer Schneise der Verwüstung, doch scheint er Ambitionen zu haben, sich zum Herrscher der Stadt aufzuschwingen, sei es als Wesir oder als Ersatz für Al’Hrastor selbst.
Auf Außenstehende, die allmählich in die tieferliegenden Schichten der Metropole eintauchen, wirkt es zunächst so, als ob der böse Sultan dem geknechteten Volk die Lebenskraft aussaugt. Über den Herrscher hört man nur die finstersten Gerüchte. So heißt es, dass keine der unzähligen jungen Frauen, die mit ihm vermählt werden, die Hochzeitsnacht überlebe. Sie sollen allesamt finsteren Ritualen zum Opfer fallen, die das Ziel hätten, den Leib des Hexersultans am Leben zu erhalten. Doch Schritt für Schritt beginnt sich dann herauszukristallisieren, dass die vermeintlichen Opfer selbst pervertierte Geister haben.
Die meisten Einwohner Yal-Mordais sind damit arrangiert, dass ihre geistige Gesundheit angeschlagen ist und es um ihre Nachbarn kaum besser steht. Jeder ist sich selbst der Nächste. Die Vergänglichkeit des Diesseits und die unausweichliche Leidhaftigkeit des Seins dienen als willkommene Ausrede, anderen Almosen und sonstige Hilfe zu verweigern. Wer Mitleid zeigt, gilt als schwach im Glauben an Amazth. Zuweilen spielen selbst arme Tagelöhnerfamilien ausgeklügelte, wirre Spiele, um ihre Zeitgenossen ins Verderben zu stürzen oder in den Wahnsinn zu treiben. Es gibt in Yal-Mordai keine Opfer, nur Täter. Zuweilen sind es die vermeintlich Bösen, welche die Ordnung wiederherstellen. Besucher können zuweilen froh sein, wenn Zelothim oder Kristallgardisten auftauchen und dem Spuk ein Ende setzen. Deren Motive sind wenigstens nachvollziehbar und nicht von offensichtlichem Wahn getrieben. Nicht selten gelangen Besucher zu dem Schluss, der mächtige Sultan sei wohl das Beste, was diesem verderbten Sündenpfuhl passieren konnte. “Al’Hrastor, der Held” ist ein vielgehörtes Motiv, über das Gedichte geschrieben und Lieder gesungen werden. Weniger beliebt sind die Assashim, obwohl viele von ihnen ebenfalls in den Diensten des Sultans stehen. Assashim, welche die öffentliche Ordnung aufrecht erhalten sollen, verfahren nach Gutdünken und Gewohnheitsrecht, weil es keine kodifizierten Gesetze oder verbindlich überlieferten Rechtsnormen mehr gibt, nur die widersprüchlichen Anweisungen des Sultans und der Wesire. Die meisten Assashim arbeiteten wie Söldner und erpressen Schutzgeld und andere Tribute, ebenso wie es die Unterweltbosse tun.
Der Amazth-Kult ist fremden Kulten gegenüber äußerst intolerant und überzieht sie so gut er es vermag mit Repressalien, vollständig verboten sind sie aber nicht. Obwohl Yal-Mordai bereits lange Kriege geführt hat, um Rakshazar von den “falschen Göttern” zu befreien, ist das zähneknirschende Dulden der Anhänger fremder Götter notwendiger Bestandteil der Fassade, hinter welcher die Yal-Mordaier sich verstecken.
Unter den Straßen existiert eine Bewegung von Menschen, welche den Widerstand organisieren. Viele von ihnen folgen einem charismatischen Führer, einem Klingenmagier, der Zugriff auf marhynische Geheimnisse hat. Bis auf weiteres lebt die Bewegung aber vom Schmuggel und Diebstählen und will Unentschlossene – notfalls mit Gewalt – auf ihre Seite ziehen.
Zu den Mysterien der Stadt gehört ein merkwürdiger Mann, der sich in ein buntes Cape kleidet, welches dem Gefieder eines Paradiesvogels nachempfunden scheint, und dem Verbrechen und dem Wahnsinn der Stadt den Kampf angesagt hat, aber zumindest scheinbar keine Ambitionen hat, Al’Hrastor zu stürzen. “Der Paradiesvogel”, wie er oft genannt wird, arbeitet angeblich mit dem YMPD zusammen, dem Yal-Mordai Polizeidepartment, das dem Prätoriat untergeordnet ist. Er ist nur einer aus der Reihe mehrerer selbsternannter Beschützer der Stadt, die eine Art Superheldenimage pflegen, obwohl keiner von ihnen wirkliche besondere Fähigkeiten zu haben scheint.
Die blutige See / Das Meer der Schatten
Nördlich des Gelben Meeres, jenseits der Opfersteine, befindet sich die Blutige See, das Meer zwischen den Opfersteinen und Yal-Kalabeth. Die dortige Schifffahrt ist nicht weniger herausfordernd als jene auf dem Terul und selbst für die Schwimmende Festung keine Trivialität. Der Name des Binnenmeeres rührt von zahlreichen Legenden über das Blut von Erschlagenen her, das sich in das Gewässer ergossen haben soll, darunter Marus, Soldaten aus Yal-Kalabeth und Yal-Mordai sowie Opfer der Ipexco. Zudem färbt die Algenblüte im Frühjahr zwischen Ende Firun bis Ende Ingerimm das sonst grünblaue Wasser tiefrot. Ein herrliches, wahrhaft atemberaubendes Schauspiel, das wunderschön anzusehen ist und schon so manchen fahrenden Händler in seinen Bann gezogen hat. Es setzt jedoch auch ein beträchtliches Risiko, ja eine schier tödliche Gefahr für Schiffe.
Unter der Oberfläche des sanften, kaum dreihundert Schritt tiefen Wassers, in dem es kaum Tidenhub gibt, leben und jagen zahlreiche Schrecken, von der Riesenkrake über die Seeschlange bis zum Daimonid. Diese können sonst anhand ihres Schattens rechtzeitig identifiziert werden, sodass es möglich ist, ihnen auszuweichen oder Rituale zu ihrer Besänftigung zu unternehmen. Unter dem Rot der Algen indes werden die Schatten, denen das Binnenmeer seinen Beinamen Meer der Schatten verdankt, beinahe unsichtbar, und so kommt es vermehrt zur Auseinandersetzung zwischen den Schiffen der Menschen und den Kreaturen der See.
Der Beiname “Meer der Schatten” könnte eine zweite Erklärung in Erzählungen über den Rat der Schemenhaften finden. Die Insel der Schatten Ongrapur und die Inseln der Schattenlords sind im Riesland zu wenig bekannt und liegen zu weit entfernt von der Blutigen See, als dass sie als Namensgeber in Frage kämen. Denkbar wäre allerdings eine Verbindung zu Ribukan und seiner Akademie der Schatten. Zwischen Yal-Mordai und Ribukan gab es über viele Jahrhunderte hinweg eine bedeutende Handelsroute, die auch in der Zeit der kriegerischen Auseinandersetzung zwischen den beiden Stadtstaaten nie ganz erloschen ist.
Da Yal-Mordai die enge Einfahrt zur Blutigen See mit einem künstlichen Wehr, das noch aus marhynianischer Zeit stammt, verschließen kann, halten die Aventurier das Meer der Schatten für ein Binnenmeer und haben es auf den gängigen Karten vom Riesland auch so verzeichnet. Die Bezeichnung „Blutige See“ indes hat es nie bis nach Aventurien geschafft. Die Aventurier haben vielmehr einen anderen Teil des Perlenmeeres mit diesem Begriff versehen. Blutige See meint den Bereich, der Maraskan umgibt, sich bis Vallusa und Norden und bis Jilaskan im Süden zieht. Die Blutige See Aventuriens entstand im Laufe der Borbarad-Krise, weil Charyptoroth-Paktierer und die Ma’hay’tamim (Dämonenarchen) das Meer zwischen Maraskan und dem Festland pervertierten.
Die Kraftlinie “Schattenstrang”, die zur “Zwölfsaitigen Götterharfe” gehört, verbindet die Dämonenzitadelle mit dem Meer der Schatten.
Allgemeines Bild: Grünblaues Wasser, von Ende Firun bis Ende Ingerimm färbt die Algenblüte das Wasser rot, kaum Tidenhub. Sanftes, kaum 300 Schritt tiefes Wasser.
Inseln: Keine, allerdings ein großes Korallenriff rund um Lubaantuna.
Fanggründe: Häufig
Bedeutende Häfen: Yal-Mordai, Yal-Kalabeth, Lubaantuna, diverse Küstendörfer der Ipexco, Unterläufe der Blutzunge und des Sanskis
Seemächte: Yal-Mordai, Yal-Kalabeth, Ipexco
Mysterien: Tempel des Amazth, Schwimmende Festung und Sultan Al’Hrastor in Yal-Mordai, Tempelstädte im Tal der Tempel, Ruinen aus längst vergangener Zeit, versunkene Schiffe.
Gefahren: Kriegsflotten aus Yal-Mordai und Yal-Kalabeth, Piraten, Seemonster, Riffe, Ipexco.
Historia
Der Augenstern und die Ankunft der Tulamiden
Die Tulamiden und die Seefahrt
Das Reich der Marus war dem Untergang geweiht, als die ersten tulamidischen Siedler vom fernen Westkontinent Aventurien den Fuß auf den Süden des Rieslands setzten. Es handelte sich um Angehörige des Volkes der Tulamiden, die einem prosperierenden und expansiven Reich an der Ostküste Aventuriens entstammten, dem sogenannten Diamantenen Sultanat unter Sultan Amir al’Dhubb beziehungsweise Amr al-Dhubb. Der namensstiftende “Diamant” war in Wahrheit der Karfunkelstein des Großen Drachen Pyrdacor, den die Menschen in den Ruinen der alten Echsenstadt Yash’Hualay fanden, auf deren Trümmern die Sultansstadt Khunchom entstehen sollte.
1.779 v. BF war Rashtul al’Sheik verstorben. Sein Sohn Bastrabun hatte im Alter von 121 Jahren den Thron von Rashdul bestiegen und die Herrschaft bald darauf ins strategisch günstiger gelegene Mherwed verlegt. Wenig später hatte sich der Skrechu Ensharzaggesi, Inkarnation des Alveraniars des Verbotenen Wissens, zum Herrscher über Yash’Hualay aufgeschwungen und 1.777 v. BF den Frieden zwischen Echsen und Menschen aufgekündigt. Es kam zunächst zu kleineren Scharmützeln, bei denen Bastrabun und seine Leute den erstaunlichen magischen Fähigkeiten Ensharzaggesis nichts entgegenzusetzen hatten. Dann jedoch bot sich ihm 1.775 v. BF der Skrechu Aliss’Szargo, Inkarnation des Alveraniars des Verborgenen Wissens, als Ratgeber an und lehrte ihn Wege, die Angriffe der Echsen abzuwehren. Trotz des Misstrauens, das Aliss’Szargo seitens der meisten Menschen entgegenschlug, gelang es ihnen so, die Echsen zurückzuschlagen.
Der Skrechu verriet den Menschen das Geheimnis des alten Kultplatzes H’Azzrah, in dem Ensharzaggesi eine Pforte des Grauens geöffnet hatte, aus der er einen wesentlichen Teil seiner Macht bezog. Bastrabun gelang es, die Pforte zu schließen und Ensharzaggesi dadurch wesentlich zu schwächen. Dies führte dazu, dass Bastrabun 1.762 v. BF die Echsenstadt Yash’Hualay im Gebiet des Mhanadi-Deltas erobern und größtenteils niederbrennen lassen konnte. Auf dem Großteil ihrer Ruinen entstand in den kommenden fünf Jahren die heutige tulamidische Stadt Khunchom.
1.760 v. BF fand Bastrabun dank eines Hinweises seitens Aliss’Szargo in einem geheimen Kultraum tief unter einem der Tempel in Yash’Hualay den Karfunkelstein und arbeitete ihn zum Drachenei um, ohne zu erkennen, mit was er es zu tun hatte. Er hielt seinen Fund für einen magischen Diamanten, der fortan als Fokus für viele Zauber diente und zum namensgebenden Artefakt des Diamantenen Sultanats – den Titel eines Sultans von Khunchom nahm Bastrabun 1.757 v. BF an – und der Drachenei-Akademie zu Khunchom wurde. Die Suche nach Charyptas Szepter, das laut Aliss’Szargo ebenfalls in Yash’Hualay aufbewahrt wurde, blieb ergebnislos. Die Echsen hatten es kurz vor dem Fall der Stadt auf die Insel Marustan verbringen lassen, das spätere Maraskan.
Mit der Hilfe Aliss’Szargos gelang es Bastrabun nun, die Macht der Echsen trotz deren chimärischer und dämonischer Hilfe zu brechen und ab 1.762 v. BF eine magische Barriere namens Bastrabuns Bann zu errichten, um ihre Rückkehr zu verhindern. Als Preis für seine Hilfe verlangte der Alveraniar des Verborgenen Wissens von Bastrabun den Schwur, dass dieser die Echsen nicht vollständig ausrotten dürfe. Er solle ihnen die Echsensümpfe und Marustan als Lebensraum überlassen. Bastrabun willigte ein und gewährte einer stattlichen Zahl von Echsen unterschiedlicher Spezies freien Abzug nach Marustan, wohin sie unter der Führerschaft von Ensharzaggesis Vertrauter, der Skrechu, auch zogen und 1.752 v. BF die Stadt Akrabaal gründeten. Bastrabun verbot den Tulamiden nun, zur See zu fahren, um zu verhindern, dass tulamidische Kapitäne Marustan anfuhren und den Schwur brachen, den er geleistet hatte.
Um 1.740 v. BF verwundete Aliss’Szargo Ensharzaggesi in einer direkten Konfrontation so schwer, dass dieser die Stadt Zhamorrah dem Zorn seiner Feinde hinterließ, spurlos verschwand und wohl wenig später sein Leben aushauchte. Bastrabun verstarb in nahem zeitlichem Zusammenhang, im Jahre 1738 v. BF.
Im Jahr des Regierungsantritts Amir al‘Dhubbs, 1.223 v. BF, erschien ein neues, enorm hell strahlendes Gestirn am Firmament. Daraufhin entstand in Südaventurien ein Kult, dessen Priester den Stern für eine Gottheit mit nur einem Auge hielten, das sich geöffnet hatte, um Aventurien mit wachsamem Blick zu prüfen. Sie tauften den Stern Ashtra al Ain bzw. Augenstern und schufen eine Reihe von einäugigen Götzenstatuen. Dem Sultan weissagten sie, dass seine Herrschaft wahrhaft unter einem guten Stern stehe.
Eine reichlich euphemistische Prophezeiung, wird heutzutage doch verschiedentlich vermutet, dass das Erscheinen des Augensterns ein Werk des Erzdämons Amazeroth gewesen sein könnte. Womöglich besteht ein Zusammenhang mit Mek’Thagor, dem Blinden Auge, das dennoch alles sieht, mit einem potenziellen Ea’Myr des Amazeroth aus dem Erbe des Nandus oder mit den Gotongi, den einäugigen Dämonen aus seinem Gefolge. Es manifestiert sich zuweilen als Dreiaugenmaske, hinter deren Augenöffnungen ein blendend grelles Schwarzes Feuer lodert. Indem Mek’Thagor ein Sternauge anstelle eines Stirnauges verkörperte, soll Amazeroth die Tulamiden ins Riesland gelockt haben, um sie für seine Zwecke einzuspannen. Dies umfasst unter anderem die Gründung des mächtigen Amazth-Kultes von Yal-Mordai, die erneute Inbetriebnahme der Sternensenke, eines dort befindlichen Amazeroth-Unheiligtums aus marhynianischen Zeiten, sowie den Aufstieg des Hexersultans Al’Hrastor nebst seinem Versuch, die Vorherrschaft über das Riesland zu erringen und mit Hilfe des Goldenen Netzes, der durch den Kometeneinschlag verheerten Kraftlinien Rakshazars, die Schöpfung wahlweise zu beherrschen oder zu vernichten.
Der Augenstern sorgte für eine euphorische Aufbruchstimmung im Diamantenen Sultanat, von der auch die Segelkunst profitierte. Die Verehrung des vergöttlichten Gestirns wie auch die Tatsache, dass man es als weithin sichtbaren Orientierungspunkt heranziehen konnte, beflügelten die tulamidische Seefahrt, was bemerkenswert war, hatte doch einst Rashtul al’Sheiks Sohn Bastrabun Ausflüge aufs Meer verboten, um sein Volk vom Bannland Marustan fernzuhalten. Ein weiterer Hinweis darauf, dass es sich beim Augenstern um eine Amazerade gehandelt haben könnte, denn nicht ganz zwei Jahre nach dem Erscheinen des Gestirns brach ein wagemutiger Kapitän den Schwur, den Rashtul al’Sheiks Sohn im Namen seiner Tulamiden geleistet hatte.
1.221 v. BF umrundete eine tulamidische Zauberzedrakke Marustan. Dies führte im Volk zu großer Verunsicherung, weil jahrhundertealte Gewissheiten plötzlich auf den Prüfstand gerieten und andere Antworten verlangen als zuvor. In dieser Phase des Umbruchs riefen viele zum tulamidischen Hauptgott Feqz, dem Herrn über Glück und Unglück. Der jedoch schwieg und verwies sein Volk damit ein weiteres Mal darauf, sich selbst zu helfen, wie es seiner Natur entsprach. Daraufhin fühlten sich nicht wenige von ihm in ihrem persönlichen Schicksal im Stich gelassen. Die Astrologen prophezeiten bald, dass der Augenstern Abenteuerlustigen den Weg in eine neue Heimat weisen würde. Dies gab vielen vom Glück Verlassenen neue Hoffnung. Sie versprachen sich von der vermeintlichen neuen Gottheit Schutz und Hilfe.
Fe(y)rushan
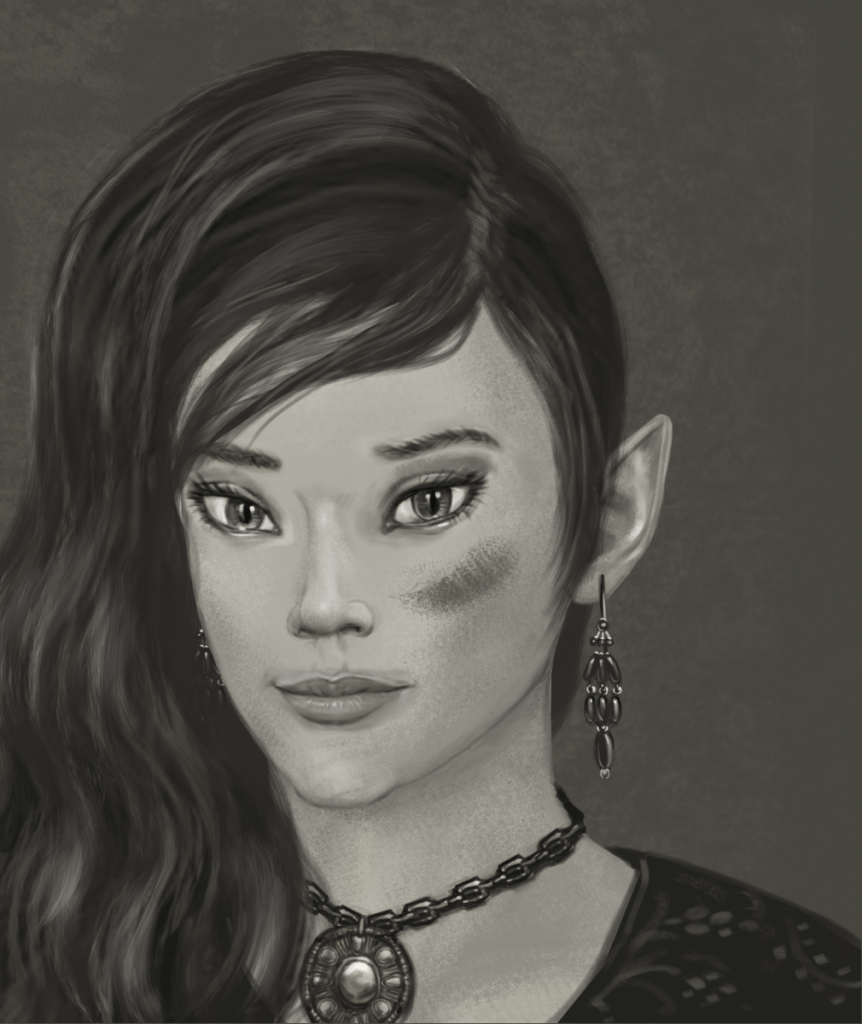
Die wagemutige Kapitänin Fe(y)ruschan Rohalsunya, die es längst riskiert hatte, mit ihrer Zedrakke den heutigen Maraskansund zu befahren und ihn seither zu überwinden wusste,wurde durch die astrologische Weissagung inspiriert. Diese kam ihr schon deshalb gelegen, weil sie in Aventurien ihren Anspruch auf ihr Erbe verloren hatte, als es aufgrund ihrer immer spitzer werdenden Ohren ruchbar wurde, dass sie nicht die rechtmäßige Tochter ihres wohlhabenden Vaters sein konnte. Sie entstammte einer Liaison ihrer Mutter, die eine Khunchomer Magierin war, mit einem Elfen.
Dies ist genau der Klatsch und Tratsch, aus dem Märchen, Sagen und Legenden entstehen, und so erzählt man sich heute zuweilen, Feruschans Mutter hätte eine Affäre mit dem Reichsbehüter Rohal gehabt, was schon aufgrund der zeitlichen Verschiebung kaum plausibel scheint. Wahrscheinlich ist „Rohalsunya“ (Rohalstochter) noch nicht einmal Feruschans richtiger Nachname, sondern ein Beiname, den sie im Laufe der Jahrhunderte aufgrund dieser Legendenbildung erhielt.
Auch an der Korrektheit des für sie überlieferten Vornamens darf getrost gezweifelt werden, bezeichnet die erste, gern zu „Fe“ verkürzte Silbe „Fey“ doch im Isdira einen Elfen, während „ruschan“ vermutlich mit dem tulamidischen „raschid“ (”weise“, ”gerecht“) oder ”raschtul“ („unüberwindlich“) in Verbindung steht. Der vermeintliche Vorname der Rieslandfahrerin entpuppt sich somit als Aufzählung ihr zugeschriebener Eigenschaften einschließlich der vermeintlichen Unüberwindbarkeit des Ozeans, den sie zu meistern lernte.
Offenbar erbte die Halbelfe die magische Begabung ihrer Erzeuger. Man sagt ihr nach, sie habe eine besondere Affinität zu Wogengeistern und Windelementaren gehabt.
Der Traum vom Ostkontinent
Neben den Weissagungen kamen Feruschan die Märchen zu Ohren, welche die Haimamudim auf Khunchoms Basaren erzählten. Sie sprachen vom großen Kontinent im Osten, von mächtigen Wesen, so groß wie vier ausgewachsene Männer. Der Halbelfe begegneten außerdem Legenden über die Riesin Chalwen, deren Thron vom Drachen Pyrdacor ins Meer gestürzt worden sein sollte. Beides verband sich in ihrem Geist zu einem immer bestimmter werdenden Plan. Feyruschan beschloss, in Richtung des Nachbarkontinents in See zu stechen.
Der Weg zum Ostkontinent war lang und gefährlich. Nicht umsonst nannten die Bewohner der Küste das Meer, welches sie von Aventurien trennte, ehrfurchtsvoll den Unbezwingbaren Ozean. Angesichts der willkommenen Hilfe durch den Augenstern-Gott und unter Berücksichtigung der Weissagung der Astrologen schien „unbezwingbar“ der Kapitänin allerdings ein sehr relativer Begriff zu sein. Als größeres Problem erwies sich, dass sie aufgrund ihres ramponierten Rufs und angesichts der offensichtlichen Aussichtslosigkeit ihres Unterfangens keine Geldgeber fand. Also musste sie mit ihrer alten Zedrakke lossegeln. Um sich zumindest den Sold für die Mannschaft und Vorräte leisten zu können, stahl sie eine große Menge Gold von ihren Eltern, auch wenn sie es selbst nicht so bezeichnete. In ihrer Vorstellung hatte sie sich den Teil des elterlichen Erbes geholt, um den man sie betrogen hatte.
So schnell sie es vermochte, scharte sie eine Mannschaft um sich und verschwand bei Nacht und Nebel gen Osten. Ihre Seeleute waren vor allem Veteranen des Krieges gegen die in Aventurien lebenden Echsenmenschen, entfernte Vettern der Marus und Nagah des Rieslandes. Der Großteil dieser bewährten Kämpfer, viele von ihnen einstige Kataphrakten, Panzerreiter, die auf Trampeltieren, Dromedaren, Nashörnern und Elefanten ritten, hatte sich den Verehrern des Augensterns angeschlossen, weil sie ihre Siege in den Kämpfen der Jahre 1.212 bis 1.203 v. BF dem Gott des Gestirns zu verdanken glaubten. Der fromme Sultan Amr hingegen verstand diese Deutung als Beleidigung seiner Person, da er vorher dem Gott Feqz öffentlich immense Opfergaben als Bitte um Kriegsglück wider die echsischen Tempelpyramiden H’Rabaal, Gulagal und Nabuleth dargebracht hatte, die letzten Echsenreiche auf dem aventurischen Festland. Sollte sein Opfer etwa nicht den Göttern wohlgefällig gewesen sein, und war es also nicht der Grund für den Sieg?
Hinzu kam, dass Feqz auch der Herr des Nachthimmels ist, weswegen der Augenstern von den Feqz-Priestern als Konkurrenz in der Domäne ihres Herrn betrachtet wurde. Die Anhänger des Augensterns gerieten so zu Ausgestoßenen und verloren den Anspruch auf ihre zugesicherten Pensionen als Soldaten. Für Amr kam dieser Frevel sehr gelegen, denn die Überstrapazierung der herrschaftlichen Finanzen durch die Kriege hätte es ihm ohnehin unmöglich gemacht, die Pensionen zu zahlen. Er war daher nur zu gerne bereit, sich zu empören. Viele der betrogenen Soldaten wurden zu Banditen, andere zu Abenteurern, die nichts mehr zu verlieren hatten.
Die Vorstellungen der Ur-Tulamiden über die Welt muteten dabei selbst abenteuerlich an. Sie betrachteten Dere als Scheibe, auf der in drei, sieben oder zwölf durch Wasser getrennten Ringen die verschiedenen Gefilde liegen: Im Zentrum befinde sich Al’Veran, das Land der Götter, auf einem äußeren Ring Vasarstan (ursprünglich womöglich Visarstan), das Land der Toten, und ein Dutzend weiterer Ahnen-, Geister- und Mumienreiche. Dschejjhennach, die rostrote Hölle, liege unterhalb der Weltenscheibe, welche von den Dämonen an einigen Stellen durchlöchert worden sein soll – eine vage Parallele zur Siebten Sphäre, dem Sternenwall und Marhynas Frevel. Durch den Kontakt mit den Güldenländern wurde diese Weltsicht im Laufe der Jahrhunderte erweitert, in ihrer Grundstruktur ist sie aber noch immer bei vielen Tulamiden zu finden.
Feyruschans Reise ins Riesland, über die ansonsten wenig überliefert ist, folgte diesem Weltbild, vor allem einem überlieferten Schöpfungsmythos, nach dem es ein inneres und ein äußeres Meer gibt. In dieser Vorstellung bilden die Kontinente Aventurien und Riesland eine zusammengehörige Landmasse, die ein großes Binnenmeer umschließe. So, wie die Kontinente am Ehernen Schwert aneinandergrenzen, sollen sie es auch auf Höhe der Waldinseln tun. Nur dort, so glaubten die Ostaventurier, bestehe eine Verbindung zwischen dem Inneren und dem Äußeren Meer, die jedoch aufgrund von Bastrabuns Bannmauer nicht überquert werden könne.
Ein Blick auf eine moderne Derenkarte offenbart, dass die Ur-Tulamiden mit diesem Weltbild irrten. Aventurien und das Riesland sind im Süden nicht miteinander verbunden, es gibt keine Landbarriere zwischen den Weltmeeren. Die Ur-Tulamiden hätten gewiss erstaunt reagiert, wenn sich ihnen das Meer für eine Überfahrt nach Uthuria oder Myranor geöffnet hätte, für eine Fahrt ins Riesland in Richtung Nordost oder Ost allerdings war ihre Mythologie präzise genug.
Das “Äußere Meer” der Legenden entspricht in etwa dem Gletschermeer, Ifirns Ozean, dem Meer der Sieben Winde, dem Güldenmeer, dem Meer der Verlorenen, dem auch Feuermeer genannten Südmeer, dem südlichen Nebelmeer und dem Schattenmeer. Das „Innere Meer“ deckt sich im Wesentlichen mit dem Perlenmeer bzw. „Unbezwingbaren Ozean“, dem nördlichen Nebelmeer, dem Gelben Meer und der (riesländischen) Blutigen See (auch Schattenmeer genannt und weder deckungsgleich mit dem Schattenmeer der modernen Karten noch mit der Blutigen See Ostaventuriens während der Borbaradära). Alle Gewässer, die es für eine Reise von der Ostküste Aventuriens bis in riesländische Gefilde braucht, sind also auch nach tulamidischer Vorstellung für ein Schiff erreichbar.
Gemäß diesem Weltbild ist das “Innere Meer” von einem Landring umgeben, dessen Westen das Land der Ersten Sonne bilde, die Stammheimat der Tulamiden, welche sie auch als Tulamidistan bezeichneten. Im Osten sei weiteres Land zu finden. Insoweit deckt sich der Mythos also in etwa mit der Realität, weshalb eine Rieslandfahrt, die sich in östlicher oder nordöstlicher Richtung hält, den mythischen Angaben folgend durchaus gelingen kann.
Seit Ferushans Expedition unterscheiden die Legenden auf riesländischem Gebiet zwischen Rakshazastan, Land der Riesen, im Nordosten, und dem weiter südlich gelegenen Zulneddistan, Land der Echsen, was den Echsendschungeln und den Jominischen Inseln entspricht.

Verwendung des Bildes geschieht mit freundlicher Genehmigung durch Ramona von Brasch
Gefährliche Überfahrt
Auf dem Weg durch den Unbezwingbaren Ozean lauern bis heute tödliche Gefahren. Weitläufige Tangfelder bergen das Risiko, dass das Schiff auf ewig darin steckenbleibt. Es gibt ausgedehnte Flautezonen, in denen sich nie ein Lüftchen regt und in denen ein Segelschiff deshalb nicht von der Stelle kommt. Umgekehrt ist die Rede von gewaltigen Strudeln und Mahlströmen sowie zwei Jahrhundertstürmen, welche jedes Schiff zermalmen, wohl der Gebelaus und Kauca. Es gibt offenbar eine Strecke, die zwischen ihnen hindurchführt, die sogenannte „Sternenklarpassage“, welche eine nächtliche Navigation anhand der Gestirne ermöglicht, doch ein Steuermann, der nicht genau weiß, was er tun muss, hat kaum eine Chance, ihrem Verlauf zu folgen. Darüber hinaus ist die nächtliche Navigation gefährlich, weil Hindernisse oder Seeungeheuer – Charyptas Kreaturen zählen zu den typischen Bedrohungen, ebenso der Dämon Turgoth, Seeschlangen, riesige Gruppen von Walen und die gefürchteten Rirgit – in der Schwärze der Nacht auf dem Unbezwingbaren Ozean leicht übersehen werden können. Auch außerhalb des Einflussbereichs der Jahrhundertstürme sind die Gestirne aufgrund unzähliger Unwetter nur selten zu sehen. „Kompantenwahn“ bezeichnet eine Zone, in welcher jeder Südfinder verrücktspielt oder sich gar nicht bewegt. Auch hier bleibt nur die Navigation nach den Gestirnen. Stellenweise speien untermeerische Vulkane Lava und giftige Dämpfe, in Küstennähe werden auch an Land befindliche Schlote rasch zur tödlichen Gefahr. Gefährliche Strömungen treiben Schiffe gegen Klippen, auf unterseeische Felsnadeln oder auf tückische Sandbänke. Die meisten Passagen führen nahe an den Inseln der Schattenlords vorbei. Keinesfalls zu unterschätzen sind auch die Wasserdrachen, die im Auftrag des Großen Drachen Aldinor darüber wachen, dass das Verbot der Götter, vom einen zum anderen Kontinent zu reisen, eingehalten wird.
Rohalsunyas Unterfangen jedoch hatte Erfolg. Die Seefahrer wurden durch Zauberer sowie Luft- und Wasserdschinne unterstützt, was wohl der maßgebliche Grund ist, warum sie alle Gefahren umschiffen konnten. In ihrer von religiösem Eifer und Aberglauben geprägten Wahrnehmung allerdings war es allein die Position des Augensterns, die sie 1.181 v. BF sicher an die Westküste Rakshazars führte, genauer gesagt an die waldreiche Landzunge zwischen den Flüssen Ebro und Kree im Dreistromland, eine Region, die bald auch Rahyastan – gen Rahja gelegene Region – oder Ostland genannt wurde. Rahyastan bezeichnete ursprünglich das gesamte den Tulamiden bekannte Riesland, was das Dreistromland, Teile der Geistersteppe, Kap Parhami, die Grüne Sichel, die Jominischen Inseln, das Umfeld von Ribukan und den Süden des heutigen Herrschaftsgebiets von Amhas umfasste. Eine sprachliche saubere Unterscheidung von Rakshazastan, dem Riesland, erfolgte erst im Laufe der Zeit, als sich mit der Verbesserung der geographischen Kenntnisse Rahyastan mehr und mehr als Alternativbezeichnung für das Dreistromland etablierte, welches heutzutage allein gemeint ist, wenn der Begriff fällt.
Der Unbezwingbare Ozean

Westlich der Jominischen Inseln liegt der Unbezwingbare Ozean, eine Wasserwüste, welche die kleinen Schiffe aus Rakshazar nicht zu bezwingen vermögen. Einst kamen über diesen Ozean die Vorfahren der Sanskitaren aus dem fernen Aventurien. Doch inzwischen ist fast jeder Kontakt mit dem Westkontinent abgebrochen.
Weitere Namen: Äußerer Ozean (tulamidische Karten), Westlicher Ozean.
Allgemeines Bild: Tiefblaues Wasser, ständiger Wellengang und ständige Brise von West-Süd-West (Raschtuls Atem).
Inseln: Korelkin, Unlon, diverse kleine Archipele.
Fanggründe: Gelegentlich, dann aber große Fischschwärme, Wale.
Bedeutende Häfen: Kleine Siedlung der Horasier auf Korelkin.
Seemächte: Expeditionsflotten aus Aventurien (sehr selten), Tocamuyac (sehr selten), Kentaishi und Seenomaden.
Mysterien: Zalzar/Korelkin. Sargassosee östlich von Maraskan, Hinterlassenschaften der Schwertmagier. Ruinen aus längst vergangen Zeiten.
Gefahren: Ririgit, Seemonster, Riesenwellen, Mahlströme, Sargassofelder, Inseln der Schattenlords, Diener Aldinors.
Die Siedlungen der Tulamiden und Echsen
Rakshazar, Land der Riesen
Feyruschan traf im Riesland als erstes auf die Rakshazas, borkenhäutige Baumschrate bzw. Waldtrolle von vier Schritt Größe, welche die Wälder des Südens bewohnten. Da sie ebenso stark wie gehorsam, sanft und friedfertig waren, neigten die anderen Spezies dazu, sie zu versklaven, um ihre gewaltigen Kräfte zu nutzen, oft genug auch für Kriegszwecke. Nach ihnen nannte Feyruschan den Kontinent Rakshazastan, tulamidisch für „Land der Rakshazas“, „Land der Riesen“ bzw. „Riesenland“. Daraus wurde dann später „Rakshazar“, das ”Riesland“. Dies folgte einer alten Tradition, unbekannte Regionen nach der dort vorherrschenden Spezies zu benennen, so wie es in Aventurien beim Orkland und beim Yeti-Land der Fall ist. Noch auf der Vollständigen Weltkarte von Sumus Leib aus dem 16. Regierungsjahr Rohals des Weisen finden sich Einträge wie Echsland, Goblinland und Zwergenlandt, die erst bei näherer Erforschung präziseren Angaben wichen. Der Nachbarkontinent indes blieb den Aventuriern für immer fremd und behielt deshalb seine ursprüngliche Bezeichnung.
Die erste Siedlung
Dabei hatte die wagemutige Kapitänin zunächst nur das Dreistromland entdeckt. Am Ufer der Flüsse fanden die Tulamiden gute Bedingungen für den Anbau von Reis, Getreide, Gemüse und allerlei Fruchtpflanzen vor. Deshalb gründeten Feyruschan Rohalsunya und ihre Mannschaft zunächst eine kleine Siedlung aus Pfahlbauten an der Mündung des Kree. Der kleine Ort, der nach seiner Gründerin Yal-Feruschan bzw. entsprechend ihrem tatsächlichen Vornamen getauft wurde, ist heute längst verlassen und vergessen. Er musste aufgegeben werden, als der Fluss wenige Jahrzehnte später seinen Lauf änderte und die Natur zurückeroberte, was die Menschen ihr mühsam abgetrotzt hatten. Doch bis dahin hatte er seine Rolle als Ausgangspunkt einer wahren Besiedlungswelle, die das Riesland nachhaltig verändern sollte, schon lange erfüllt.
Die Begegnung mit den Echsen
Als die aventurischen Siedler erstmals auf die Nagah und die Marus trafen, die den Süden des Kontinents beherrschten, richteten sie sich auf Feindseligkeiten ein. Doch zu ihrer Überraschung schienen die Echsenvölker den friedlichen Austausch mit den Tulamiden zu suchen, die sie bald Kunkomer nannten, da sie den Namen ihrer Heimatstadt Khunchom nicht anders auszusprechen vermochten.
Die somit erstaunlich friedfertige Begegnung der Menschen mit ihren echsischen Rivalen hatte religiöse Gründe. Sufra, das Orakel des Reiches, hatte prophezeit, dass die Herrschaft der Nagah dem Untergang geweiht sei, sollten sie ihre Hand gegen Feyruschan erheben. Es war ihnen deshalb nicht erlaubt, den Menschen ein Haar zu krümmen. Trotz dieser Warnung entschlossen sich die Nagah, den Versuch zu unternehmen, dem Schicksal ein Schnippchen zu schlagen und sich der Fremdlinge zu entledigen. Sie boten den Kunkomern die Ruinen der Marhynianer als Wohnort an. Sie selbst mieden diese verwunschenen Orte, auch wenn sie kein Wissen über deren einstige Erbauer hatten. Insgeheim hofften die Nagah, die unbedarften Neuankömmlinge würden von den Ungeheuern verschlungen werden, die immer noch in den Überresten der uralten Städte ihr Unwesen trieben.
Feyruschans Gefährten waren in ihrer alten Heimat Veteranen im Kampf gegen Echsenwesen gewesen, hier aber war ihre Zahl klein, und so blieb ihnen nichts anderes übrig, als den ungeliebten Gastgebern entgegenzukommen und ihre verdächtige Großzügigkeit anzunehmen. Sie begaben sich in die halbversunkenen Häuserschluchten, die später zu Yal-Amir werden sollten und heute als Arkimstolz bekannt sind, und wurden bald darauf von Monstren heimgesucht, wie die ortsansässigen Echsen es gehofft hatten. Doch die entschlossenen und kampferprobten Krieger schafften es, die Bestien zu vernichten. In Katakomben unter der Stadt fanden sie zahlreiche magische Artefakte und Schatzkammern, die die anderen Völker in ihrer Scheu vor den Ruinen nie entdeckt hatten. Als reiche Frauen und Männer kehrten die Seefahrer nach nur wenigen Jahren ins Diamantene Sultanat zurück und wurden dort als Helden verehrt. Die Halbelfe zahlte die Summe zurück, die sie sich von ihren Eltern „geborgt“ hatte – mit Zins und Zinseszins. Sie wollte denen, die sie so unfair behandelt hatten, nichts schuldig bleiben.
Aufbruchstimmung
Schon bald fanden sich viele abenteuerlustige Siedler, die im neu entdeckten Rakshazastan nach Reichtümern suchen wollten. Sultan Amir erkannte darin seine Chance, die durch seine Kriege gegen die Echsenstädte arg gebeutelten Finanzen seiner aventurischen Heimat aufzubessern, und sandte eigene Truppen über das Meer. Er nahm die Ruinenstadt, die Feyrushans Leute freigekämpft hatten, im Namen des Diamantenen Sultanats in Besitz und gründete dort eine Stadt, die er nach seinem eigenen Namen Yal-Amir taufte. Die Siedlung trug diesen Namen weit länger als ein Jahrtausend. Erst in jüngerer Vergangenheit wurde sie in Arkimstolz umbenannt. Namensgeber ist Arkamin IV., der aktuell amtierende sanskitarische Herrscher des Stadtstaates Shahana.
Sufra, der in der Nähe dieser Stadt hauste, wurde ab diesem Zeitpunkt nicht mehr gesehen. Als das Gerücht aufkam, er sei von den Kunkomern vergiftet worden, verbreitete sich dieses wie ein Lauffeuer im Süden Rakshazars. Die Nagah erkannten, dass Sufras letzte Prophezeiung wahr zu werden drohte, deshalb sank ihr Mut. Sie ließen die Menschen kampflos auf der Halbinsel gewähren, welche die Kunkomer in Verehrung ihrer Gottheit des Reisens und des Handels „Aveshas Daumen“ tauften. Die Ordnung des Echsenreiches war grundlegend erschüttert. Ohne die spirituelle Führung Sufras traten schon nach wenigen Jahren überall in Rakshazars Süden lokale Kriegsfürsten der Marus und charismatische Nagah-Priester an die Stelle der bisherigen Verwalter. Am erfolgreichsten erwies sich eine Fraktion von Marus, die es riskierte, ein uraltes Tabu ihrer Kultur zu überwinden: Sie ließ sich in einer der Marhynianer-Städte nieder, und zwar in den Ruinen, an deren Stelle heute die Sanskitaren-Stadt Shahana liegt. Die neu gegründete Siedlung Szu’Shaz wagte es zwar nicht, den Neuankömmlingen im Norden aktiv Widerstand zu leisten, wurde jedoch eine lokale Macht, die ihr Territorium südlich des Flusses Kree vor den Gesetzlosen ihres eigenen Volkes sowie vor übermütigen kunkomer Spähern zu verteidigen wusste.
Längst segelten mehrmals im Jahr Schiffe aus Khunchom mit Siedlern an Bord über das Meer. Da Feyruschan Rohalsunya als einzige sichere Wege in das Ostland kannte, hielt ihre Reederei das Monopol auf die Rieslandfahrt. Doch obwohl Sultan Amir in den Marhynianischen Ruinen zahlreiche Reichtümer barg und damit die gebeutelten Staatsfinanzen entscheidend aufbesserte, konnte er sich zu Lebzeiten nicht dazu entschließen, den wagemutigen Entdeckern Amnestie zu erteilen. Er nahm lediglich davon Abstand, sie weiterhin zu verfolgen. Erst als Amir 1.175 v. BF starb, erließ Toba al’Akran, dessen Staatskasse weiterhin durch Rohalsunyas Unternehmungen entscheidend aufgebessert wurde, den Veteranen ihre vermeintliche Schuld.
Das Dreistromland
Obwohl auch das Land zwischen den drei Flüssen Kree, Haba (auch: Darces) und Ebro (auch: Shan) einst von den Folgen des Kataklysmus getroffen worden war und Marhynianische Ruinen zurückließ, ist es doch in der Küstenregionen deutlich fruchtbarer als die meisten anderen Regionen des Rieslands und gilt neben dem Blühenden Halbmond, also der Grünen Sichel, als Kornkammer des südlichen Rieslands. Sein mediterranes Klima sorgt für ganzjährig warme Temperaturen. Der Sommer kann drückend heiß werden, doch stehen genügend schattenspendende Bäume und klare Bäche mit kühlem Wasser zur Verfügung. Schnee ist in dieser Region unbekannt, dafür gibt es im Winter heftige Regenfälle, die von den Einheimischen „Craesoon“ genannt werden. Danach benannt ist ein unter den Parnhai-Sklaven sehr beliebtes Lied namens „Durch den Craesoon“, das ihre Flucht aus den Händen ihrer Peiniger „hinter die Welt, ans Ende der Zeit, bis kein Regen mehr fällt“ beschreibt, wo sie in Frieden und Freiheit leben können. Es wurde von einer Musikgruppe geschrieben, die sich „Kithorra Kaulitz Klum Taverne“ nannte, bevor sanskitarische Peiniger ihre Mitglieder zu Tode peitschen ließen.
Die drei Flüsse, die das Land säumen, treten jedes Jahr nach dem Craesoon über die Ufer und überschwemmen das Land mit fruchtbarem Schlamm. Dadurch verwandelt sich das Küstengebiet des Dreistromlandes in einen dicht wuchernden Mangrovensumpf. Weiter im Inland ist der Boden hart, steinig und mager, doch dank des aus den Überschwemmungen stammenden fruchtbaren Schlamms wachsen hier saftige grüne Wälder, die zahlreichen Wildtieren eine Heimstatt bieten, darunter Wasserechsen, kleinere Saurierarten, Amphibien, Vögel, Flugechsen, Lemuren, Hutaffen und das gefährlichste Raubtier der Region, das in späterer Zeit Shahana-Tiger getauft werden sollte. Die kleinen Rudel von Schreckensklauen, die durch die Wälder streifen, sind entgegen aller Legenden, welche die Raptoren zu gefürchteten Menschenfressern aufbauschen, für Hominine weitgehend harmlos, lassen sie sich doch leicht mit Steinwürfen vertreiben. Einige Bauern halten sich sogar zahme Exemplare als Wachtiere. Die Taktik mit den Steinwürfen haben sich auch die vielen Lemuren und Hutaffen zu Eigen gemacht, die hier in den Baumkronen leben. In den immerfeuchten Sümpfen wird es etwas gefährlicher, denn hier wimmelt es geradezu von Alligatoren, Wasserschlangen sowie kleineren Riesenschnappern, Mosasauriern und Maasechsen.
Entlang der drei Flüsse Kree, Haba und Ebro wird das Land bis in die Gegenwart hinein für riesländische Verhältnisse intensiv bearbeitet. Alle paar Meilen finden sich kleine Bauerndörfer aus hölzernen Pfahlhäusern. Diese Bauweise hat sich bewährt, denn die immer wieder sanft über die Ufer tretenden Ströme können diesen Dörfern kaum etwas anhaben, und auch die ausgedehnten Mangrovensümpfe im Delta der drei Ströme können so mit Leichtigkeit besiedelt werden. Hier lässt sich eine Vielzahl verschiedenster Feldfrüchte anbauen. Vor allem Reis wird in den feuchten Auen des Dreistromlandes angepflanzt. Etwas weiter weg von den Ufern findet man auch Weizen. Darüber hinaus unterhält jedes Dorf diverse Obst- und Gemüsefelder, wobei vor allem Kokospalmen, Tomaten und Zitrusfrüchte gut gedeihen. Die Erträge würden ausreichen, um den Dörflern ein gutes Leben zu ermöglichen. Unglücklicherweise wandert der überwiegende Teil der Ernten in die Kornkammern des großen Shahana, sodass die Dörfler kaum etwas von den Früchten ihrer Arbeit haben.
Rahyastan war einst eine Provinz des Diamantenen Sultanats auf rakshazarischem Boden. Später wechselte es häufig den Besitzer. Mal war es Teil der verschiedenen Sanskitarenreiche, mal unterstand es allein Shahana, mal war es eine unabhängige Region. Zeitweilig wurde es von den aranischen Freibeutern, Piraten und Plünderern kontrolliert, welche sich eine neue, von Shahana verschiedene Operationsbasis suchen mussten. Zum Teil kam es zur Verbrüderung mit den nomadisch lebenden Sanskitarenstämmen, zum Teil haben sich die Aranier mit den Reiternomaden erbitterte Kämpfe geliefert. Dieser Epoche verdankt die Region eine Reihe von Tempeln, in denen einst aranische Götter verehrt wurden und von denen heute meist nur noch Ruinen übrig sind.
Die Schattenkrieger
Kriegerische Phex-Orden wie die Schattenkrieger und die Mungos finden ihre Ursprünge in den Auseinandersetzungen zwischen Tulamiden und Echsen der Ära nach Rashtul al’Sheik. Unter Bastrabun, dem Sohn des Erwählten des Giganten Raschtul, fand der Feqz-Kult wieder zu seiner alten Blüte, und bald formierten sich die Anhänger des Fuchsgottes in Orden, welche sich die Bekämpfung alles Echsischen auf die Fahne schrieben. Wie es der Natur des Phex entspricht, sind sie ganz der Heimlichkeit verpflichtet. Schon die ursprünglichen Schattenkrieger waren Meuchler, die Konflikte mittels Attentaten, Sabotage, Raubzügen und Gifteinsatz entschieden. Dabei sollen ihre eigenen geheimen Ziele und Pläne durchaus nicht immer im Einklang mit denen ihrer Auftraggeber gestanden haben. Die Mondkrieger der urtulamidischen Vorzeit verbargen sich hinter einem Nimbus des Geheimnisvollen, der Mystik und der Legenden, von denen die meisten vom Orden selbst gestreut worden sein dürften. Entsprechend wird als Gründer der Schattenkrieger Feyhach al’Ahmad, der Rächer, genannt, eine Märchenfigur, deren tatsächliche Existenz eher zweifelhaft erscheint.
Wer sich auf aventurischem Boden heute Schattenkrieger nennt, sieht sich in der Tradition der uralten Kriege gegen die Echsenwesen. Der Konflikt zwischen Menschen und Echsen ist längst verblasst, und die Dominanz über das Elfte Zeitalter klar in die Hand der Homininen übergegangen. Dennoch findet der Begriff “Schattenkrieger” auch heute noch Verwendung und bezeichnet in den aventurischen Tulamidenlanden alle im Geheimen agierenden Meuchler bzw. “Schleichkrieger” wie Abduls Assassinen (Fasar), die Attentäter von Al’Bor (früheres Mengbilla), die maraskanischen Meuchler, die Hand Borons (Al’Anfa) und die Fayar oder Faruhahim, die Späherinnen.
Die Streiter des nächtlichen Feqz muss man dabei als die unmittelbaren aventurischen Nachfolger des urtulamidischen Ordens ansehen. Sie setzen den Kampf gegen alles Echsische fort, postulieren sie doch, schlangenzüngige Echsengötter (gemeint dürften vor allem Hesinde und Tsa sein) hätten sich im Glauben der Menschen verfestigt, und die Magie der Kaltblüter fließe in ihren Venen. Den Anführer der heutigen Schattenkrieger, genannt der Helm oder auch Letzter Schleier des Mondes, vermutet man in Fasar, das nach Al’Anfa als wichtigster Hort des Meuchlerwesens gilt. Hier verehrt man Phex als “Kämpfer in der Nacht”, als Gegner der Echsen, als gewitzten Dieb und Streiter für die Menschen. Tatsächlich residiert das Oberhaupt des Ordens jedoch in einem nebelverhüllten Bergkloster im Raschtulswall.
Ein Schattenkrieger beseitigt lautlos alle Feinde der göttlichen Ordnung, ob getarnt in den schwarzen Landen, als Rebell auf Maraskan oder wo auch immer sich Dämonenknechte verborgen halten. Die Waffen des Schattenkriegers sind blitzende Dolche, schnelle Pfeile, tödliches Gift und sirrende Wurfsterne. Als Rüstung trägt er den Schutz durch Nebel und Nacht und den Beistand seiner Gefährten.
Während der aventurischen Dunklen Zeiten, genauer gesagt in der Ägide des Sultans Yadail al’Musaf (255 bis 212 v. BF), Begründer der fünften Dynastie der Diamantenen Sultane, tobte in Khunchom zwischen den Schattenkriegern und den wenigen Echsensöldnern der Stadt ein Krieg in den Schatten. Der unversöhnliche Hass zwischen den Feqz-Kriegern und den Schuppigen führte immer wieder zu blutigen Vorfällen zwischen den verfeindeten Gruppen. Beide Seiten versuchten, die andere zu provozieren, etwas Unüberlegtes zu tun, aus dem man selbst dann Kapital zu schlagen versuchte. Dieser Krieg fand meist verborgen vor den Augen der Öffentlichkeit statt. Eine wichtige Figur der Auseinandersetzung scheint der Phex-Priester und Schattenkrieger Karim ibn Madli al ‚Ahjan gewesen zu sein, der später, 190 v. BF, auch in die Auseinandersetzungen mit dem Großsultanat Elem verwickelt war.
Neben dem Kampf zwischen Schattenkriegern und Echsen drehte sich der Krieg in den Schatten außerdem um den Streit zwischen dem Abu Thabeit, dem Vater der Schale, und dem Sahib al’Ton, dem Gebieter des Goldes, welche bis dahin die Unterwelt Khunchoms als Doppelspitze angeführt hatten. Immer wieder kam es zwischen den beiden zu Reibereien über die Führung der Halle der Grauen, der Khunchomer Schar der Bettler und Diebe. Während der Herr der Bettler auf einem strengen, ordnenden Kurs bestand, plädierte der König der Diebe für ein freieres, ungebundenes Vorgehen. Dies führte schließlich zur Spaltung der Schar und dem Jahrzehnte dauernden Krieg in den Schatten.
Während der Drachenchronik in den 1030er Jahren machte der 985 BF geborene, vom Phex-Glauben abgefallene Schattenkrieger Duwok von sich reden. Er ist ein Gefolgsmann des Illusionsmagiers und Wesirs von Al’Ahabad Nijar ben Hasrabal, zweitgeborener Sohn Sultan Hasrabal ben Yakubans.
Als zu Zeiten Feruschans in der Heimat Khunchom ruchbar wurde, dass die Tulamiden im Riesland auf echsische Gegenspieler getroffen waren, dauerte es nicht lange, bis die ersten Schattenkrieger auf den Schiffen anheuerten und nach Rakshazar reisten, um auch dort den Kampf gegen die Geschuppten aufzunehmen. Gewiss waren es Schattenkrieger, welche die Ermordung des Orakels Sufra zu verantworten hatten.
Ihr Fanatismus in der Verfolgung alles Echsischen brachte die Schattenkrieger rasch in Gegensatz zur offiziellen Politik des Diamantenen Sultanats und seiner Kolonien, die angesichts der verhaltenen Opposition der riesländischen Echsenwesen eher den Ausgleich mit ihnen denn die kriegerische Auseinandersetzung suchten. Die Schattenkrieger ließen sich von der Politik der Sultane und ihrer Stellvertreter nicht beeindrucken und führten einen blutigen Kreuzzug gegen die geschuppten Nachbarn, der die Kolonien der Gefahr eines großangelegen Angriffs seitens der echsischen Herrschaften aussetzte.
Da jede Aufforderung, dergleichen zu unterlassen, nicht fruchtete, gingen die Statthalter der Kolonien ihrerseits dazu über, die Verbrechen der Schattenkrieger gewaltsam zu ahnden. Nachdem mehrere ihrer Ordensmitglieder in aller Öffentlichkeit auf dem Scheiterhaufen verbrannt worden waren, tauchten die Schattenkrieger in den Untergrund ab, bildeten geheime Logen und versuchen seither immer wieder, die Feindschaft zwischen den Tulamiden bzw. ihren sanskitarischen Nachfahren und ihren echsischen Nachbarn zu schüren. Die heutigen Herrscher Ribukans, Shahanas oder Yal-Mordais ahnen nicht einmal im Entferntesten, wie viele Schattenkrieger wirklich unerkannt innerhalb ihrer Territorien agieren. Fest steht, dass ihr Orden nie erloschen ist. Tatsächlich dürfte es sogar eine Vielzahl von kleineren, teils rivalisierenden Meuchlergemeinschaften sein, die in den Sanskitarenlanden ihrem morbiden Handwerk nachgeht und den Frieden zwischen den Tulamidenabkömmlingen und den Geschuppten zu beenden versucht.
Sprungbrett Archipel der Perlen
Die Entdeckung des Archipels der Perlen durch eine Expedition von Rieslandreisenden war ein reiner Zufallsfund, geschuldet ungünstigen Strömungen und Winden, welche sie von der sicheren Passage forttrieb, die Rohalsunya entdeckt hatte. Für eine Weile erwies sich der Fund als echter Glücksfall. Nicht nur, dass das entdeckende Schiff auf den Inseln wieder seetüchtig gemacht werden und seine Reise ins Riesland fortsetzen konnte, der Archipel zeigte sich als sicherer Hafen, der künftig bei vielen Rieslandreisen angefahren wurde. Schließlich ließen sich hier sogar Siedler nieder, Glücksritter, Schatzsucher, Ausgestoßene und solche, die glaubten, als Dienstleister für Rieslandreisende etwas von den Waren abzweigen zu können, welche diese an Bord hatten. Manche von ihnen bewohnten die Plantagen-Insel. Diese weist auf Grund der Düngung mit Vulkanasche eine erstaunliche Fruchtbarkeit auf, welche die tulamidischen Erstendecker nutzen wollten. Sie rodeten den Wald und legten umfangreiche Plantagen an. Kultiviert wurde u. a. die auf der Insel heimische Sinjaa-Pflanze, eine Ölpflanze, die zu den Hülsenfruchtgewächsen zählt. Die Sinjaa-Bohne erwies sich als nahrhaft und vielseitig verwendbar.
Ferushans Schicksal
Als alte Dame erlebte Feyruschan noch, wie das hundertste Schiff den Khunchomer Hafen gen Yal-Amir verließ. Die Tulamiden hatten sich bis dahin in ihrer Enklave fest etabliert, und es machte nicht den Anschein, als würden sie das gewonnene Land wieder preisgeben wollen. In dieser Zeit wurden auch zahlreiche Magier der Tradition der Kophtanim ins Riesland entsandt, die nach den Geheimnissen der Nagah und der unbekannten Erbauer der riesenhaften Marhynianer-Ruinen suchen sollten. Einige fanden dabei den Tod, andere wurden zu berühmten Entdeckern von Ehrfurcht gebietenden Bauwerken und bargen machtvolle Artefakte, die oft den Weg nach Aventurien fanden. In den Händen wohlhabender Familien wurden diese Gegenstände zu hochverehrten Erbstücken, die bis heute in Grüften, Kellergewölben und Schatzkammern auf ihre Wiederentdeckung durch Abenteurer warten, und zwar auf beiden Kontinenten.
Der Überlieferung nach entschlief Feruschan nach einem erfüllten Leben friedlich in ihrem Bett. Das Schicksal ihres Schiffes hingegen ist ungeklärt. Noch heute vermutet man seine Überreste im Aimar-Zahbar, dem größten Hafen der Stadt Khunchom. Zahllose Taucher haben sich auf die Suche nach der Schlangenzürnerin begeben, Rohalsunays legendärer Zedrakke, mit der sie die erste Überfahrt ins Riesland vollbrachte. Doch keiner von ihnen konnte das gesuchte Schiff am Boden des Khunchomer Hafens entdecken.
Hartnäckig halten sich Gerüchte, Rohalsunya habe Klingen aus lichtverschluckendem Stahl mitgebracht. Auch von kopfgroßen Kristallen, die unverfrorene Wahrheiten aussprechen, ist die Rede. Und von Segeln, die sich anfühlen, als seien sie aus Spinnenfäden gewonnen. Bis heute weiß niemand, ob es diese Artefakte gibt, wo sie zu finden sein könnten und ob es sich um mehr handelt als bloßes Seemannsgarn.
In den folgenden Jahrhunderten, vor allem während der Dunklen Zeiten, wurde in Aventurien insgesamt dreizehn Seefahrerdynastien das Privileg verliehen, das Riesland zu bereisen und sich dabei auf das Diamantene Sultanat zu berufen. Sie alle führten ihre Abstammung auf Feruschan Rohalsunya zurück. Ohne das hoheitliche Privileg war es unter Androhung der Todesstrafe verboten, die Länder des Ostens anzusteuern. Doch die Berichte über gewaltige Reichtümer waren so groß, dass immer wieder Seeleute gegen das Verbot verstießen und Rakshazar anfuhren.
Zu ihnen gehörte auch Dscheffar ibn Amar, möglicherweise ein leiblicher Sohn des verstorbenen Sultans Amr, Entdecker vieler Inseln und Länder jenseits Marustans, den ein mysteriöser Traum zu den Zauberweibern auf der Elburischen Halbinsel führte. Diese erkannten seine Träume als von der Unsterblichen Chalwen gesandte Visionen und halfen ihm bei der Deutung. Kurz darauf stieß Dscheffar überhastet in See, mutmaßlich in Richtung des Rieslands. Der Diamantene Sultan setzte daraufhin eine Belohnung auf seinen Kopf aus. Angeblich drängte eine Delegation Elems, hinter der letztlich das Unterwasserreich Wahjad stand, den Herrscher dazu, dem abtrünnigen Seefahrer nachzusegeln. Was aus Dscheffars Expedition wurde, ob sie das Riesland erreichte und ob sie fand, was immer sie suchte, lässt sich heute nicht mehr sicher nachhalten. Manche Legenden behaupten, dass er das Riesland bereist habe, aber auf der Rückfahrt bei dem Versuch, Chalwens Thron zu erreichen, um mit ihr über die Erkenntnisse seiner Unternehmung zu sprechen, spurlos verschwunden sei.
Die Thalukk
Die Thalukk ist ein alltäglicher Anblick in der Blutigen See, im Gelben Meer und auf den angrenzenden Flüssen. Sie ist das Arbeitsschiff der Sanskitaren. Es kommt beim Fischfang zum Einsatz, beim Handel entlang der Küste und mit dem Hinterland, als Piratenschiff oder – vor allem in Ribukan – als Kriegsschiff. Kaum jemand weiß heute noch, dass dieser Schiffstyp ursprünglich zusammen mit den Kunkomer nach Rakshazar kam und von der aventurischen Thalukke abstammt. Der Schiffstyp hat sich seither kaum verändert, es sind lediglich Ausleger hinzugekommen, welche das Schiff stabilisieren sollen. Die Anzahl der Ausleger hängt davon ab, ob das Schiff auf den Flüssen fahren soll – in diesem Fall kommen keine Ausleger zum Einsatz –, ob es an der Küste entlangsegelt – dann wird ein Ausleger montiert, der bei nach Westen fahrenden Schiffen an Bordbord, bei nach Osten fahrenden Seglern an Steuerbord angebracht wird – oder ob es bis zu den äußeren Inseln reist – in diesem Fall werden zwei Ausleger verwendet. Schiffe dieses Typs sind bis zu fünfzehn Schritt lang und zwei, maximal drei Schritt breit, einmastig und aus einfachen Brettern gezimmert. Am Heck der Thalukk befindet sich ein kleiner Aufbau, auf welchem der Steuermann das Heckruder bedient. Bast zwischen den Brettern soll das Heck abdichten. In aller Regel lässt sich eine vollständige Abdichtung jedoch nicht erreichen, sodass die Mannschaft viel Zeit mit dem Wasserschöpfen verbringt. Bei manchen dieser Schiffe ist der ansonsten offene, knapp zwei Schritt tiefe Frachtraum mit einer einfachen Hütte überdacht. Diese Thalukken transportieren vor allem Passagiere und feuchtigkeitsempfindliche Waren.
Die schwimmende Festung von Yal-Mordai
In der Zeit um 1.000 v. BF wuchs durch eine atemberaubende Entdeckung auch die militärische Stärke der Kolonien: Als die Vorfahren der Sanskitaren die verlassenen Ruinen der heutigen Stadt Yal-Mordai betraten, staunten sie nicht schlecht, als sie im Hafen der Stadt ein uraltes, mächtiges Artefakt fanden. Vor ihren Augen erhob sich mitten im tiefen Wasser des Hafens eine Schwimmende Festung, ein wahrer Palast mit mehr als 200 Schritt Kantenlänge, fünf Stockwerke hoch über die Wasseroberfläche aufragend, jedes einzelne so hoch und geräumig, dass selbst ein Troll leicht darin hätte hausen können. Mit Hilfe einer magischen Krone, die vom Vorbesitzer in den Gängen des Schiffes scheinbar achtlos fallengelassen worden war, ließ sich dieser monströse, Schwimmende Palast ganz nach Belieben steuern. Schon bald war der Besitz dieser Krone mit der Herrschaftswürde des neu entstandenen Volkes der Sanskitaren verbunden. Bis heute ist die Krone der Sanskitaren von Hand zu Hand gegangen und befindet sich momentan im Besitz von Al‘Hrastor, dem Tyrannen von Yal-Mordai.
Die ältesten Sagen und Märchen der Remshen, die bis in die Zeit des Zweiten Marhynianischen Imperiums zurückreichen, lassen erkennen, dass die Vorgängersiedlung Yal-Mordais einst von „schlangenleibigen Priesterkönigen“ beherrscht worden ist. Möglicherweise war sie eine der wenigen festen Ansiedlungen der als aufrührerisch geltenden Nagah. Denkbar wäre auch, dass es unter den Nagah verschiedene Fraktionen gab. Die Bewohner von Yal-Mordais Vorgängersiedlung könnten dem Imperium angehört haben oder zumindest von ihm bezahlt worden sein und gegen ihre rebellierenden Schwestern und Brüder gestritten haben. Womöglich war die Stadt selbst umkämpft, und die eine Fraktion musste irgendwann schleunigst vor der anderen fliehen. Dies wäre eine mögliche Erklärung für das achtlose Zurücklassen der steuernden Krone für die Schwimmende Festung, auch wenn es wahrscheinlicher ist, dass diese in unmittelbarem Zusammenhang mit den Verheerungen durch den Kataklysmus aufgegeben worden ist. Die Zerstörungen, welche der Kometeneinschlag angerichtet hat, und das darauffolgende Zeitalter der Asche dürften den Einsatz eines riesigen Festungsschiffs jeglichen Sinns beraubt haben.
Wie viele solcher Festungen es geben mag, ist bei den Gelehrten umstritten. Einige reden von sieben, andere von neun, ja es gibt sogar Gelehrte, die von einer Flotte des Güldenen Gottes sprechen, die aus nicht weniger als 99 dieser Ungetüme bestehen soll. Bekannt sind dagegen gerade einmal vier Festungen, von denen heutzutage nur noch eine einzige voll einsatzbereit ist und von ihrem derzeitigen Besitzer als ultimative Waffe genutzt wird. Es spricht einiges dafür, dass die Imperialen sich bei der Erstellung der Festungen an den Zauberschiffen der Hochelfen orientiert haben.
Die Stadt Yal-Mordai und die Silberne Dynastie
Der Krieg der Floh-Sultane
In den Jahren nach dem Untergang der Stadt Sanskitar, nach der das vereinigte Volk der Tulamiden und der Remshen seinen heutigen Namen Sanskitaren erhielt, kämpften mehrere einflussreiche Familien um die Vorherrschaft in der Grünen Sichel und im Dreistromland. Jede Partei beanspruchte überzogene Herrschaftsansprüche und schmückte sich mit klangvollen Titeln. Bald wurde es üblich, sogar den Herrscher eines Stadtviertels oder auch nur einer bäuerlichen Länderei Sultan zu nennen. „Der Krieg der Floh-Sultane“, wie Spottdichter diese Zeit später auch nennen sollten, fand allerdings weniger auf dem Schlachtfeld als auf den Redepulten der Marktplätze, auf den Feldern der Bauern und in den Hinterzimmern der Paläste statt.
Währenddessen erschienen immer wieder einzelne Gesandte und versprachen den streitenden Parteien magische Macht und die Unterstützung angeblich überlebender Rorkhas. Meist war dies ein recht offensichtlicher Betrug. Allerlei Hochstapler, die oft nicht einmal eine passende Klinge besaßen, geschweige denn zaubern konnten, wurden durch die Tatsache, dass über das Aussehen und die Macht der Rorkhas kaum etwas bekannt war, dazu verleitet, die Mächtigen um ihre Reichtümer zu prellen. Manchmal erschienen allerdings fähige Klingenmagier, was es in den Bereich des Möglichen rückte, dass man einen echten Überlebenden des Massakers von Sanskitar vor sich hatte. Die Macht solcher Zauberkrieger in den Diensten ambitionierter Fürsten hielt das Land für einige Monate in Atem, bis der vermeintliche oder tatsächliche Rorkha von Seinesgleichen besiegt oder durch ein besseres Angebot abgeworben wurde.
Obwohl man sich selbst gern der Macht der “Rorkhas” bediente, nutzte man zugleich den schlechten Ruf des Ordens, um Stimmung gegen den politischen Gegner zu machen, der dasselbe tat. Man unterstellte ihm, nichts als Chaos und Zerstörung im Sinn zu haben und willkürlich Dämonenmacht zu entfesseln. Das Meiste davon war schiere Verleumdung, aber an den Rorkhas blieben diese Gerüchte bis in die Gegenwart hinein kleben.
Zu dieser Zeit erließen die Städte Yal-Kharibet und Yal-Amir verblüffende Gesetze, welche den Stadtrat wählbar machten und jedem Mann über 40 Jahren Stimmrecht bei der Wahl verliehen. Jeder hatte dabei so viele Stimmen, wie er Söhne und Sklaven hatte. Diese Tradition wird in den sanskitarischen Städten bis heute gepflegt, auch wenn spätere Sultane die Befugnisse des Rates immer wieder eingeschränkt haben. Auch viele Dichter und berühmte Philosophen lebten in dieser unruhigen Generation, in der vieles möglich schien und die alte Ordnung ins Wanken geriet. Ihre Lehren waren geprägt von der Aufforderung, sein Glück nicht in materiellen Reichtümern zu suchen, sondern in Bildung und Meditation. Niemand vermag heute zu sagen, welche Stadt bzw. Partei sich am Ende durchgesetzt hätte, denn zu einer Entscheidung kam es nicht.
Die Rückkehr des Diamantenen Sultanats
Eine Macht, deren Einfluss schon fast vergessen war, meldete sich zurück. Das Diamantene Sultanat stieß vom Westkontinent Aventurien kommend erneut ins Riesland vor und konnte durch geschickte Diplomatie die sanskitarischen Städte in ein Bündnis führen. Hinzu kamen die Handelskontakte mit einer wohlhabenden Nagah-Stadt namens Unlon auf den Jominischen Inseln, die es ermöglichten, dieses Eiland bei den Reisen der Aventurier auf das Festland von Rakshazar als Zwischenstation zu nutzen. Auf die Angebote zur Zusammenarbeit reagierten die Republiken Yal-Kharibeth und Yal-Amir eher reserviert, während sich die autokratischen Städte Ribukan und Shahana, wie Sha-An-Arr jetzt meist genannt wurde, weil sich der Name so besser aussprechen ließ, praktisch als Kolonien dem Mutterland anschlossen. Shahana gehörte somit wieder, Ribukan erstmalig zum Diamantenen Sultanat. Die beiden Städte suchten den Schutz der Tulamiden, um sich vor den konkurrierenden Stadtstaaten, vermeintlichen Rorkhas, ihren eigenen Bürgern und deren aufrührerischer Stimmung zu schützen.
Die Gründung Yal-Mordais
876 v. BF befahl Sultan Mordai ibn Dhuri, eine neue Stadt im Riesland zu gründen, die seinen Namen tragen und als neuer Brückenkopf für die Erschließung Kap Parhamis dienen sollte. Als Standort wählte man die Ruinen der alten Marhynianer-Siedlung, in der einst die Schwimmende Festung gefunden worden war. Ein ganzes Heer von Parnhai, sanskitarischen Sklaven aus Shahana und Ribukan sowie Lohnarbeitern der Brokthar wurde aus dem Boden gestampft, um an der Stadt mitzubauen.
Allerdings erwies sich der Standort als denkbar schlecht gewählt. Das ohnehin überdimensionierte Projekt wurde von Sabotageakten geplagt und kam stellenweise auf Jahre zum Erliegen. Die sanskitarischen Städte sahen sich zu Recht in ihrer liebgewonnenen Autonomie bedroht. In einem regelmäßigen Zyklus töteten die Sklaven ihre Aufseher, nahmen sich Baumaterial für ihre eigenen Behausungen oder verkauften es weiter. Teils konnten sie sogar eine eigene Verwaltung etablierten, nur um dann später von neuen Soldaten aus Aventurien wieder unterjocht zu werden, bis auch diese Aufseher einige Monate später tot waren. General Thasir, ein in Ungnade gefallener Vertrauter des Sultans, der während der Schlacht von Punin, auch Schlacht auf den Yaquirwiesen genannt, 881 v. BF gegen das Bosparanische Reich eine verheerende Niederlage des Diamantenen Sultanats mitzuverantworten hatte, in deren Folge sich Seneb-Horas zum Entsetzen der Ur-Tulamiden zum Fürsten der Tulamiden ausrief, sollte vor Ort den Bau beaufsichtigen und schließlich der erste Verweser werden. Auf diesem Posten erhoffte er sich eine Möglichkeit zur Rehabilitation, obwohl ihn der Sultan ganz offenbar mit voller Absicht in diesen abgelegenen Teil der Welt fortgelobt hatte. Thasir musste für sich selbst sorgen, entging nur mit knapper Not mehreren Mordanschlägen und solidarisierte sich mal mit den Arbeitern, mal mit seinen Herren, wie es gerade opportun erschien. Es war das traurige letzte Kapitel im Leben des alten Veteranen, von dem in Aventurien niemand etwas ahnte.
Der Kult des Amazth
In dieser Zeit gelangte ein Geheimbund, welcher dem verschlagenen Gott Amazth diente, zu großer Macht und schwang sich zum inoffiziellen Herrscher über das Heer von Sklavenarbeitern auf. Vermutlich ist es diesem Bund zu verdanken, dass das seit marhynianischen Zeiten in den Ruinen befindliche Unheiligtum des Amazeroth, die sogenannte Sternensenke, von den Siedlern reaktiviert wurde und von nun an erneut ihren unheilvollen Einfluss auf einen Großteil der Stadt ausübte. Dadurch mutierten weite Teile der Ruinensiedlung zur Tabuzone, in der niemand überleben, geschweige denn bei klarem Verstand bleiben konnte.
Das Ende Sultan Mordais
Schließlich gab Thasir auf und begab sich in die Gefangenschaft des Sultans von Yal-Kharibet, Hashin der Bärtige. Sultan Mordais Geschichte endete nicht minder tragisch. 872 v. BF begegnete er den bosparanischen Legionen erneut im Kampf und fuhr wiederum eine verheerende Niederlage ein. In der Schlacht von Nebachot, auch Schlacht am Darpatbogen genannt, wehrte das bosparanische Heer die Angriffe der Heere des Diamantenen Sultanats mehrfach ab. Der heutige Heilige der Rondra-Kirche Leomar von Baburin brachte mit Hilfe der Posaunen von Perricum die Mauern des belagerten Nebachot zum Einsturz. Die Stadt wurde von den Bosparanern erobert, geschleift und in Perricum umbenannt. Sultan Mordai wählte daraufhin den Freitod. Beim Vormarsch der Bosparaner auf Nebachot (Perricum), Unukh (Beilunk) und War’Hunk (Warunk) stieß Leomar im Molchenberg in der heutigen Warunkei auf den bedeutendsten Teilleib des im Fünften Zeitalter besiegten Omegatherions.
Die Geschichte der Sanskitaren hingegen verlief für die nächsten 200 Jahre überraschend friedlich: Die wohlhabende Klasse der Händler und Landbesitzer übernahm in allen Städten die Oberhand, und die lokalen Sultane wurden immer mehr zu zeremoniellen Figuren ohne echte politische Macht.
Die Fertigstellung Yal-Mordais
Schließlich baute man Yal-Mordai doch noch fertig, aber anders als Mordai es sich gedacht hatte. Die Diener Amazth‘ wurden zu den spirituellen Anführern der ehemaligen Bausklaven und die Stadt zu einer egalitären Siedlung der gläubigen Diener des Gottes Amazth. Innerhalb von zwei Generationen war eine bürgerliche Bewegung entstanden, die viele der alten Götter verdrängte und Amazth an ihre Stelle setzte. Achtung erlangte in den Augen der Gottheit nur der Strebsame und Gebildete und nicht mehr derjenige, der seine Position nur durch seine Abstammung von einem alten Herrschergeschlecht begründete. Um ihre eigene Machtposition in den Sanskitarenstädten mit ihrer selbstbewussten Klasse von Händlern und Grundbesitzern zu rechtfertigen, bekannten sich bald alle städtischen Sultane zu Amazth. Sie pilgerten in die Bauruinen von Yal-Mordai, um die Legitimation durch die örtlichen Priester zu erhalten. Dort, auf neutralem Grund, wurde auch von Vertretern der Städte der neue oberste Ratsmeister gekürt, der über die Angelegenheiten der Sanskitaren als Ganzes entscheiden sollte. Obwohl keine leibliche Verwandtschaft zwischen ihnen bestand und der Sohn eines Ratsmeisters sogar ausdrücklich nicht wählbar war, betrachten Historiker diese Männer doch als eine Dynastie, die Silberne Dynastie. Der Name erinnert an die Bedeutung von Handel und Geld, aber auch an die zur Schau getragene Bescheidenheit der Herrscher.
Azuri ibn‘Zahalan und die Bronzene Dynastie der Sanskitaren
Azuri ibn‘Zahalan, Vater des modernen Amazth-Kultes
Nach dem Untergang der Nagah-Hochkultur wurde das Schicksal der Sanskitaren erneut durch das aventurische Mutterland bestimmt. Es war die Zeit Sheranbil V. al’Shahrs, des letzten Diamantenen Sultans der dritten Dynastie. Dieser zeigte sich während seiner Herrschaftszeit außerordentlich interessiert an altechsischen Geheimnissen. Um 480 v. BF brachte ihn das Studium der Reiseberichte tulamidischer Expeditionen ins Riesland auf die Spur eines geheimnisvollen Artefaktes, das Sarkophagus der Ewigkeit genannt wurde. Es erschien dort als immer wiederkehrendes Motiv der Legenden eines echsischen Volkes namens Nagah. Anscheinend war es zur Pyrdacorzeit in den Besitz aventurischer Achaz gelangt, ob durch Handelskontakte oder Raub ließ sich heute nicht mehr sagen. Sheranbil lokalisierte das sargartige Artefakt schließlich in einem echsischen Tempel und ließ es stehlen. Zeitgleich entführte er einen Achaz-Zauberer, der ihn unfreiwillig in die Geheimnisse des ehemaligen Nagah-Besitzes einweihte. Sheranbil erfuhr, dass es sich bei dem Sarkophagus der Ewigkeit um einen Kessel der Urkräfte handelte. Er verfügte über die Macht, geraubte Lebenskraft aufzunehmen und Menschen durch sie zu verwandeln, sie zu heilen oder sogar gänzlich neue Lebewesen zu erschaffen, ganz nach den Wünschen desjenigen, der die Geheimnisse des Sarkophagus kannte. Sheranbil musste einmal im Jahr nach einem bestimmten Ritual in ihm baden, damit der Sarkophagus seine Wirkung entfaltete. Von nun an alterte der Sultan nicht mehr, was ihm eine rigide Herrschaft von nicht weniger als 94 Jahren bescherte. Seinen Untergebenen erklärte er seine Langlebigkeit mit dem Segen der Götter, und die wenigen, die sich mit dieser Erklärung nicht zufriedengaben, brachte er für immer zum Schweigen.
Während seiner Ägide entsandte der Sultan Expeditionen zu den Waldinseln und in die Lande der Wudu, aber auch in den Eisigen Norden und über das Innere Meer nach Rakshazastan. Der Auftrag der Wagemutigen unterlag stets strengster Geheimhaltung, und nur wenige kehrten zurück. Denen, die nach Khunchom zurückfanden, war stets eine glanzvolle Karriere am Hofe des Sultans gewiss.
415 v. BF verschwand der Sultan plötzlich spurlos. Sheranbil, der sich für unsterblich gehalten hatte, hatte seine Nachfolge nicht geregelt und alle Emporkömmlinge beseitigt, bevor sie zu mächtig werden konnten. Von nun an erschütterten heftige interne Machtkämpfe das Sultanat und destabilisierten es fast so sehr wie das benachbarte Bosparanische Reich, das seit 564 v. BF die Dunklen Zeiten erlebte.

Verwendung des Bildes erfolgt mit freundlicher Genehmigung durch Ramona von Brasch
Für rund hundert Jahre wechselten die Diamantenen Sultane in rascher Folge, und nur wenige von ihnen starben eines natürlichen Todes. Das Verschwinden Sheranbils rief seinen Hofmagier, den Kophta Azuri ibn‘Zahalan, auf den Plan. Er wusste als einer der wenigen um das Geheimnis des Artefaktes, hatte aber keine Vorstellung davon, wie er sich seine Kräfte nutzbar machen konnte. In den Wirren der kriegerischen Auseinandersetzungen stahl er den Sarkophagus und nahm Raffid, einen von Sheranbils Söhnen, gefangen. Dieser war ebenfalls ein Kophta und kannte als einziger die Rituale zur Nutzbarmachung des Sarkophages, welche er für seinen Vater durchgeführt hatte. Azuri zwang Raffid, ihm diese Geheimnisse zu offenbaren. So erfuhr er auch, dass der Sarkophag vor Jahrhunderten einem riesländischen Volk schlangenleibiger Wesen namens Nagah gehört hatte.
Azuri forderte von Raffid, die lebensverlängernden Rituale zu seinen Gunsten durchzuführen. Raffid stimmte zum Schein zu, doch anstelle eines Rituals, das Azuris Leben verlängerte, führte er eine Zeremonie durch, die Azuri seine Lebenskraft rauben sollte. Azuri wurde von seinen Soldaten gerettet, noch bevor der Sarkophagus ihn umbringen konnte. Sie streckten Raffid nieder, jedoch war Azuri seiner Lebenskraft beinahe vollständig beraubt und befand sich in einem Zustand, der ihn zu einer Art untoter Existenz verdammte und in dem sein Körper zusehends verweste.
Der Magus erriet, dass der einzige Weg, sich selbst zu retten, darin bestand, bei den Nagah des Rieslands nach Antworten zu suchen. Er nahm eines der wenigen Handelsschiffe, die immer noch zwischen den Kontinenten verkehrten, und setzte mit einigen Getreuen und dem Sarkophag im Schlepptau nach Rakshazar über. In Unlon angekommen, erlernte er zunächst magische Praktiken der Einbalsamierung, mit denen er sein Schicksal um einige Jahre hinauszögern konnte. Außerdem brachten ihm die Nagah die Kunst der magischen Tarnung bei, um seinen bereits teilweise verfallenen Körper gesund erscheinen zu lassen.
In Rakshazar schloss sich Azuri um 400 v. BF dem Amazth-Kult in Yal-Mordai an. Noch im selben Jahr überreichte ihm Uridabash, ein Dämon aus Amazeroths Gefolge, auf Geheiß des Meisters der Illusionen und der Täuschungen den Stein der tiefsten Nacht, Mercladors Karfunkel. Der Onyx strotzte vor frischer Kraft, der Pakt war gerade erst durch Balphemor von Punin erneuert worden. Da dieser sich jedoch als Störfaktor in Amazeroths Plänen erwiesen hatte, hatte der Erzdämon ihm den Stein unmittelbar nach dem Paktschluss wieder abgejagt. Mit Azuri hatte der Stein der tiefsten Nacht nun einen Träger mit ohnehin großer magischer Macht, der durch den Besitz des Artefakts noch einmal deutlich an Kraft gewann und dessen Wirken die Macht der Domäne Iribaar beständig mehrte. So wurde er im Laufe weniger Jahre zur führenden Persönlichkeit und hatte großen Einfluss auf die Politik der Sanskitaren. Durch den Einsatz von Gift gelang es ihm, den aktuellen Herrscher der Sanskitaren, Ratsmeister Charigh, zu töten und die Schuld auf eine vermeintlich allgegenwärtige Verschwörung der Nagah zu schieben. Er fingierte sogar eine Reihe von Schriftrollen, die er als „Aufzeichnungen der Schlangenpriester“ vorlegte. Sie präsentierten einen fiktiven Plan der Nagah, die Sanskitaren heimlich in Menschengestalt zu unterwandern, nachdem ihr eigenes Reich in Bürgerkriegen untergegangen war. Tatsächlich gab es einzelne Nagah, die unerkannt, aber friedfertig in Menschengestalt unter den Sanskitaren lebten. Als sie durch die Amazth-Priester enttarnt wurden, ließ dies die fiktive Verschwörung nur noch glaubhafter erscheinen.
Um die eingebildete Bedrohung durch die Nagah zu bekämpfen, verlieh man den Amazth-Priestern große Macht, die sie in die Lage versetzen sollte, die magische Tarnung der schlangenleibigen Wesen zu durchschauen. Außerdem wurde der Offizier Mukal von den Amazth-Priestern zum Heermeister gewählt. Aus dieser Position heraus sollte er als Kopf einer starken Armee die verschiedenen Städte und Clans der Sanskitaren vereinen, um das Volk für den Krieg zu rüsten. De facto konnte er als Alleinherrscher regieren. Als erster seiner Familie, der den Rang des Heermeisters innehatte, begründete Mukal eine neue Herrscherdynastie, die als kriegerische „Bronzene Dynastie“ bekannt wurde. Das bisherige Amt des Ratsmeisters wurde nach dem Tod von Charigh nicht neu besetzt. Damit war innerhalb von wenigen Jahren die relativ friedfertige Gesellschaft der Silbernen Dynastie in eine Militärherrschaft verwandelt worden. Puppenspieler im Hintergrund waren nicht etwa die Nagah, sondern Azuri ibn‘Zahalan, der den Echsen das Wissen um das Ewige Leben entreißen wollte und wie die Magier Ash’Grabaals daran ging, die Geheimnisse der Theurgie zu erforschen, der Beschwörung der Götter und ihrer Alveraniare.
Der Krieg der Sanskitaren gegen die Nagah
Mukal, der oberste Heerführer der Sanskitaren, konnte sich der Treue aller sanskitarischen Städte versichern, um gemeinsam mit ihnen den vermeintlichen Einfluss der Nagah zurückzudrängen. Allein der Stadtstaat Ribukan schlug sich auf die Seite der Nagah, da traditionell kulturelle Nähe und Toleranz zwischen beiden Völkern herrschte, und wurde dafür noch Jahrhunderte später von den Bewohnern der anderen Sanskitaren-Städte als „Eiterbeule des Verrats“ verunglimpft. Dennoch gab es auch dort eine Minderheit, die Mukals und Azuris Lügen Glauben schenkte und lauthals die Ermordung des derzeitigen Stadtfürsten Samin forderte. Spitzel Mukals trieben in der Stadt ihr Unwesen, stachelten den Zwist weiter an und verübten Anschläge auf den Fürsten. Im beginnenden Bürgerkrieg bat Samin ca. 390 v. BF den Drachen Ishtazar um Hilfe. Dieser bot der Fürstenfamilie in seiner Domäne, einem entlegenen Bergmassiv im Nagatwall, Unterschlupf, was aber als erneuter Beweis der Nähe Samins zu den Echsenvölkern aufgefasst wurde.
Aufgrund der großen Entfernungen dauerten die Kampfhandlungen über Jahre hinweg an. Zunächst bauten die Sanskitaren eine starke Präsenz nördlich des Flusses Ribun auf und eroberten die dortigen bäuerlich geprägten Siedlungsgebiete der Nagah. Erst nach zehn Jahren überquerten die Invasoren den Fluss, um die Stadt selbst einzunehmen. An den Ufern des Ribun kam es zur Entscheidungsschlacht. Der Drache Ishtazar kämpfte Seite an Seite mit Nagah-Kriegern, Ribukanern und den auf der ribukanischen Halbinsel lebenden Uthurim, die sich nun Ipexco nannten. Die Überschreitung des Flusses konnte verhindert werden, die Truppen Mukals wurden nach Norden zurückgedrängt. Doch für eine vollständige Vertreibung der Siedler von der Halbinsel hatte die Allianz nicht mehr die nötige Kampfkraft. Weitere Jahre gingen ins Land, Mukal war inzwischen an einem Fieber verstorben, und beide Seiten belauerten sich. Der Fluss Ribun bildete die Grenzlinie zwischen beiden Parteien. In der Stadt Ribukan selbst hatten inzwischen die Freunde der Nagah die Vormacht zurückerlangt, sodass der Frieden wiederhergestellt werden konnte.
Azuri ibn‘Zahalan, der Drahtzieher des Konfliktes, wusste, dass seine Zeit sich dem Ende zuneigte. Sein verwesender Körper hatte durch magische Mittel viele Jahre überstanden, doch befand er sich in einem Zustand des Siechtums, der ihn seit langem schon ans Bett fesselte. Deshalb fasste er den Entschluss, einen Pakt mit dem Erzdämon Amazeroth zu schließen, der unter der Maske des Gottes Amazth bei den Sanskitaren großes Ansehen genoss und bis heute genießt. Zu diesem Zweck wandte er sich an den inneren Zirkel der seit langem etablierten Priesterschaft von Yal-Mordai. Durch diesen Bund gelang es ihm, noch einmal genug Kraft zu schöpfen, um sich von seinem Krankenbett zu erheben und einen letzten Versuch zu unternehmen, das Geheimnis der Unsterblichkeit zu erlangen. Amazeroth wies ihm den Weg und überließ ihm ein Artefakt als Paktgeschenk, das Spiegelzepter. Unerkannt von feindlichen Truppen und nur begleitet von wenigen Magiern machte Azuri sich Anno 375 v. BF auf die Reise. Er wusste nun, dass es der Drache Ishtazar war, der allein die Rituale zur Nutzung des Sarkophages der Ewigkeit kannte und so dessen Geheimnisse hütete. Der Drache bewahrte eine Niederschrift der Zeremonien auf Steintafeln in seinem Hort auf. Es kam zu einem spektakulären Duell zwischen Drache und Mensch, in dessen Verlauf Azuri den Stein der tiefsten Nacht und das Spiegelzepter einsetzte und so die magischen Artefakte des Hortes gegen Ishtazar zum Einsatz brachte. Der Drache sah sich der Kritischen Essenz ausgeliefert und starb. Seine Todesschreie suchten die Nagah in ihren Träumen heim, und bis heute wird seines Todes in vielen traurigen Liedern gedacht.
In der Verwirrung, die auf den Tod Ishtazars folgte, wurden die Nagah mit Hilfe der magischen Besitztümer des Drachen tief in den Dschungel zurückgedrängt. Die Ipexco erkannten, dass sie eine Entscheidung treffen mussten, und schlossen sich den siegreichen Sanskitaren an. Nur Ribukan leistete lange Zeit Widerstand. Als es Jahrzehnte später immer noch nicht gefallen war, beschaffte Azuri sich das Erbgut des Drachen Ishtazar, den er getötet hatte, beeinflusste es mit Hilfe des Sarkophagus und schuf auf diese Weise schreckliche Wesen, die Düsterwürmer. Er beseelte sie mit Hilfe von Lebenskraft, welche das Artefakt den fruchtbaren Dschungeln des Landes raubte, die dadurch zum Teil verdorrten. Bei den Düsterwürmern handelt es sich um eine intelligente, magiebegabte, blinde rakshazarische Drachenart, die in den Tiefen Deres haust und alles Licht in sich aufnimmt. Azuris Schöpfung verselbstständigte sich rasch und breitete sich über die Höhlen und Kavernen Rakshazars aus, vor allem in Ribukan, im Ödland(t), der Geistersteppe und dem Yal-Hameth. Im Westen des Kontinents sind sie heute auch unter dem Namen Wühldrache bekannt.
Sultan Mustafa und der Rieslandhandel
Mustafa ibn Abu Nuwas von Al’Gunya, auch Mustafa von Gorien genannt, eroberte in der Zeit zwischen 308 und 304 v. BF Khunchom und wurde dort zum Begründer der vierten Dynastie der Diamantenen Sultane. Er herrschte bis zu seinem Tod 270 v. BF. In der Diamantenen Chronik, in der die Historie des Diamantenen Sultanats niedergelegt ist, finden sich folgende Einträge:
»Dies ist die ewige Chronik des glorreichen Diamantenen Sultanats, Brahashabel zu Ehren, AI’Mahmouds Willen vollstreckend, Heshinja gütig stimmend ( … ) A’Dawatus Kindern zum Gedenken. Dies ist das Kapitel des Mustafa ibn Abu Nuwas von Al’Gunya, Diamantener Sultan von Khunchom, Sultan Ali’habads, Heerführer der Skorpionenarmee und der Kataphrakten, Günstling Raslavtans und Ras’ar’Raghs, Feind der Echsen, Nachfahre Sulman al’Nassoris (…). Dies sind die Zeichen des Assaf Bel-Yogoths, und dies waren die Worte des Mustafa: Seit alters her bilden die Gaben Rakshazastans einen Teil des Diamantenen Schatzes, und wer das Innere und Äußere Meer zu bezwingen weiß, soll mit dem Ruhm unserer Ahnen überschüttet werden.«
— Eintrag aus der Rolle Mustafa der Diamantenen Chronik, 304 v. BF, verschollen (Zitiert nach “Im Bann des Diamanten”, S. 42, 48.)
Brahashabel ist eine Gottheit, die von den Sumurrern als Gott des Rechts angebetet wurde. Sie beinhaltet möglicherweise Aspekte von Kha und Ucuri.
Bei Al’Mahmoud handelt es sich um eine thalusische Gottheit, die über die Zeit gebietet und mit Satinav identisch ist.
Heshinja ist der tulamidische Name der Göttin Hesinde. Ras’ar’Ragh meint Brazoragh, Raslavtan Levthan.
A’Dawatus’ Kinder sind die Tulamiden, die den Riesen Adawadt als ihren Beschützer verehren.
Bei Assaf Bel-Yogoth, auch Assaf ibn Kasim, handelt es sich um einen Urtulamiden, der 3075 v. BF den Angroschim Calaman Sohn des Curthag begleitete, als dieser in Pyrdacors Hort eindrang. Die Kirche des Phex verehrt ihn als einen Heiligen, die Urtulamiden erhoben ihn gar in ihr Pantheon, in dem sie nicht sauber zwischen Göttern, Dämonen und sonstigen Entitäten unterschieden, so wie es bei den Sanskitaren und den meisten anderen riesländischen Völkern heute noch der Fall ist.
»Dies sind die Zeichen des Assaf Bel-Yogoths, und dies waren die Worte des Mustafa: Der Handel, Feqzens Weg zu Reichtum, soll der Morgenröte gleich wieder erblühen, auch wenn es nichts gibt, was sich nicht in unserem Reich finden lässt. Sklaven, Kräuter, Holz, Gewürze, Juwelen, Seide und Jade aus dem Süden; Sklaven, Gold, Silber, Bronze, Marmor und Salz aus dem Westen; Sklaven, Mammuton, Felle, Fleisch und Getreide aus dem Norden; Sklaven, Reis, Fisch, Tuch und Früchte aus dem Osten.«
— Eintrag aus der Rolle Mustafa der Diamantenen Chronik, 304 v. BF (Zitiert nach “Im Bann des Diamanten”, S. 43.)
Khunchoms Diamantene Stadt, der Palast der Diamantenen Sultane, eine Stadt in der Stadt, hatte während der Herrschaftszeit Sheranbils V. al’Shahr u. a. Ziergärten und Menagerien mit den seltensten Pflanzen und Tieren Rakshazastans bereitgehalten, und auch die Gärten anderer Machthaber wurden durch solch exotische Lebewesen geziert. In der Hohen Pforte, dem Torhaus der Palaststadt, empfing man hochrangige Gesandte aus aller Herren Länder, darunter auch solche aus Rakshazastan.
Nach Sheranbils Verschwinden, an dem womöglich der Emir von Elem und seine echsischen Verbündeten nicht ganz unschuldig waren, ereignete sich zwischen 415 und 304 v. BF ein Interregnum, dessen Machtkämpfte die Bewohner Khunchoms scharenweise aus der Stadt trieben. Die Palastanlagen standen weitestgehend leer, Güter aus dem Riesland wurden dort nicht mehr benötigt. Botanik und Zoologie des Diamantenen Sultanats befanden sich im Verfall. Immer seltener wurden die exotischen Gärten des Diamantenen Sultans und anderer Machthaber mit fremdartigen, wunderschönen Pflanzen und Tieren vom fernen Südkontinent Uthuria oder dem östlichen Rakshazastan. Stattdessen entstanden dank der angesehenen Chimärologie immer aberwitzigere Kreaturen und Pflanzen, von denen diejenigen aus den Chimärengärten der Großsultane von Elem ihresgleichen suchten.
Die Sultane der IV. Dynastie, Mustafa ibn Abu Nuwas (304 – 270 v. BF) und Nahema saba Mustafa (270 – 255 v. BF), weilten ebenfalls nur selten in Khunchom, sodass es zu keiner Renaissance des schwindenden Rieslandhandels kam.
255 v. BF kehrten unbemerkt Echsenwesen von Marustan in die Sümpfe des Deltas und die Ruinen von Yash’Hualay zurück. Sechs ihrer Kristallomanten entfesselten die Urgewalten des Mhanadi, um die Menschenstadt mit Hilfe einer Flutwelle hinwegzufegen. Zwar konnten die Echsen von verdienten Helden aufgehalten werden, doch das Palastviertel wurde trotzdem von einer Flutwelle überrollt. Die Wasser des Flusses blieben tagelang von Leichen bedeckt, Seuchen und Hungersnöte brachen aus. Schließlich musste festgestellt werden, dass auch die Diamantene Sultana Nahema mitsamt ihrer Kinder der Flut zum Opfer gefallen war. Ganze Teile Khunchoms versanken in Wasser und Schlamm.
Innerhalb weniger Tage wurde ein neuer Sultan erhoben: Yadail, der Hohepriester Atvaryas (Satuarias), der als Yadail al’Musaf „der Verkünder“ den Thron bestieg. Er predigte voller Inbrunst die Abkehr von den Verfehlungen der letzten 170 Jahre und die Rückkehr zu den alten Riten der Diamantenen Sultane. Die Flut sei eine göttliche Strafe gewesen, weil die Khunchomer sich von ihrer Tradition abgewandt hätten. Seine Regierungszeit währte bis 212 v. BF, verlief friedlich und führte Khunchom nach und nach zu neuer Blüte. Auch der Palast, der zunächst von Krokodilen, Schlangen und anderen gefährlichen Flusskreaturen befreit werden musste, wurde wiederaufgebaut, ohne jedoch seine alte Pracht wiederzuerlangen. Der Handel mit Rakshazar erstarb unter Yedails Ägide dennoch weiter. Die Rückkehr der Echsen hatte die Khunchomer an Bastrabuns Gebot erinnert, sich vom Meer und insbesondere von den Bewohner Marustans fernzuhalten. Außerdem herrschte in der zerstörten Stadt dringenderer Bedarf als der an Luxusgütern vom fernen Ostkontinent. Unlon, bisher notwendiger Anlaufpunkt des Handels zwischen Aventurien und dem Riesland, wurde dadurch sich selbst überlassen, was die Lage dort rasch zum Kippen brachte. Als 106 v. BF der Stern von Elem den größten Teil der tulamidischen Flotte vernichtete, kam der Rieslandhandel vollends zum Erliegen.
Das sukzessive Erlahmen des Rieslandhandels zog auch das Aus für das wohl berühmteste Unterhaltungetablissement Khunchoms nach sich, den Palast des Rakshaztani. Im Viertel der wohlhabenden und reichen Bürger gelegen, nahe des Tempelbezirks und des Diamantenen Palasts, bot es Besuchern einen Eindruck, wie es sich als Sultan lebt. Fremdartige Vögel und Tiere in goldenen Käfigen präsentierten die Artenvielfalt des Rieslands. Aufreizende junge Frauen und Männer, manch einer von ihnen riesländischer Herkunft, erfüllten den Gästen jeden Wunsch: Exotische Speisen und Getränke aus Rkashazastan, Gesang und Unterhaltung beim Spiel um die Roten und Weißen Kamele oder Kräfte und Sinne raubendes Liebesspiel, welches sie von der Jamila al’Jamil erlernt haben sollen, der Schönsten der Schönen, einer echten Liebesdienerin des fernen Kontinents. Inhaber des Rakshaztani war über Generationen die Sippe der Mahmudim, deren Ahnherr Mahmud ibn Rakshaztan mehrmals erfolgreich zum Ostkontinent gefahren und dafür vom Diamantenen Sultan mit exklusiven Handelsrechten belohnt worden war. Die immer seltener werdenden Fahrten zum Ostkontinent brachten das Geschäftsmodell schließlich in arge Bedrängnis. Verendete Tiere konnten nicht ersetzt werden, Gewächse verkümmerten und gingen ein, aventurische Speisen und Getränke wurden phantasievoll „rakshaztanisiert“. Als die Flut von 255 v. BF den Palast des Rakshaztani weitestgehend zerstörte und mit Nachschub aus dem Riesland nicht mehr zu rechnen war, beschloss die Familie, das Etablissement zu schließen.
Die Fahrt der “Schwarzen Rose”
»Wir hatten schon nicht mehr damit gerechnet, dass die Schwarze Rose von ihrer Fahrt zurückkehren würde. Vor mehr als drei Jahren war die stolze Zedrakke gen Rakshazastan in See gestochen. Die Kolonien rund um Ribukan hatten sich gut entwickelt, wenn man vom aufrührerischen Shahana absieht, so dass sich eine Überfahrt trotz aller Gefahren lohnte. Die Siedler drangen immer tiefer in das Land vor und sicherten sich die begehrten Rohstoffe und Handelsgüter (…) Bei ihrer Rückkehr war die Schwarze Rose mit Schattensteinen, Vizrangyi und Sulphur beladen. Schwarze Vulkanschrate und unterirdische Düsterwürmer hatten die Siedlung Ribukan bedroht, das war der Grund der verzögerten Rückfahrt. Das Bordbuch und die angefertigten Karten ließen wir sogleich in die Kartensammlung bringen. (…)«
— Assaf ibn Abdullah, Hafenmeister zu Khunchom, um 300 v. BF (Zitiert aus “Im Bann des Diamanten”, S. 68.)
Die bevorstehenden Entwicklungen fanden in der Reise der Zedrakke „Schwarze Rose“ einen bezeichnenden Auftakt.
303 v. BF stach die khunchomische Zedrakke „Schwarze Rose“ in Richtung Rakshazastan in See. Der Höhepunkt des Rieslandhandels lag da bereits weit in der Vergangenheit. Die Kolonien jedoch prosperierten, sodass eine Überfahrt trotz aller damit verbundenen Gefahren lohnenswert erschien. Einzig mit Shahana hatte man Probleme. Viele Bewohner der Stadt waren aranischer Abstammung. Ihre Vorfahren, Einwohner El’Burums, genannt „die Burumer“, hatten gegen den Diamantenen Sultan revoltiert und waren schließlich zur Flucht ins Riesland gezwungen worden. Gegen eine Herrschaft durch die Kunkomer und ihren Diamantenen Sultan setzten sie sich mit allem zur Wehr, was sie aufbieten konnten, und so befand sich Shahana seit einiger Zeit in Aufruhr gegenüber dem tulamidischen Mutterland. Von den militärischen Auseinandersetzungen zwischen den anderen Städten und Ribukan hatte man in der aventurischen Heimat indes keinerlei Notiz genommen, und es interessierte dort auch niemanden besonders, solange die Kolonien ihren Abgabenverpflichtungen nachkamen. Und das taten sie. Die Siedler drangen immer tiefer in das Land ein und sicherten sich begehrte Rohstoffe und Handelsgüter.
302 v. BF erreichte das Schiff Ribukan und fand es von Schwarzen Vulkanschraten und Düsterwürmern bedroht. Dies erschwerte der Besatzung ihre Arbeit, weshalb die Zedrakke mit einiger Verspätung nach Aventurien zurückkehrte, beladen mit Schattensteinen, Sulphur und dem astralaffinen, wasserfesten, schwarzen Holz des Vizrangyi ...
„… sowie drei Skeletten der Schlangenwesen, die die Ribukaner Nagah nennen, für den Sultan von Elem.“
— Auszug aus der Ladeliste der „Schwarzen Rose“, Dunkle Zeiten, wird derzeit von einer Maus in Khunchom als Nistmaterial verwendet.
„Ein besonderes Schmuckstück der nekromantischen Sammlung des Sultans von Elem ist ein Exemplar, das aus Rakshazastan stammt. Auch wenn im Land der ersten Sonne wohl niemand je eine leibhaftige Nagha geschaut hat, so kann man am Hofe des Sultans ein Wesen über den Stein kriechen sehen, das einst zu Lebzeiten eine solche Nagha war. Die kräftigen und markigen Wirbel einer großen Schlange winden sich frei im Palast über den Boden. Am Ende des Schlangenleibs ist jedoch kein Schädel eines solchen Tieres, sondern der eines Menschen, genau wie man es von den Nagha des Rieslandes erwartet. Das Geräusch, das die Geisternagha durch ihre schlängelnde Bewegung mit dem Knochenleib auf dem Stein des Bodens macht, ist im ganzen Palast wohlbekannt und kündigt sie schon von weitem an. Jeder, der es hört, tut gut daran, dem Wesen schnell den Weg freizumachen, denn sie ist des Sultans Liebling. Wer sie blockiert oder gar – auch ohne Absicht – beschädigt, dem droht ein Schicksal, das schlimmer kaum sein könnte, denn er wird an dieses Biest verfüttert. Zwar kann das tote Ding nichts mehr verspeisen, jedoch blick es das Opfer aus seinen hohlen Augen an, auf dass es sich nicht mehr bewegt. Dann umwickelt es das Opfer auf Befehl des Sultans und zu dessen Belustigung mit dem Knochenleib so fest, dass die Wirbel ins Fleisch schneiden und es kein Entkommen mehr für den Armen gibt. Zuletzt nagen die scharfen Zähne des menschlichen Schädels das Fleisch vom Gesicht wie ein Artgenosse dem anderen, was unter dem Jubel des Sultans und seiner Vertrauten bald zum Tode führt. Das Opfer aber tut nicht einen Mucks und wehrt sich nicht, denn der Bann der Nagha macht es völlig unbeweglich. Wer das vermeintliche „Glück“ hat, solange zu überleben, bis der Sultan sich anderen Vergnügungen hingibt, und die Nagha vom Opfer zurückruft, wird für sein Lebtag entstellt sein und am Hofe nur mehr die niedersten Pflichten verrichten dürfen.“
— Aus dem Al Lamasshim nishuda Abu Leviatan des Mustrabaal, 300 v. BF (Zitiert aus “Von Toten und Untoten”, S. 22.)
Die untoten Nagahs waren am Hof von Elem als Geister-Nagha bekannt.
Der Konflikt mit Azuri
Den Ausgang des Konflikts mit den Verbündeten Azuris bekamen die Seeleute nicht mit, ebenso wenig wie ihren Hintergrund. Azuris Verbündete verheerten die Stadt und zwangen Ribukan zur Kapitulation.
Azuri hatte seine Pläne verwirklicht. Sein Interesse an der Halbinsel Ribukan schwand. Er legte das Land in die Hände von Mukals Sohn Grashin und wandte sich der Konsolidierung seiner Dominanz über den Amazth-Kult zu. Dies allerdings entsprach nicht den Vorstellungen des Erzdämons. Er sandte Uridabash aus, welcher Azuri den Stein der tiefsten Nacht stahl. Derartig geschwächt, geriet Azuris hochtrabendes Vorhaben ins Stocken und scheiterte schließlich.
Das Ende des Ersten Sanskitarischen Sultanats
Eine Folge von Krisen führte dazu, dass das Sanskitarische Reich, das eine Generation zuvor noch einen Sieg auf der Ribukanischen Halbinsel errungen hatte, um 290 v. BF zerfiel. Mit ihm endete die Bronzene Dynastie.
Die offensichtliche Krise war das Schicksal Grashins, des obersten Heerführers der Sanskitaren. Grashin regierte mit einer Gruppe von sanskitarischen Statthaltern despotisch und unterdrückte das Volk der Ipexco, das seine Freiheit nicht missen wollte. Einer Allianz aus ribukanischen Sanskitaren, die Grashin nie als einen der ihren angesehen hatten, und enttäuschten Ipexco gelang es schon nach wenigen Jahren, den Gewaltherrscher zu stürzen und als Geisel gefangen zu setzen. Als solche lebte er am Hofe der Stadt Ribukan. Zwar wurde Grashin letzten Endes in die Freiheit entlassen, aber erst nach einer demütigenden Tätigkeit als Sklave des Fürsten. Wieder zurück in Yal-Kharibet, war seine Autorität gebrochen. Er galt als Feigling, da er sich nicht nur hatte gefangen nehmen lassen, sondern geflohen war, statt den ehrenhaften Freitod zu wählen.
Außerdem hatte der Strippenzieher Azuri ibn‘Zahalan längst einen Nachfolger für Grashin benannt, einen eher unbedeutenden Adelsspross namens Amul VII. Bewegt durch die Aussicht auf ewiges Leben, die ihm der Magier eröffnet hatte, führte dieser jede von Azuris Anweisungen aus. Bald schlugen sich die meisten der sanskitarischen Siedlungen auf die Seite Amuls, einige wohlhabende jedoch auf die Seite Grashins. Die politische Einheit des Reiches war zerbrochen. Beide Kandidaten fielen letzten Endes Mordanschlägen zum Opfer, was möglicherweise einen langwierigen Bürgerkrieg verhinderte. Dennoch hatte Azuri keine Gelegenheit mehr, einen weiteren Kandidaten zu benennen, denn auch er wurde während dieser Zeit der Unsicherheit ermordet.
Sein Tod hatte dabei nur auf indirekte Weise politische Gründe: Der Zirkel von Amazth-Kultisten, dem Azuri angehörte, wollte sich der Politik und generell allen weltlichen Angelegenheiten entziehen. Die frommen Amazth-Priester strebten stattdessen eine asketische Erleuchtung in höheren Kreisen der Verdammnis an. Azuri hingegen war ein Machtmensch, der den Kult des Amazth lediglich als zweckdienlich empfand und im Grunde nur seine eigene Position und sein eigenes ewiges Leben im Blick hatte. Als die Priester des Amazth Azuri durchschauten, war sein Schicksal besiegelt. Dies geschah anlässlich des Erscheinens mehrerer Erwählter der Götter, die auf der Suche nach dem Wissen über die Theurgie waren, welches Azuri heimlich angehäuft hatte. In einem Ritual verbannten die Kultisten ihren ehemaligen Förderer in den Limbus. Gegenüber den Erwählten der Götter gaben sie sich kooperativ und händigten ihnen zum Schein die Forschungsergebnisse die Theurgie betreffend aus, auf dass die Gesandten der Götter sie vernichten könnten. In Wahrheit brachten sie die bedeutendsten Erkenntnisse in Sicherheit, um sie beizeiten im Sinne ihres sinisteren Herrn zum Einsatz bringen zu können.
Zum Dank wurden sie von Amazth erhoben und zu halbkörperlichen Wesen transformiert, die bis heute im Riesland in unterschiedlichen Kulten und verschworenen Gemeinschaften ein und aus gehen. In ihrer schattenhaften Existenz sind sie Verbündete des heutigen Sultans Al’Hrastor, dessen Name auf das mächtigste der Schattenwesen zurückgeht, den Ratsvorsitzenden Hrastor. Aber sie verfolgen auch unabhängig von seinen Ambitionen die Ziele ihres göttlichen Herrn. In den Sanskitarischen Städten ist die Verschwörungslegende vom alles lenkenden „Rat der Schemenhaften“ auf die Ränkespiele der ehemaligen Priester von Yal-Mordai zurückzuführen. Als Schattenwesen können die Schemenhaften von den Schatteninsignien der Schattenlords kontrolliert werden, etwas, das der Widersacher ein ums andere Mal zu seinem Vorteil zu nutzen verstand.
Trotz der politischen Umwälzungen ging das Ende des Sanskitarischen Reiches unblutig vonstatten. Es wurde kein neuer Heerführer oder oberster Sultan benannt, und die einzelnen Städte begannen eine mehr oder weniger friedliche Koexistenz, in der sich die Stadtfürsten zu Sultanen ausriefen. Niemand jenseits des Gelben Meeres war bereit, die Macht erneut zu erstreiten. Der kriegerischen Stimmung überdrüssig, schlossen die einzelnen Städte einen kühlen, aber stabilen Frieden mit dem aufstrebenden Volk der Ipexco und der rebellischen Stadt Ribukan. Für die Sanskitaren bedeutete dies ein Ende ihrer Vorherrschaft über die Ribukanische Halbinsel, zugleich jedoch brach für sie eine Ära der Ruhe an.
Später sollte es noch zwei weitere Reiche der Sanskitaren geben, sodass das ursprüngliche Zeitalter der Goldenen, Silbernen und Bronzenen Dynastie bei Gelehrten heute Altes Reich genannt wird.
Das Entstehen der Amazäer und der Kult des Amazth
Ama-Sototh, Das-Tor-und-der-Schlüssel,
Er dessen Name nicht genannt werden darf,
Behüter des Verborgenen,
Der Tausendäugige Beobachter,
Himmlischer Rechnungsführer.

Es steht zu vermuten, dass die Entstehung des Rats der Schemenhaften einerseits, der Zerfall des Sultanats, der unerwartete Aufstieg der Ipexco und ihre Herrschaft über die Ribukanische Halbinsel andererseits in den Reihen des ursprünglichen Amazth-Kults von Yal-Mordai das heutige Weltbild der Amazäer hervorriefen.
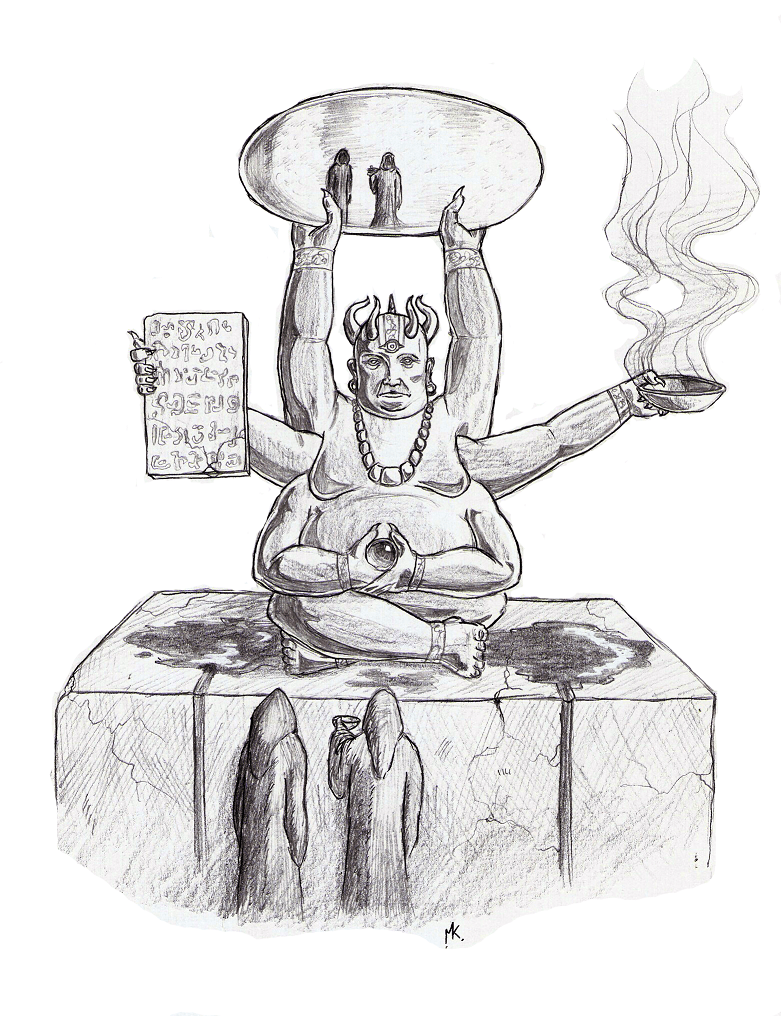
Hinter Amazth verbirgt sich Amazeroth, eventuell auch andere Niederhöllische. Der Erzdämon hatte schon seit vielen Zeitaltern starken Einfluss auf die Geschicke des Rieslands gehabt, doch bis zum Auftreten der Sanskitaren hatte es keinen organisierten Kult gegeben. Vielmehr verließ sich der Herzog der Dunklen Weisheit auf das Wirken einzelner seiner Diener, etwa auf das von Xamoth, Uridabash, Merkator und Merclador.
Doch auch der ursprüngliche Amazth-Kult hatte wenig mit dem heutigen Doppelkult gemein. Er schwankte zwischen der naiven Frömmigkeit jener, die Amazth für einen Gott wie jeden anderen hielten, und der nur auf den eigenen Vorteil bedachten Egomanie eines Azuri ibn‘Zahalan, der den Kult für seine Zwecke zu missbrauchen versuchte.
Die neuen Parameter, welche durch die Ipexco gesetzt wurden, veränderten den Kult des Amazth immer stärker. In vielen der ältesten amazäischen Texte werden die naturverbundenen und diesseitigen Riten der Ipexco voller Hass auf solche oder ähnliche Weise beschrieben:
„Was ist die Natur?“ (sanskitarisch ”Sumul“)
„Eine Ungerechtigkeit, eine Unreinheit, eine Fessel. Das Blut ist nicht das Leben, das Blut ist der Tod der Seele. Die Natur ist eine gierige Riesin, die euch verschlingt und einen jeden in den Tod reißt. Je mehr ihr sie füttert, desto hungriger wird sie, einem Schwein gleich, das umso fetter und gieriger wird, je mehr ihr es mästet. Verschließt eure Augen vor der endlichen Welt, und ihr werdet die Ewigkeit durch die Gnade Amazth sehen. Hungert die Natur aus, um sie abzutöten. Schlagt sie tot, in euch wie außerhalb von euch, um eure Fesseln abzustreifen.“
Das amazäische Weltbild, das in letzter Konsequenz ganz im Sinne der Erzdämonen auf die Vernichtung der Welt abzielt, steht in direkter Opposition zu dem Versuch der Ipexco, durch beständige Blutopfer das Leben der Erdgöttin Sumacoatl zu retten und dadurch die Schöpfung zu erhalten. Die anhaltende Vorherrschaft der Uthurium führte entsprechend zu einer immer weiter zunehmenden Radikalisierung des Amazth-Kultes, der sich in offener Feindschaft gegen die Ipexco erging.
Der Name „Amazäer“ wird zum ersten Mal in Verseos Chronik über Abu-Malak, ”Befreiung Ribukans“, genannt, den die heutigen Amazäer in fragwürdiger Interpretation der tatsächlichen Geschehnisse als Befreier der Sanskitaren von den Ipexco feiern. Dort werden sie als Weise und Hüter von Amazth vollkommenem Wissen gepriesen. Als ihr Oberhaupt wird ein gewisser Gargon genannt, der unter den heutigen Amazäern besondere Verehrung genießt. Der Legende nach war er ein ungeschlechtliches, altersloses Wesen, das keinerlei Begierden kannte und auch keinen körperlichen Bedürfnissen unterlag. Andere Quellen sprechen von ihm schlicht als Abu-Malaks jüngerem Bruder. Dies muss kein Widerspruch sein. Genau wie Hrastor und die anderen Ratsmitglieder kann Gargon zunächst ein Sterblicher gewesen sein, dem zwecks seiner Aufnahme in den Rat der Schemenhaften Schattengestalt verliehen worden ist.
Im Laufe der Jahre entstand ein Doppelkult, der sich als erstaunlich stabil erweisen sollte und als einziger der alten Kulte um 550 BF den Fall des Mittleren Sanskitarenreichs überstand. Amazeroth, der traditionell beinahe so viele Namen und Beinamen trägt wie der Namenlose, wird in den Sanskitarischen Stadtstaaten vor allem „Ama-Sototh, das Tor und der Schlüssel“, „Er-dessen-Name-nicht-genannt-werden-darf“, „Behüter des Verborgenen“, „Der Tausendäugige“, „Beobachter“, „Himmlischer Rechnungsführer“, „Herr der Gelehrsamkeit und des Gesetzes“, „der Allweise des Sternengrundes“ oder „der blinde Prophet mit dem Allsehenden Auge“ genannt. Als die neuen Kulte nach und nach die Macht in der neuen Stadt Yal-Mordai übernahmen, schlossen sich dem Staatskult vor allem Beamte, dem Mysterienkult vor allem Kopthanim an, welche in späteren Jahrhunderten durch Gildenmagier ersetzt wurden. Sach Ard’m in Yal-Mordai ist heute die einzige Magierakademie des Kontinents, nachdem die Akademie der Schatten zu Ribukan 992 BF im Zuge des Sturzes der Magokratie durch Abu-Samin zumachen musste und ihre Angehörigen in den Untergrund gedrängt worden sind. Der Staatskult verehrt Amazth mit den Aspekten Ordnung, Bürokratie, Wissen, Namen, Schrift, Rechenkunst, Sprache, Sterne, Tradition und Herrschaft. Der Mysterienkult schreibt ihm die Aspekte Ordnung, Wissen, Mysterien, Weisheit, Magie, Kristalle, Spiegel, Nichtmaterielles, Wahnsinn, Astrologie, Prophezeiung und Sterne zu.
In der Mythologie der Amazth-Anhänger ist ihr Gott ein ewiges Wesen, das bereits vor dem materiellen Kosmos existierte. Er erschuf aus sich selbst die Zeichen der Schrift – gemeint ist hier eine Wortschrift, in der jedes Zeichen für einen kompletten Begriff steht. Indem er die Zeichen erschuf, entstanden die damit bezeichneten Dinge in seiner Vorstellung. Payishna, der Schöpfer der Welt, rief die anderen Götter zusammen. Sie sollten ihm die besten Schriftzeichen präsentieren, mit denen er die Welt durch sein göttliches Buch Ka’mal erschaffen könne. Alles, was Payishna in dieses Buch schreibt, erlangt Wirklichkeit. Neben Amazth buhlten auch zwei heute unbekannte Götter um Payishnas Gunst. Sie alle wollten dem Schöpfer ihre Zeichen anbieten. Der eine wies darauf hin, seine Zeichen seien besonders einfach und würden rasch zu erlernen sein. Der andere pries seine Zeichen als besonders vielseitig an. Mit ihnen sei man in der Lage, viele Bedeutungen auszudrücken. Amazth indes sagte, seine Zeichen seien nicht einfach, sondern äußerst schwierig. Seine Zeichen seien auch nicht vielseitig, sondern eindeutig. Payishna war unschlüssig, welchen Zeichen er den Vorzug geben sollte, also schrieb er die Namen eines jeden der zeichenschaffenden Gottheiten in den Sprachen seiner Konkurrenten. Doch als er die Namen der beiden mit Amazeroth konkurrierenden Gottheiten in dessen Zeichen niederschrieb und anschließend wieder auswischte, wurden die beiden Götter augenblicklich vernichtet. So erkannte Payishna, dass Amazths Zeichen nicht wie andere Zeichen den Dingen nachfolgen, die sie benennen, sondern ihnen vorausgehen. Seit diesem Tag schreibt der Schöpfer das Buch der Schöpfung Ka’mal mit den Zeichen des Amazth. Deshalb heißen diese Zeichen auch Urbilder, Ideen oder Mutterschoß. Auch für Amazth selbst existiert ein Zeichen, welches Amazth‘ Spiel genannt wird. Der Gott erschuf es, als er über sich selbst reflektierte. Payishna schrieb es nur einmal im Buch Ka’mal nieder, auf dass es Amazth ein persönliches Erscheinen in Ribukan ermöglichen würde. Dies entsprach dem Willen der beiden Götter, die beratschlagt hatten, dass der auf diese Weise materiell gewordene Amazth wenige Auserwählte das Wissen um die Schöpfung lehren sollte. In der Prosa-Erzählung „Herabkunft des Wortes“ erscheint Amazth daraufhin in menschlicher Gestalt in Ribukan, wo er von der Nichtigkeit der materiellen Welt predigt und die Erlösung der Sterblichen in Aussicht stellt, wenn diese alle fleischlichen Bedürfnisse und Gelüste aufgeben. Der Text endet mit dem Versuch des grausamen Sultans von Teruldan, spöttisch Sahim der Sanftmütige genannt, Amazth als Anführer hinzurichten. Der Plan des Herrschers misslingt, obwohl er alle Elemente der sanskitarischen Naturkunde einsetzt, um den Prediger zu töten: Feuer – Verbrennung. Wasser – Ertränken. Luft – Ersticken. Erz – Steinigen. Humus – Vergiften. Erst nachdem Amazth alle Torturen mit Gleichmut über sich hat ergehen lassen, löst er sich auf und verlässt die materielle Welt endgültig.
Bei den Arbeitern, Bauern und Handwerkern ist Amazth vor allem der Gott der Talismane. Mit einem speziellen Zeichen versehene Gegenstände sollen ihren Träger vor Gefahren schützen und ihm Glück bringen. Im Volksglauben hat Amazth selbst den Menschen diese Zeichen überliefert, in Wahrheit unterscheiden sie sich von Stadt zu Stadt und sind offensichtlich Menschenwerk. Eine Verbindung zur Amazth-Priesterschaft besteht nicht.
Die Herrscher und andere Mächtige verehren Amazth nicht, schätzen die Priesterschaft aber als kompetente und gewissenhafte Beamte, welche die Aspekte Ordnung und Bürokratie hochhalten, aber kaum echte Frömmigkeit walten lassen. Amazth fordert bedingungsloses Festhalten am bestehenden Klassensystem. Er fördert diejenigen, die ihre Arbeit am für sie vorgesehenen Platz erledigen und straft solche, die sich anmaßen, ihren Platz verlassen zu wollen, so wie rebellierende Bauern, neureiche Händler und andere. In der Mythologie des Beamtenpriestertums sitzt Amazth zur Rechten des Götterrichters Payishna und dient ihm als Schreiber und Gerichtsdiener.
Die Spenden an die Tempel des Amazth sind ganz überwiegend Bestechungsgelder, welche dem edlen Spender die Gunst der Priester in streitigen Rechtsfragen sichern sollen. Die Priester verehren Amazth als Stifter der Schrift und sehen es als ihre Aufgabe an, das Wissen um dieselbe vor anderen zu verbergen. Sie ersinnen deshalb komplizierte Verschlüsselungen. Das getreuliche Lernen der Zeichen ist für sie der eigentliche Gottesdienst. Gebete oder besondere Rituale sind nicht bekannt, vielleicht mit Ausnahme des Genusses der Amazth-Beere. Diese Frucht sorgt für Visionen, die es ermöglichen, gänzlich neue Zeichen zu erlernen. Die Priester verwenden diese Gabe, die Zeichen von Einzelpersonen zu ergründen – jedes Lebewesen wird durch ein individuelles Zeichen repräsentiert. Diese sind nicht deckungsgleich mit den Wahren Namen eines Geschöpfes. Jedes Geschöpf hat eine Amazth-Glyphe, einen Wahren Namen indes haben nur bestimmte Entitäten wie Dämonen, Geister, Drachen, Elementare Meister, Elementargeister, Feen, Kobolde, Riesen und Elfen. Auch verleihen Amazth-Glyphen nicht ohne Weiteres Macht über andere Geschöpfe. Zwar sind sie identisch mit den Urzeichen des Ka’mal, doch nur wenn sie dort niedergeschrieben werden, entfalten sie besondere Kräfte. Auf profanen Trägern sorgen sie lediglich für eine hinreichend genaue Identifizierbarkeit ihres Trägers. Die Heiligen Zeichen werden für die Aufstellungen von Handelslisten, Anklageschriften, Urteilssprüchen, Steueraufzeichnungen und für andere offizielle Dokumente verwendet. Auch die Verwendung des Zeichens eines Priesters verletzt nicht dessen Würde. Im Gegenteil: Indem sie die ordnungsstiftende Kraft der Schrift verwenden, um gesellschaftliche oder natürliche Zusammenhänge festzuhalten, verdeutlichen sie die ewige Natur der Dinge hinter ihrer scheinbaren Vergänglichkeit. Eine Steuerliste besteht fort, lange nachdem der Steuerpflichtige verstorben ist. Jedes Lebewesen jedoch, das jemals die Welt betreten hat, ist im Buch Ka’mal genannt. Die Erinnerung an jedes einzelne Wesen lebt deshalb fort bis in alle Ewigkeit. An eine andere Form des Weiterlebens nach dem Tod glauben die Priester Amazths indes nicht.
Die Amazäer, sanskitarische Zauberer, berufen sich auf Amazth als Quelle ihrer Magie, sind aber auf der Hut, da ihnen bekannt ist, dass der Gott sowohl Wissen als auch Wahnsinn spendet und beides meist schwer zu unterscheiden ist. Damit erinnert der Mysterienkult sehr viel mehr an aventurische Amazeroth-Paktierer oder Borbaradianer als der Beamtenkult, und auch seine Riten sind finsterer. Ihnen gilt Amazeroth als himmlischer Bibliothekar, der über geheimes Wissen wacht, welches die Schöpfung zusammenhält. Im Glauben der Amazäer kann Amazth jedes nur erdenkliche Wissen vermitteln, das gilt als unstreitig. Die Frage ist vielmehr, wie viel verborgenes und verbotenes Wissen der Mensch erträgt.
Der Glaube der Amazäer unterscheidet sich stark von dem der übrigen Sanskitaren und steht in Yal-Mordai als eigenständige Konfession in direkter Konkurrenz zu diesem. In den übrigen Städten werden diese Unterschiede eher heruntergespielt, um den Frieden zwischen den Amazäern und den anderen Gruppen nicht zu gefährden. Die Fähigkeiten der Amazäer sind vielfältig und umfassen u. a. das Gedankenlesen, die Erschaffung von Illusionen, die Verwandlung, das Herstellen von Drogen und Giften sowie zerstörerische Kampfmagie. Nicht jede dieser Gaben resultiert aus Zaubersprüchen. Oftmals werden verschiedenste Dämonen beschworen, deren wahre Namen den Amazäern seitens ihres Gottes enthüllt werden, um die Beschwörung zu erleichtern, und denen die Amazäer mit einer Mischung aus Vorsicht und Ehrfurcht begegnen. Heilungsmagie ist den Amazäern unbekannt. Sie arbeiten als Schausteller und Künstler, als Berater von Potentater und als gefürchtete Kämpfer. Für die beim Volk beliebten Illusionsunterhalter und Drogenhändler hat sich der pompöse Name „Spektakelmeister“ eingebürgert. Einige wenige Amazäer können es sich leisten, ihre Zeit mit der Erforschung magischer Wesen, ferner Länder und historischer Ereignisse zu verbringen. Solche arkanen Gelehrten sind oft Meister der Analyse und Hellsicht. Alle Amazäer eint ein esoterisches Weltbild, nach dem Dere ein fehlerhafter, armseliger Ort ist, der von inkompetenten und böswilligen Göttern erschaffen wurde – den Göttern der anderen Kulte. Erschaffen oder zumindest geformt – die Zelothim etwa halten Amazth für den Erschaffer der Welt, dem aber keine Macht zukomme, ihre Gestalt zu bestimmen, weil ihm als Verkörperung der Allwissenheit keine schöpferische Komponente innewohne. Um über ihre eigene Unvollkommenheit, Niedertracht und Schlechtigkeit hinwegzutäuschen, so glauben die Amazäer zu wissen, verunglimpfen die Anhänger dieser Geringeren Gottheiten die wahren Götter – Amazth und seine Geschwister – als Dämonen. Aufgrund der Verdorbenheit des Diesseits fristen die Menschen ein unzufriedenes und mitleiderregendes Dasein. Nur wenigen gelingt es, ein gutes Leben zu führen, indem sie von den anderen rauben oder sie betrügen. Amazäer akzeptieren deshalb keine sterbliche Autorität oder Herrschaft. Was jedoch kaum einen von ihnen hindert, Lohn von Wohlhabenden anzunehmen oder sich selbst zu Herrschern aufzuschwingen. Sie solidarisieren sich wortgewaltig mit Sklaven und Entrechteten, dienen sich dann aber wieder jenen an, die sie ernähren können, den Reichen und Mächtigen. Dieser Widerspruch hat viele Amazäer zu Zynikern und Heuchlern werden lassen. Diejenigen, die keine Kompromisse mehr eingehen wollten, sind zu radikalen Sekten wie den Zelothim übergetreten.
Bekannte Orden der Amazäer sind:
1. Der Orden von C’hatul. Die Akoluthen des Ordens bestehen größtenteils aus Scharlatanen und Möchtegernmagiern. Der innere Zirkel jedoch rekrutiert sich aus Verwandlungsmagiern, die nicht nur in der Verzauberung von Formkristallen unerreicht sind, sondern angeblich auch Nichtmagiern in sinisteren altechsischen Ritualen Zauberkraft verleihen können. Der Orden ist somit ein nicht zu unterschätzender Machtfaktor. Wenn er öffentlich auftritt, dann meist mit oberflächlichen Kristallgötzen-Kulten, die magische Macht verheißen. Die Großmeister bleiben stets verhüllt und halten somit ihre Identität geheim. Zu den Schöpfungen des Ordens gehört der Morfu-Schild. Der Orden bediente sich dabei alten echsischen Wissens, das inzwischen verlorengegangen ist. Der Schild war lange Zeit ein wichtiger Ritualgegenstand bei öffentlichen Zeremonien, wurde dann aber von einer Gruppe Abenteurer entwendet. Er wechselte mittlerweile viele Male seinen Besitzer. Sein aktueller Verwahrungsort ist unbekannt. Sollte der Orden des Schildes gewahr werden, wird er viele Hebel in Bewegung setzen, ihn wieder in die Finger zu bekommen. Der Dornenschild hat eine trübe, grünliche Färbung und sondert an seiner Außenseite geringe Mengen eines schleimigen Sekrets ab. Schaut man genauer hin, erkennt man, dass die spitzen Dornen, die aus einer Art drüsenartigen Erhebungen am Rand hervorragen, unregelmäßig pulsieren. Der Morfuschild kann diese Dornen, die hochgiftig sind, auf einen Angreifer abfeuern. Danach braucht es allerdings Wochen, bis sie wieder nachgewachsen sind. (Siehe “Das Buch der Klingen”, S. 171.)
2. Die Gefährten der Freiheit. Ein loser Kult um die Katzengöttin Aphasmir, dessen aufrührerische Redner immer wieder zur Befreiung von Knechtschaft und Moral aufrufen und das einfache Volk auf ihre Seite zu ziehen versuchen, bisweilen auch durch den Einsatz von Magie. In den meisten Stadtstaaten sind die Ordensmitglieder das Ziel von Nachstellungen der Stadtgarden und von Attentaten gedungener Meuchler. Die fehlende Ordenshierarchie und die potente Magie der Ordensmitglieder macht es jedoch schwer, dieser Hydra endgültig all ihre Köpfe abzuschlagen.
3. Zelothim. Ein erst zu Beginn der Zeit der Tyrannen gegründeter, jüngerer, aber extrem fanatischer Kult radikalisierter Beschwörer, die den Kopthtanim ähneln. Während die übrigen Amazäer Amazth lediglich als Quelle verwenden, schließen die Zelothim einen Minderpakt mit Amazeroth, welcher ihnen viele ihrer Fähigkeiten verleiht und denen, die selbst keine Zauberkundigen sind, sogar ihre magische Macht, basierend auf ihrer Lebenskraft, der Macht ihres Blutes. Dieser Vorgang ist mit den Fähigkeiten der aventurischen Borbaradianer zu vergleichen, die ebenfalls von einem Minderpakt mit Amazeroth stammen. Während diese Tatsache den Borbaradianern unbekannt ist, schließen die Zelothim den Minderpakt bewusst und willentlich. Im Laufe ihrer Karriere werden sie dann zu echten Paktieren. Der Orden will schlussendlich die Welt der Sterblichen vernichten, um die dort gefangenen Seelen der Sterblichen zu befreien. Er hat sich dem Kampf gegen alle „gnädigen“ Götter verschrieben, die den Sterblichen das Leben auf Dere angenehmer zu machen vorgeben und dabei nach den Lehren der Zelothim doch nur als hinterhältige Gefängniswärter fungieren. Zerstörung und Leid sind die Werkzeuge dieser nihilistischen Dämonendiener, deren unbestrittener Anführer der unsterbliche Sultan von Yal-Mordai ist, Al’Hrastor, der den Orden der Zelothim vor Jahrhunderten ins Leben gerufen hat. Er gilt als derischer Stellvertreter Amazth, nur deshalb beugen sich die Zelothim, die ansonsten jegliche Autorität ablehnen, seinem Befehl.
Das weltliche Gegenstück zu den Kulten der Amazäer ist der Orden der Hexer von Yal-Mordai. Der öffentliche Staatskult der Beamtenpriester mit Sitz in Yal-Mordai und einem zweiten Zentrum in Shahana suggeriert Ordnung, Gerechtigkeit und Tugend als wichtigste Ideale des menschlichen Zusammenlebens.
Auch wenn sich Azuri ibn’Zalahan dem Kult des Amazth erst Jahrhunderte nach dessen Entstehen anschloss, wird der tulamidische Immigrant in vielen Schriften als erster Diener des Amazth genannt. Diese Geschichtsklitterung ist wohl der Tatsache geschuldet, dass er der erste wirklich bedeutende Anhänger des Gottes war, dessen Taten in vielfacher Hinsicht Aufmerksamkeit auf den Kult gerichtet haben, der es zuvor gewohnt war, eher heimlich zu agieren. Nach und nach stieg die Glaubensgemeinschaft im alten Sanskitarenreich zu großem Ansehen auf. Zeitweilig wurde Amazth sogar als oberster Gottheit verehrt. Seit Alters her bildet die Zitadelle Sach Ard’m in der Stadt Yal-Mordai das Kultzentrum. Im Alten Reich stellte es zugleich die größte Bibliothek des Kontinents. Dank der Dämonenbeschwörung des letzten Sultans der Sanskitaren, Mena’ton, dessen Name unter den Sanskitaren für immer vergessen ist, wurde dieser gewaltige Bestand an Schriften vernichtet. Auch die Erinnerung der Menschen ist durch dämonische Wirkungen verwirrt und zerstört. In der dunklen Zeit nach dem Fall des Sultans wurde Amazth weiterhin verehrt. Die Priester von Sach Ard’m stehen bis heute in hohem Ansehen und sind in allen Städten der Sanskitaren als Rechtskundige, Ärzte und Buchhalter zu finden. Seit über drei Jahrhunderten verbreitet der alterslose Amazäer Al’Hrastor von seiner Hauptstadt Yal-Mordai aus eine radikale Form der Dämonenanbetung mit Amazth als Mittler zwischen dem verdorbenen Diesseits falscher Götter und dem herrlichen Jenseits der Dämonen. Alle Götter, die Vorteile im Diesseits vergeben, sollen als Verführer und Betrüger in Verruf gebracht werden. Die Traditionalisten von Sach Ard’m werden in der Stadt geduldet, aber wegen ihrer Sanftmütigkeit und ihrer Toleranz für andere Götter verachtet. Obwohl die politische Macht von Al’Hrastors Anhängern, den sogenannten Zelothim, nach zunächst bemerkenswerten Eroberungen wieder auf das Stadtgebiet von Yal-Mordai zusammengeschrumpft ist, hat dieser extremistische Glaube doch Spuren in der Kultur der Städte hinterlassen, vor allem bei Armen und Geknechteten, die in dieser Welt ohnehin nicht viel zu erhoffen haben und die den traditionellen, unpolitischen Amazth-Glauben der Schriftgelehrten und Fürsten nicht teilen können.
Als heilig gelten Amazth Narrenglas, Kristalle, die Sternengrube sowie hypnotisierte und hypnotisierende Schlangen. Als Opfergaben akzeptieren beide Kulte Schriftrollen, Wissen, Artefakte, Kristalle und Glasarbeiten. Ein Gräuel sind Amazth bzw. seinen Kulten die Vernichtung von Wissen, Ungebildetheit, dem Staatskult darüber hinaus Unehrlichkeit, Frevel an der Partnergottheit Payishna, dem Mysterienkult die Verbreitung der Kultgeheimnisse und jede Beschäftigung mit weltlichen Dingen. „Wissen ist Macht. Das Wissen um den Wahren Namen liefert den Namensträger aus“, heißt es besonders im Mysterienkult.
Bestimmte Aspekte des Amazerothkultes werden behauptet, konnten aber aufgrund des heimlichen Vorgehens der Kultisten nicht abschließend bestätigt werden. Es heißt, Politiker könnten den Kult um Weissagungen bitten. Auch wird dem Kult unterstellt, im großen Stil Beherrschungsmagie einzusetzen, um Einfluss auf alle Schlüsselpositionen zu erhalten. Schlussendlich sollen sie gar in Yal-Mordai eine geheime Staatspolizei unterhalten, welche alles und jeden kontrolliert, der sich in der Stadt aufhält. Man munkelt außerdem von Mystikern mit großer Macht, die anders als die Amazäer, welche sich des Amazth lediglich als Quelle bedienen, und die Priester, deren Macht aus je einem Minderpakt mit Amazeroth herrührt, vollwertige Paktierer zu sein scheinen. Dies gilt auch für die Zelothim, die in den Sieben Kreisen der Erlösung danach streben, Amazth nahe zu sein.
Die Kult des Amazth ist in allen sanskitarischen Stadtstaaten verbreitet und dort selbst in denen nicht verboten, die Yal-Mordai und seinem Herrscher feindlich gegenüberstehen. Außerhalb des Gebiets der Stadtsanskitaren findet sich der Kult zwar in nahezu allen größeren Städten, da jedoch im Verborgenen, weil er dort meist als sinister und schädlich erkannt und seine Ausübung untersagt wird.
Als Opfergaben akzeptiert Amazth Beschriebenes und Geprägtes wie Schriftstücke oder Münzen, Spiegelndes sowie Brand- und Leuchtopfer. Sein Feindbild sind Unwissenheit, Offensichtlichkeit und (Selbst-)Zufriedenheit. In jedem seiner Kulte gibt es eine stark ausgeprägt Hierarchie, deren politischer Einfluss in den sanskitarischen Stadtstaaten hoch, in den übrigen Städten Rakshazars eher gering ist.
Ein typischer Wahlspruch eines Amazäers lautet: “Das Diesseits ist nichts als eine unperfekte Spiegelung des Jenseits. Das Jenseits aber besteht aus Büchern, Schriftstücken und aus auf Steine geprägten Nummern. Nur Unwissende vertrauen dem, was offensichtlich wahr erscheint. Wissende erkennen, was hinter der Illusion steckt, und hören auf, Spielsteine höherer Mächte zu sein.”
Amazth
Dahinter verbirgt sich: Amazeroth, möglicherweise noch andere Dämonen und Unsterbliche.
Aspekte: Schrift, Namen, Mysterien, Bürokratie, (okkulte) Macht, Sterne, Kristalle und Spiegel, Magie, Nichtmaterielles.
Verbreitungsgebiet: Sanskitarische Stadtstaaten, alle größeren Städte (Untergrund).
Opfergaben: Beschriebenes/ Geprägtes (z. B. Schriftstücke oder Münzen), Spiegelndes, Brand und Leuchtopfer.
Feindbild: Unwissenheit, Offensichtlichkeit, (Selbst-) Zufriedenheit.
Hierarchie: stark ausgeprägt
Politischer Einfluss: Hoch (sanktiarische Stadtstaaten), gering (andere Städte).
Weltbild: Das Diesseits ist nur eine unperfekte Spiegelung des Jenseits. Das Jenseits besteht aus Büchern, Schriftstücken und aus auf Steine geprägten Nummern. Nur Unwissende vertrauen dem, was offensichtlich wahr zu sein scheint. Wissende erkennen, was hinter der Illusion steckt, und hören auf, Spielsteine höherer Mächte zu sein.
Das Mittlere Reich der Sanskitaren und die Kultreform
Mit dem Einschlag des Sterns von Elem 106 v. BF und der damit einhergehenden Tatsache, dass die Treppe von Amhas nicht mehr als Portal zwischen den Kontinenten genutzt werden konnte, strandeten eine Reihe von Elemiten in riesländischen Gefilden. Einige hatten sich ohnehin dort aufgehalten, um das Riesland zu erforschen oder Handel zu treiben, andere hatten die Gefahr des Einschlags rechtzeitig erkannt und waren noch vor den Krakoniern über die Treppe geflohen. Auch in Amhas hatten noch Elemiten gelebt und durch die Zerstörung der Stadt ihre Heimat verloren. Nach und nach fanden sich die Menschen aus Elem in den Sanskitarischen Stadtstaaten ein, die ihrer eigenen Kultur am nächsten kamen. Sie wurden mit offenen Armen empfangen und integrierten sich scheinbar rasch. Tatsächlich bildeten sie über kurz oder lang eine wohlhabende Oberschicht, die eine streng abgeschottete Parallelgesellschaft ausbildete und versuchte, ihren Einfluss zu vermehren, wenn möglich gar die Macht zu übernehmen.
Ihr Wirken ging in aller Heimlichkeit vonstatten, sodass größere Konflikte vermieden werden konnten. Auf diese Weise begann für die Städte der Sanskitaren eine neue Zeit der Stabilität. Sie fanden sich um 100 v. BF zu einem Städtebund zusammen, der zunächst als „Neues Reich“ bezeichnet wurde, heute jedoch von Gelehrten „Mittleres Reich“ genannt wird, weil ihm Jahrhunderte später noch ein drittes gesamtsanskitarisches Staatsgebilde unter Al‘Hrastor folgen sollte. Die lokalen Herrscher, die sich immer häufiger aus den Reihen der Elemiten rekrutierten, trafen sich von nun an einmal im Jahr, um eine gemeinsame Außenpolitik etwa dem Reich der Ipexco oder der noch immer unabhängigen Stadt Ribukan gegenüber festzulegen. Jede Stadt behielt dabei die Oberhoheit über ihre inneren Angelegenheiten. So blieben Yal-Kharibeth und Yal-Amir Republiken, auch wenn in beiden Städten der Einfluss einzelner mächtiger Familien – auch sie oft elemitischer Herkunft – erdrückend geworden war.
Der Bund erwies sich als Erfolgsmodell – schon nach rund zwanzig Jahren begannen die Erbauer des neuen Amhas den Lebensstil ihrer einstigen Gegner nachzuahmen. Die Realisation des Ziels jedoch, das lockere Bündnis der Sanskitarenstädte auf rein politischem Weg und ohne Blutvergießen zu einer starken Allianz zu vereinen, schien nahezu unmöglich.
Umso entscheidender wurde eine gemeinsame Religion der Städte für die Sicherung der inneren Stabilität des Bundes. Die Sanskitaren verehrten schon seit langer Zeit eine unüberschaubare Vielzahl von Göttern. Die elemitischen Herren des Neuen Reiches empfanden dies als Belastung, welche die Städte schwerer regierbar machte, und beschlossen, die Macht der rivalisierenden Kulte einzudämmen. Sie vereinbarten, eine einheitliche Kultstätte zu errichten und verbindende Rituale zu etablieren. Dabei kam ihnen die traditionelle Philosophie der Silbernen Dynastie zur Hilfe, die Zweifel an allzu menschenähnlichen Göttervorstellungen genährt hatte.
Die Herrschenden verkündeten, dass alle alten Gottheiten in nur noch einem einzigen Tempel verehrt werden sollten, da sie alle nur Aspekte eines einzelnen Gottes seien. Eine Kultreform bisher ungekannten Ausmaßes begann. Alle Tempel wurden verpflichtet, ihre jeweiligen Götterbilder in ein neu errichtetes, zitadellenartiges Gebäude zu verbringen, das sogenannte „Haus des Himmels“ oder „Sach Ard’m“ in der Stadt Yal-Mordai.
Im Laufe der Generationen des Neuen Reiches wuchs die Bedeutung dieses Bauwerks stetig. Es wurde nicht länger als einfacher Tempelbau betrachtet, sondern bekam eigene Heiligkeit und Göttlichkeit zugesprochen. In der Anfangsphase war es öffentlich zugänglich, sodass hier politische Beratungen unter dem Schutz der Götter stattfanden, doch schließlich wurde der Zutritt nur noch wenigen auserwählten Hohepriestern gewährt. Die Priester führten ein Leben im Wohlstand, denn sie vermieteten zu bestimmten Festtagen die alten Götterbilder an die traditionellen Tempel und verlangten dafür hohen Mietzins. Auf diese Weise geriet die Politik in Abhängigkeit von der Priesterschaft, denn es war der Beschluss ergangen, dass kein Gesetz und kein Staatsakt mehr ohne die Anwesenheit einer solchen Kultfigur erlassen oder abgehalten werden durfte.
Die Priester hatten außerdem großes magisches Wissen – viele von ihnen waren Zauberer der Tradition der Kophtanim elemitischer Prägung. Die anhaltenden militärischen Erfolge gegen das neue Volk der Amhasim gaben der Kultreform scheinbar Recht, sodass sich der einst lockere Städtebund immer mehr in eine festgefügte Theokratie verwandelte, deren Vertreter sich überwiegend aus den Reihen der elemitischen Oberschicht rekrutierten.
Nur eine Gottheit blieb beinahe unsichtbar, und ihre Existenz galt mehr als Gerücht denn als Realität: Amazth, der verschlagene Gott der Klugheit, welcher im Alten Reich großes Ansehen genossen hatte, war so gut wie in Vergessenheit geraten. Die Amazäer waren in den Untergrund abgetaucht, stellten sich tot und entgingen so den allgegenwärtigen Umwälzungen. Nachdem sich die Lage beruhigt hatte, kamen sie wieder hervor und bildeten einen kleinen, unauffälligen Kult, einen unter vielen. Götter sind geduldig, und Amazth‘ Rückkehr zu der Zeit, als das Mittlere Reich fiel, sollte die Geschichte der Sanskitaren für immer ebenso wuchtig wie nachhaltig verändern.
Der Untergang des Mittleren Sanskitarenreichs
So prägend die Borbarad- und Zulipanära für Aventurien und den Südwesten des Rieslands war, so stark beeinflusste der zeitgleich stattfindende Fall des Mittleren Sanskitarenreiches das südliche bis südöstliche Riesland.
Glaubenstechnischer Ungehorsam
Im Laufe der letzten Generationen hatte sich das Reich der Sanskitaren zu einer zentral organisierten Priesterherrschaft entwickelt. Der Tempel Sach Ard’m in der Stadt Yal-Mordai war zum Mittelpunkt der gesamten Religion geworden, hatte man doch alle anderen Tempel und Kultstätten abgeschafft. Nach wie vor erhoben die Priester hohe Gebühren, wenn die Gläubigen ein Götterbild für ein Ritual mieten wollten. Sie begründeten dies damit, dass „Gott“ bzw. sein jeweiliger Aspekt selbst dem Bildnis innewohne und er allein Rechtsvorgänge bezeugen, Ehen schließen oder Kontrakte siegeln könne. Bald hatten nur noch diejenigen Zugang, die es sich leisten konnten. Dies bedeutete, dass die Politik vollumfänglich von den Reichen bestimmt wurde, schließlich forderte das Gesetz die Anwesenheit eines solchen Abbildes, auf dass „Gott“ den Akt der Gesetzgebung absegnen möge.
Noch immer galt das Dogma, alle Götter seien in Wahrheit nur Aspekte einer einzigen Gottheit. Und wenn es nur einen Gott gab, bedurfte er auch keiner anderen Bezeichnung als „Gott“. Das Volk indes, nach der Invasion durch die Horasier und dem Wegfall des elemitischen Einflusses weitestgehend zu seinen ursprünglichen Traditionen zurückgekehrt, ließ sich nicht davon abhalten, die alten Gottheiten weiter zu verehren, und zwar unter ihren althergebrachten Namen. Zu ihren Ehren wurden Prozessionen und Feierlichkeiten abgehalten, welche die wohlhabenden Familien nach eigenem Gutdünken ausrichteten, schließlich waren sie es, die die Gebühren für die Götterbilder bezahlten. Neben der Politik geriet also auch die Volksreligion in die Hand von Händlern und Großbauern, die sich als Gönner gefielen.
Der Aufstieg des Bürgertums
Der unaufhaltsame Aufstieg des wohlhabenden Bürgertums, begleitet vom Abstieg des gemeinen Volkes, wurde seitens wiederholter Missernten verschärft, welche durch Schädlinge verursacht worden waren. Dies hatte weite Teile der ehemals freien Bauernschaft in die Schuldknechtschaft getrieben. Das Gefälle zwischen den Schichten wurde beständig größer. Viele verarmte Sanskitaren empfanden es zudem als kränkend, dass sie kaum noch besser lebten als die Parnhai, jenes Volk, das bisher in ererbtem Sklavenstand sein Dasein gefristet hatte. Stellenweise übertrafen die Rechte der Parnhai sogar jene der Sanskitaren, auch wenn sie ihnen nicht ohne Eigennutz gewährt wurden. Jede Herrschaft hatte Interesse daran, die Arbeitskraft ihrer Sklaven zu fördern, deshalb waren die Herren verpflichtet, im Krankheitsfall eine angemessene Krankenversorgung sicherzustellen. Es gab weitere solche Schutz- und sogar einige Freiheitsrechte zugunsten der Uthurim-Abkömmlinge. Arme Sanskitaren indes wurden vom Rechtssystem alleingelassen.
Die Konkurrenz zwischen Sanskitaren und Parnhai
Nach und nach sprach es sich unter den Sklavenhaltern herum, dass es für sie mit weniger Verpflichtungen verbunden war, billige sanskitarische Arbeitskräfte, die zuhauf den Markt überschwemmten, in Lohnarbeit zu nehmen, als Sklavenkontingente zu unterhalten. So wurden die Parnhai nach und nach in die Freiheit entlassen. Ihr Sklavendasein hatte sie genau die Fähigkeiten gelehrt, die sie benötigten, um Felder zu bestellen, Handwerk zu betreiben oder einen Haushalt zu bewirtschaften. Sie fanden sich also in der Freiheit rasch zurecht. Außerdem waren sie gut vernetzt. Ihre Sklavenzeit hatte ihnen beigebracht, einander zu beschützen und eng zusammenzuhalten. So bildeten sie kleine, gut florierende Gemeinden oder besetzten Nischen innerhalb der sanskitarischen Gesellschaft, Handwerke oder Dienstleistungen, welche bei den Sanskitaren fehlten oder unterentwickelt waren. Auf diese Weise entstanden neue Wirtschaftszweige, für deren Leistungen die Wohlhabenden gutes Geld bezahlten. Zwar lebten die meisten Parnhai weiterhin in einfachen Verhältnissen, jedoch begüteter und selbstbestimmter als die offiziell höhergestellten Sanskitaren. Einzelne Parnhai stiegen selbst in die Reihen der Wohlhabenden auf. Dies führte zwangsläufig dazu, dass Neid und Missgunst gerade der einfachen sanskitarischen Bevölkerung gegenüber den Uthurimstämmigen beständig wuchs.
Der Verfall der Sultane
Zugleich verloren die Sultane des Reiches mehr und mehr an Macht. Ihre angebliche Herrschaft bestand in der Spätphase des Mittleren Reiches nur noch auf dem Papier. Erbkrankheiten, hervorgerufen durch die schwierigen riesländischen Lebensverhältnisse, rakshazarische Kreaturen oder Inzest, hatten ihr “Erbgut” geschädigt. Die meisten Kinder der herrschenden Dynastie waren mit Stumpfsinn geschlagen oder starben kurz nach der Geburt an Schwachheit des Herzens. Die Erwachsenen waren auf den Genuss raffinierter alchemistischer Tinkturen angewiesen, die ihren Geist oder ihren Kreislauf stärken sollten, zuweilen auch beides.
Der letzte Sultan
Der letzte Sultan des Mittleren Reiches, Mena’ton, war als Kind so krank, dass die Ärzte ihm keine Überlebenschance einräumten. Seine Eltern flehten daraufhin die Priester von Sach Ard’m an, sich ihres Sohnes anzunehmen. Diese sagten ihre Hilfe zu. Ein folgenschwerer Vorgang, welcher die Machtverhältnisse im Reich vollkommen umkrempeln sollte. Mena’ton siedelte in das Heiligtum um und wurde von den Priestern erzogen. Der Segen „Gottes“ erhielt ihn am Leben und bewahrte ihn vor Krankheiten und Siechtum. Er wuchs zu einem gebildeten und körperlich kräftigen Akoluthen heran, mehr Kleriker als Prinz. Doch anders, als seine Eltern glaubten, waren es nicht die unterschiedlichen Aspekte von „Gott“, die sich seiner annahmen und die das Volk noch immer unter ihren alten Namen verehrte. Unbemerkt von Außenstehenden hatte sich die Philosophie Sach Ard’ms gewandelt. Bedingt durch den Glauben an nur einen einzigen Gott war, wie dies in zumindest scheinbar monotheistischen Religionen meist der Fall ist, die einstige Toleranz gegenüber anderen Kulten und abweichenden Überzeugungen innerhalb der eigenen Tradition verschwunden und einem neuen Absolutheitsanspruch gewichen. „Gott“, das war für die Priester jetzt nicht mehr der Synkretismus unterschiedlichster Götter, vielmehr hatten sie sich einem einzelnen Aspekt vermeintlicher Göttlichkeit zugewandt, genannt Amazth. Die Bilder der übrigen Aspekte – und damit nach dem Glauben der Priester die Aspekte selbst – waren in Sach Ard’m zwar noch präsent, doch galten sie nicht länger als als Angehörige eines gemeinsamen Götterhaushalts. Vielmehr betrachteten die Kleriker sie als Gefangene des Amazth und seiner Angehörigen. So wie sich hinter Amazth der Erzdämon Amazeroth verbirgt, sind seine vermeintlichen Kinder Dämonen seiner Domäne. Auch Uridabash, Merkator und Merclador wurden als Angehörige von Amazeroths Göttergeschlecht betrachtet und damit als den gefangenen Götzenbildern übergeordnet. Damit war Sach Ard’m zum zentralen Unheiligtum einer erzdämonischen Wesenheit geworden. Die geheimen Führer der Priesterschaft waren nicht einmal mehr Menschen, sondern der Rat der Schemenhaften unter seinem Anführer Hrastor, jene geheimnisumwitterten Geistwesen, die bereits eine entscheidende Rolle beim Niedergang des Alten Reiches gespielt hatten. An weltlicher Macht waren sei nicht interessiert, jedenfalls noch nicht zu diesem Zeitpunkt. Vielmehr wollten sie mit der Geduld, die den meisten Unsterblichen Wesenheiten innewohnt, den Glauben an alle anderen Götter aushöhlen.
Der junge Sultan Mena’ton entmachtete bald nach seiner Volljährigkeit seine Eltern, ein infamer Vorgang, wie es ihn nie zuvor unter den Sanskitaren gegeben hatte. Als Sultan von eigenen Gnaden untersagte er den privaten Besitz von religiösen Schriften und Artefakten. Einige wurden von den Priestern beschlagnahmt, die meisten sollten vor den Augen des Volkes verbrannt werden. Wie nicht anders zu erwarten wurde diese Anordnung mit Entsetzen zur Kenntnis genommen. Einzig die reichen Familien lehnten sich entspannt zurück. Sie glaubten nicht daran, dass diese bizarre Maßnahme jemals umgesetzt werden würde. Gewiss würde ein beherzter Leibwächter oder Höfling den aus der Art geschlagenen Sultan ermorden, statt seiner Verfügung Taten folgen zu lassen. Allerdings, so dachten sie, werde es gewiss nicht schaden, die Angelegenheit von eigener Hand voranzutreiben. Deshalb schickten sie selbst den ein oder anderen Attentäter auf den Weg. Doch damit unterschätzten sie die Fähigkeiten ihres Gegners auf eklatante Weise. Amazeroth ist der Herr des Verbotenen und des Vergessenen Wissens, der selten die Wahrheit spricht, außer wenn sie ihm von Nutzen war. Den Rat der Schemenhaften versah er mit prophetischen Gaben, welche die gedungenen Mörder mit Leichtigkeit enttarnten. Nicht der einzige Irrtum der Reichen und Mächtigen, welche auch die Stimmung im Volk falsch einschätzten. Verbittert durch die demütigende Lage, in der sie sich befanden, kochte der Volkszorn gegen die bisherigen Machthaber, während der scheinbar so wagemutige neue Sultan zum Hoffnungsbringer und zur Heilsfigur hochstilisiert wurde. Wanderprediger, welche Sach Ard’m in die Städte entsandte, stachelten diese Atmosphäre des Aufruhrs weiter an. Sie nannten sich selbst Amazäer und demonstrierten mit beeindruckenden Illusionszaubern und Verwandlungen Amazth‘ Macht. Die Priesterschaft des Erzdämons predigte ihre eigene Mythologie. Auch nach ihrer Variante gab es nur einen wahren Göttervater, doch dieser sei kein Konglomerat verschiedener Aspekte. Diese Aspekte oder Gottheiten, welche bisher vom Volk verehrt worden waren, seien in Wahrheit Emporkömmlinge, welche versucht hätten, dem ersten und einzig wahren Gott Amazth und seiner Familie die ihnen allein zustehende Macht zu entreißen. Die Reichen hätten von Beginn an davon gewusst und die Kulte der falschen Götter gefördert. Das Wissen um Amazth und seine Kinder indes hätten sie verborgen gehalten. Dafür hätten die falschen Götter sie auf Kosten des Volkes mit Macht und Reichtum belohnt.
Die Revolution
Eine Revolution brach los und nahm ihren Lauf. Stadtverwalter fanden den Tod, Großgrundbesitzer wurden vertrieben, und alles Wissen über die bisherigen Kulte wurde dem Feuer überantwortet, wodurch sich die Anordnung des Sultans erfüllte, ohne dass er sich selbst um ihre Durchsetzung kümmern musste. Doch die Gegner der Aufständischen – Teile des einfachen Volkes und fast alle Begüterten – leisteten erbitterten Widerstand, und so brach ein Bürgerkrieg los. Beide Seiten bemühten sich darum, die Soldaten auf ihre Seite zu bringen, was den Streit rasch entschieden hätte, doch die Truppen waren sich uneins. Einige schlugen sich auf die Seite der Revolutionäre, andere standen loyal zur etablierten Elite, wobei ihre Loyalität teilweise durch großzügige Zahlungen erkauft wurde. Die Machenschaften der Amazäer führten dazu, dass Dämonen in den Straßen umgingen und Jagd auf Anhänger der alten Ordnung machten.
Eine Welle der Angst zog sich durch die Reiche Süd-Rakshazars. Ipexco, Nagah, Parnhai, sie alle verehrten Gottheiten, die mit den Sanskitaren-Göttern eng verwandt waren, ihnen ähnlich oder gar identisch mit ihnen. Und auch bei diesen Völkern war Religion eng mit Macht und Geld verbunden. Würden bald in ihren Städten Aufstände der gleichen Art ausbrechen? Oder würden gar die siegreichen Revolutionäre der Sanskitaren einen Heiligen Krieg gegen ihre Nachbarn entfachen? Deshalb begannen sich die Nachbarvölker in den Konflikt einzumischen und die bisherigen Machthaber zu unterstützen. Es gelang ihnen, einen Belagerungsring um Yal-Mordai zu schließen, obwohl sie dabei von Dämonen heimgesucht wurden und waghalsige Partisanenangriffe der aufständischen Bauern die Einkesselung zu verhindern trachteten. Die Intervention der teils verhassten Fremdvölker untergrub das Ansehen der Reichen und Mächtigen jedoch weiter. Nur noch einer von zehn Sanskitaren unterstützte die bisherigen Herrscher.
Der Versuch der Priesterschaft, das Volk von Yal-Mordai auf ihre und damit Amazth‘ Seite zu ziehen, war damit beinahe verwirklicht. Die äußeren Feinde indes würden sich nicht eher geschlagen geben, bis sie die Stadt erobert und Sach Ard’m entmachtet hatten. Die Priester entschlossen sich deshalb dazu, ein Ritual in Gang zu setzen, wie es nur wenige in Rakshazar gegeben hatte. Amazth selbst sollte seine Macht demonstrieren und die Belagerer mit Wahnsinn heimsuchen. Der Sultan wurde in den Turm gerufen. Er – längst selbst Amazeroth-Paktierer in einem der höheren Kreise der Verdammnis – sollte die Beschwörung der Macht des Erzdämons anführen.
Der Untergang
Durch Zufall fanden einige Vertreter der versprengten Reste der einstigen sanskitarischen Machthaber heraus, was die Priester vorhatten, und warnten ihre fremdspeziegen Verbündeten. Diese zögerten nicht und nahmen die Zitadelle Sach Ard’m mit schweren Steinschleudern unter Beschuss. Der Turm überragte die Stadtmauer wie eine steinerne Herausforderung und hielt dem Bombardement deshalb nicht lange stand. Scheinbar rechtzeitig bevor das Ritual vollendet werden konnte stürzte das Bauwerk in sich zusammen, wobei auch der gewaltige Bestand an Schriften vernichtet wurde, der dort lagerte, das gesammelte Wissen der Sanskitaren.
Das Volk sah seinen Sultan, der in der obersten Etage geweilt hatte, hinabstürzen und seinen Körper auf dem Erdboden zerschellen. Doch durch Amazth‘ Macht begann sich der zerschmetterte Leichnam wieder zu bewegen und schwankte – von niemandem aufgehalten – in die Mitte des feindlichen Heeres. Der Tote begann zu sprechen, und seine Worte waren Verfluchungen, die alle, welche sie vernahmen, in den Wahnsinn trieben. Und das waren nicht nur die Belagerer, sondern auch die leidgeplagten Sanskitaren. Kreischend und irr kichernd verstreuten sie sich in alle Himmelsrichtungen. Einige von ihnen kamen nach Tagen wieder zur Besinnung, dem Tode nah und ohne zu wissen, was in der Zwischenzeit geschehen war. Die meisten jedoch fanden in dieser Zeit der Orientierungs- und Wehrlosigkeit den Tod. Die Priester von Sach Ard‘m nahmen den inzwischen endlich zusammengefallen Leichnam Mena’tons an sich und setzten ihn in der Gruft der Ruine bei, die einst ihre Festung gewesen war. Er geriet rasch in Vergessenheit. Der Irrsinn, den er selbst gesät hatte, hatte seine Existenz und seinen Namen aus dem Gedächtnis der Sterblichen gebrannt. Auch das Wissen über die alten Götter war erloschen, und weil es keine Schriften mehr gab, die von ihrem Wesen kündeten, fanden die Sanskitaren nie wieder zu ihrem alten Glauben zurück. Stattdessen suchten sie sich neue Götter. Sie nahmen Inspirationen anderer Völker auf, lauschten den Phantasien der Dichter oder schufen Synkretismen verschiedener Götter aus Versatzstücken der Lehren fremder Kulte. Bisweilen erhoben sie niedere Wesen in den Götterstand oder erfanden gar Unsterbliche, die es gar nicht gibt. Das Zeitalter der tausend Götter begann.
Der Sieg des Amazth
Der letzte Sultan des Mittleren Reiches war tot. Die Anarchie, die nun herrschte, machte es für lange Zeit unmöglich, einen Nachfolger zu ernennen. Nach einigen Jahren bildete sich eine neue Klasse von Reichen und Mächtigen heraus. Sie rekrutierte sich aus denen, die es verstanden hatten, sich in der Zeit der Unordnung mit Manipulation und Bauernschläue in eine günstige Position zu bringen. Unter ihnen waren zahlreiche Amazäer, die ihrer Gottheit Amazth ein neues Heiligtum errichteten und bald zum beherrschenden Kult aufstiegen. Erneut hatte die Geschichte mit all ihrer Ironie zugeschlagen. Der Kult des Amazth war der einzige, der die Vernichtung der alten Kulte überstand, und genoss weiterhin Hochachtung, obwohl doch eigentlich er es gewesen war, der sich für den Untergang des Reiches verantwortlich gezeigt hatte. Und es waren gerade die Konservativen und Etablierten, welche die Nähe des Kultes gesucht hatten und auch weiterhin suchten, obwohl dieser für den Umsturz stand.
Als das Reich fiel, schrieb man das Jahr 550 BF. Bis zum Sanskitarischen Städtebund, welchen man auch das Neue Reich nennt, sollte es noch Generationen dauern.
Amazth
Der Amazth-Kult hat den Untergang des Mittleren Sanskitarenreiches überstanden und hat im Neuen Reich (auch Rakshazastan oder Diamantenes Sultanat genannt) dank Al’Hrastor sogar noch an Bedeutung gewonnen. Sein Hauptverbreitungsgebiet liegt in den Sanskitarischen Stadtstaaten, besonders in Yal-Mordai.
Die herrschende Lehre seines Kultes, der in Sach Ard’m sein Zentrum findet, stellt Amazth als bleichen, hageren Mann in einem grauen Gewand dar. Sein Kopf weist weder Haare noch Gesichtszüge auf, allerdings findet sich auf ihm das Zhayad-Zeichen für Amazeroth. In der rechten Hand trägt der Gott einen Kalligraphie-Pinsel oder eine Schriftrolle, in der linken einen Abakus. Bilder der Gottheit finden sich oft am Beginn von Schriftstücken, wo sie den ersten Buchstaben des Textes in der Hand hält. Man kennt auch menschengroße Bilder oder Abbildungen des Gottes, niedergelegt auf Textilien wie etwa großen Wandteppichen. Statuen indes sind ungebräuchlich. Die Amazäer und die Zelothim verweigern sich jeder Darstellung ihres Herrn und halten diese sogar für frevelhaft.
Die Zeit der Tyannen (600 BF – 1021 BF)
Die riesländische Zeit der Tyrannen, die für die Aventurier eher eine Zeit der Entdeckungen war, endet recht abrupt im Ingerimmmonat des Jahres 1021 BF, was damit zusammenhängt, dass sie auf das Engste mit Borbarads Masterplan, seiner Rückkehr und seiner Entrückung in den Rausch der Ewigkeit verzahnt ist. Die Angurianer, die Borbarad einst selbst ins Leben gerufen hatte, haben eine entscheidende Rolle dabei gespielt, den riesländischen Teil seiner Pläne zu vereiteln und Rakshazar, wenn nicht ganz Dere vor der vollständigen Vernichtung zu bewahren. Damit ist es ganz maßgeblich ihnen zu verdanken, dass sich das Schicksal der Menschen am Ende des Elften Zeitalters auch im Riesland auf eine positive Weise erfüllt hat und den Menschen, anders als den dominanten Spezies vieler vorhergehender Zeitalter, ein katastrophales Ende erspart geblieben ist.
Die Anfänge dieser Ära indes sind weniger deutlich zu greifen. Im Grunde muss man bereits den Fall des Mittleren Sanskitarenreiches als ersten Schritt in Richtung einer Zeit werten, in der die Tyrannei um sich griff, den Kontinent einmal mehr ins Chaos stürzte und die Völker Rakshazars in Feindschaft gegeneinander trieb. Dies ungeachtet der Tatsache, dass die Zeit der Legenden, welche durch niemanden deutlicher repräsentiert wurde als durch die Theaterritter, von da an noch rund hundert Jahre andauern würde.
Hrastor
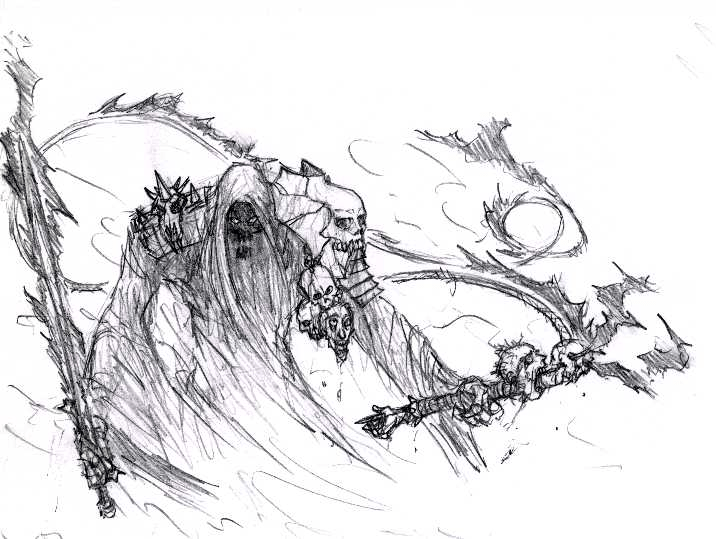
Die herausragende Rolle Hrastors, der beim Fall des Alten, des Mittleren und letztlich auch des Neuen Sanskitarenreiches eine bedeutungsvolle, wenn nicht gar die zentrale Rolle schlechthin gespielt und der damit das Wohl und Wehe der Menschen – obwohl zuletzt an ihm selbst nur noch wenig Menschliches zu erkennen war – in den Sanskitarenlanden entscheidend geprägt hat, ist niemals richtig herausgearbeitet worden. Der maßgebliche Grund besteht darin, dass außer ihm selbst und seinen engsten Vertrauten im Rat der Schemenhaften wohl nur der als sein Sohn geltende Al’Hrastor eine halbwegs umfassende Vorstellung von seinem Wirken hat.
Hrastor ist einst ein tulamidischer Koptha und Zeitgenosse Azuri ibn’Zalahans gewesen, des legendären Hofmagiers Sultan Sheranbils V. Azuri hatte Unsterblichkeit erlangt, den Drachen Ishtazar erschlagen und aus dessen Erbgut die Düsterwürmer geformt. Die Geschichte hatte ihn zu Unrecht zum Gründer des rakshazarischen Amazth-Kultes stilisiert. Er war Träger des Steins der tiefsten Nacht und von Amazeroths Spiegelzepter. Zuletzt hatte er es geschafft, umfangreiches Wissen über die Theurgie zusammenzutragen, die Beschwörung von Alveraniaren oder gar leibhaftigen Göttern. Hrastor begleitete Azuri auf nahezu seinem gesamten Weg, meist als stummer Zeuge, der sich auf strategisches Schweigen verstand.
Azuri hatte Zeit seines Lebens nach Einfluss und weltlicher Macht gestrebt. Der Kult des Amazth war für ihn lediglich Mittel zum Zweck gewesen, um seine diesbezüglichen Ziele zu erreichen. Dafür hatte Hrastor ihn am Ende verraten und ihn zu Fall gebracht, und das Alte Reich der Sanskitaren mit ihm. Für Hrastor verhielt es sich umgekehrt. An oberster Stelle kam der Dienst an seinem göttlichen (erzdämonischen) Herrn. Weltliche Macht war nur von Belang, sofern sie erforderlich war, die Ziele des Gottes für ihn zu verwirklichen. Azuri hatte diese Form der Frömmigkeit und des religiösen Eifers vollkommen gefehlt. Hrastor hatte die Gelegenheit genutzt, diese faulige Pestbeule im sonst so makellosen Haus des Herrn herauszuschneiden.
Dabei hatte er zum Schein das Wissen über die Theurgie, das Azuri erworben hatte, an die Gesandten der alveranischen Götter herausgegeben. In Wahrheit hatte er es heimlich für den Kult und seinen sinisteren Herrn bewahrt, um es bei passender Gelegenheit zum Einsatz bringen zu können. Zur Belohnung hatte der Vielgestaltige Blender ihn und seine Getreuen mit dem Geschenk der Alterslosigkeit versehen und sie in Schattengestalten transformiert, die gemeinsam den sogenannten Rat der Schemenhaften gegründet hatten. Den Verrat an Azuri ließ der Herzog der Dunklen Weisheit unkommentiert. Verrat war nichts, was Amazeroth je getadelt hätte. Er hatte wertvolles Wissen über seine göttlichen Feinde im Austausch gegen einen halbherzigen Diener mit viel zu vielen eigenen Ambitionen erhalten. Alles in allem kein schlechter Tausch.
Hrastor hatte außerdem die magische Schule der Amazäer gegründet und sie während der zurückliegenden Konflikte gezielt eingesetzt, um den Unmut der Bevölkerung zu schüren. Sein Ziel, die alten Kulte zu zerschlagen, auf dass nur der des Amazth übrigbleiben möge, hatte er vollumfänglich erreicht. Der Anführer des Rats der Schemenhaften hatte dabei niemals nach weltlicher Macht gestrebt, weil sie nicht notwendig gewesen war, um die Ziele seines Herrn zu erreichen. Nicht bisher jedenfalls. Der Alveraniar des Verbotenen Wissens hatte Amazeroth herausgefordert, und dieser hatte den Wettstreit angenommen. Borbarad war in den Limbus verbannt worden, doch dieser Zustand würde nicht ewig andauern. Viel Zeit für ihn, einen Masterplan zu ersinnen, doch auch Amazeroth würde vorbereitet sein. Sein Alveraniar würde noch merken, wie überheblich und vor allem unzutreffend seine Annahme war, kein Dämon werde ihn je überlisten.
Nach dem Fall des Mittleren Sanskitarenreiches waren die Sanskitarenstädte ein weiteres Mal zu autonomen Stadtstaaten geworden, die erst nach jahre- oder gar jahrzehntelanger Anarchie wieder zu einer einer stabilen und vom Volk einigermaßen akzeptieren Regierung fanden. Die Anhänger Amazth’ sorgten dafür, dass sie in jedem der Stadtstaaten in exponierte Stellung gelangten, sei es als Angehörige der reichen Führungsschicht, als Priester des Amazth-Kultes – vor allem in Gestalt des Ordens der Hexer von Yal-Mordai, dem öffentlichen Staatskult der Beamtenpriester – oder als Amazäer, welche die zauberkundige Elite stellten. Der Rat der Schemenhaften blieb unsichtbar. Wenige wussten um seine Existenz, manch einer erahnte sie, aber im Großen und Ganzen kam er – wie seit jeher – nie über den Status einer müde belächelten Verschwörungstheorie hinaus. Eine geheime Schattenregierung, welche jeden Schritt der offiziellen Staatsorgane kontrollierte und nötigenfalls lenkend eingriff, wer sollte so etwas glauben. Noch dazu, wenn die Angehörigen dieser Schattenregierung angeblich selber Schattenwesen waren. Tatsächlich war der Rat in allen sanskitarischen Städten präsent, wenngleich das Zentrum seines Wirkens Yal-Mordai blieb, wo auch Hrastor wie eh und je Quartier bezogen hatte.
Die Zitadelle Sach Ard’m blieb das zentrale Unheiligtum Amazths und mutierte zugleich zu einem Ort des ewigen Zankes und Haders, weil hier sämtliche Strömungen der Amazeroth-Verehrung ihren Platz beanspruchten, egal wie verfeindet sie untereinander waren. Die Amazäer, die in der Tradition der Kophthanim des Diamantenen Sultanats stehen und somit seit der Schließung der von Fran-Horas gegründeten Akademie der Schatten zu Ribukan von 992 BF die einzige mit aventurischen Gildenmagiern vergleichbare Schule des Rieslands bilden, betrachten den Turm als ihre Akademie. Auch die später durch Al’Hrastor begründeten Zelothim, eine radikale Sekte innerhalb der Amazäer, hat hier ihren Hauptsitz und bildet ihre Zöglinge aus. Nicht von ungefähr sind die Zelothim mit den aventurischen Borbaradianern zu vergleichen. Anders als die übrigen Amazäer nehmen sie auch Schüler ohne natürliche magische Begabung auf, die ihre Fähigkeiten aus einem mit Amazeroth geschlossenen Minderpakt beziehen und mit der Macht ihres Blutes zaubern, ihrer Lebenskraft. Der zentrale Unterschied besteht darin, dass den Borbaradianern unbekannt ist, woher ihre Zaubermacht rührt, während die Zelothim den Minderpakt wissentlich und willentlich eingehen. Im Laufe ihrer Karriere werden aus ihnen dann echte Paktierer.
Angesichts der Radikalität der Zelothim-Lehre und der Tatsache, dass mit Al’Hrastor seit Jahrhunderten ihr unbestrittener Anführer auf dem Thron sitzt, muss es überraschen, dass sich die weitaus gemäßigteren und weltoffeneren Hexer von Yal-Mordai bis in die Gegenwart hinein in der Zitadelle halten können. Dies hängt gewiss damit zusammen, dass auch sie eine machtvolle Fraktion von Amazth-Anhängern bilden. Sie stellen die Priester der offiziellen Staatskirche, welche aus Minderpakten oder Pakten herrührende „Liturgien“ und „Wunder“ wirken können, die Wesire, welchen die Verwaltung des Reiches obliegt, und deren ausufernden Beamtenapparat. Mit der Kristallgarde unterhalten sie eigenes Militär, das jederzeit zu ihrem Schutz bereitsteht. Wie zu zeigen sein wird, duldet Al´Hrastor die Hexer aber noch aus einem anderen Grund. Obschon er den Orden der Zelothim sowohl begründet hat als auch anführt, ist er nicht vollkommen von ihren Zielen überzeugt, und so kommt es ihm durchaus nicht ungelegen, dass die Hexer einen machtvollen Gegenpol zu ihnen bilden und für ein einigermaßen stabiles politisches Gleichgewicht sorgen. Den Hexern ist es zu verdanken, dass sich ein ausgleichender Status quo mit den übrigen sanskitarischen Kulten herausgebildet hat, während die Zelothim darauf lauern, diese endlich einer radikalen Verfolgung unterziehen und sie ausmerzen zu können. Die Wesire erfüllen dieselbe Funktion auf der weltlichen Ebene, sie sorgen für einen Ausgleich mit säkularen Machthabern, welche die Zelothim gerne eliminieren würden.
Der Rat der Schemenhaften wiederum ist unbemerkt mitten zwischen den anderen Institutionen ansässig. Er verfügt in allen Fraktionen über Sympathisanten, die ihm Bericht erstatten. Die geheimen Räumlichkeiten des Rates liegen in den Kellergewölben tief unterhalb der Zitadelle verborgen. Dort befindet sich auch Hrastors Domizil. Al’Hrastor selbst indes thront im obersten Geschoss, von wo aus er die gesamte Stadt überblicken kann.
Pläne
Irgendwann um das Jahr 600 BF herum begannen Hrastor und sein sinisterer Herr eine Vorstellung davon zu entwickeln, auf welche Pläne und Gedanken der Alveraniar des Verbotenen Wissens während seiner Entrückung in den Limbus wohl kommen möge. Und das darf man sich durchaus wörtlich als freundliche Plauderei zwischen dem schattengestaltigen Ratsführer und dem in seiner Domäne in den Niederhöllen hockenden Erzdämon vorstellen. Seit einigen Jahrhunderten befand sich Hrastor im Besitz des Schwarzen Auges „Tiefenblick“, das einst dem Giganten Kalimir gehört hatte und sich nach dem Marhynianischen Sieg über ihn in den Nebeln der riesländischen Geschichte verlor. Wo Hrastor es fand und auf welchen Wegen er es in seine Hände brachte, ist sein persönliches Geheimnis. Jedenfalls konnte er den Nachweis erbringen, dass das wertvolle Artefakt, welches es ermöglicht, durch die Sphären zu blicken, nicht durch den Kataklysmus zerstört worden war.
Der Erzdämon zeigte sich durchaus enttäuscht darüber, dass sein Alveraniar ihm nach wie vor die Gefolgschaft verweigerte. Und es ärgerte ihn maßlos, dass es seinem Gesandten Merclador in all den Inkarnationen des Dunklen Zwillings nie gelungen war, ihn auf Iribaars Seite zu ziehen. Zuletzt schon allein deshalb nicht, weil er immer halbherziger an diese Aufgabe herangegangen war. Womöglich war es an der Zeit, die Sache in fähigere Hände zu legen. Oder sich die Ambitionen des Alveraniars auf andere Weise nutzbar zu machen.
Amazth und Hrastor unterzogen die Aktivitäten des Alveraniars einer Gesamtbetrachtung. Und allmählich fügte sich alles zu einem großen Ganzen zusammen. Der Alveraniar des Wissens und Marhynas Frevel, sie waren untrennbar miteinander verbunden. Vor der Spaltung des Nandus in Amazeroth und seine „Zwillingsschwester“ Hesinde noch ein Einzelwesen, hatte er sich während Marhynas Ritual ins Zentrum des magischen Flusses begeben und dadurch seine überwältigenden magischen Fähigkeiten erlangt. Auch der ewige Zyklus seiner Wiedergeburten war dadurch in Gang gesetzt worden. Derselbe Konflikt, der Nandus gespalten hatte, hatte auch ihn zerrissen. Wie sollte er es handhaben? Verbotenes Wissen anhäufen um jeden Preis? Auch auf die Gefahr hin, der Schöpfung dadurch Schaden zuzufügen? Oder sich auf Verborgenes Wissen zu beschränken, das zum Wohl der Schöpfung eingesetzt werden konnte? Er hatte nahezu zwanghaft die Nähe von Marhynas Völkern gesucht, um sie zu studieren. Allen voran die Bashuriden mit ihrer herausragenden magischen Begabung. Er hatte alle Spielarten von Magie an den Sterblichen ausprobiert und ihre Reaktion darauf getestet. Er hatte versucht, die Kraftlinien Rakshazars zu reparieren, um den Riesländern wieder ungestörtes Zauberwirken zu ermöglichen. Er hatte die Freiheit studiert, genau jene Freiheit, die Marhyna den Sterblichen durch ihren Frevel hatte bringen wollen. Hesinde, Amazeroths „Zwilling“, jenem Teilaspekt des Nandus, der nunmehr als alveranische Göttin die Wacht über die Magie oblag, fühlte er sich bis in die Gegenwart hinein verbunden. Ebenso wie mit der Frevlerin Marhyna, die dies in gewisser Weise erwiderte und den Alveraniar trotz seines immer wieder grenzwertigen Handelns niemals als Finstermacht eingestuft hatte, die sie als Wächterin der Schöpfung bekämpfen musste.
Von Beginn an war es immer um dieselben Punkte gegangen. Das Wesen der Magie. Die Freiheit der Sterblichen. Und ob sich die Kraft dazu verwenden ließ, diese Freiheit zu verwirklichen. Was immer Borbarad in seinem Exil im Limbus aushecken mochte, genau um diese Frage würde es sich drehen. Er würde versuchen, die letzten Geheimnisse der Magie zu enthüllen, um dann mit ihrer Hilfe den Sterblichen die Freiheit zu bringen. Er würde versuchen, Marhynas Werk und Frevel zum Abschluss zu bringen, was die Göttin aufgrund ihrer Gefangenschaft unvollendet hatte lassen müssen. Eine hervorragende Gelegenheit für den Meister der Illusionen und der Täuschungen, den Alveraniar des Verbotenen Wissens zu übertölpeln und ihn stattdessen für die Verwirklichung von Amazeroths Zielen einzuspannen, wenn er sich ihm schon nicht freiwillig anschloss.
Amazeroth und Hrastor begannen zu ahnen, dass die Frage nach den verheerten magischen Kraftlinien noch einmal eine entscheidende Rolle spielen würde. Der Prächtige wusste um die Bemühungen seines aufmüpfigen Dieners Merclador, das Goldene Netz wiederherzustellen, und hatte ihn gewähren lassen. Gewiss, Merclador strebte unter anderem deshalb nach diesem Wissen, weil er insgeheim hoffte, sich mit seiner Hilfe von Amazeroth lösen zu können. Erkenntnisse darüber, ob sich die Kraftlinien reparieren ließen, waren indes auch für den Erzdämon interessant und womöglich wertvoller als ein nach Unabhängigkeit strebender Lakai. Äußerst bedeutsam war außerdem die genau gegenteilige Frage – nämlich ob sich das Goldene Netz endgültig zerstören ließ und welche Auswirkungen das auf den Kontinent haben würde. Oder auf Dere als Ganzes.
Al‘Hrastor
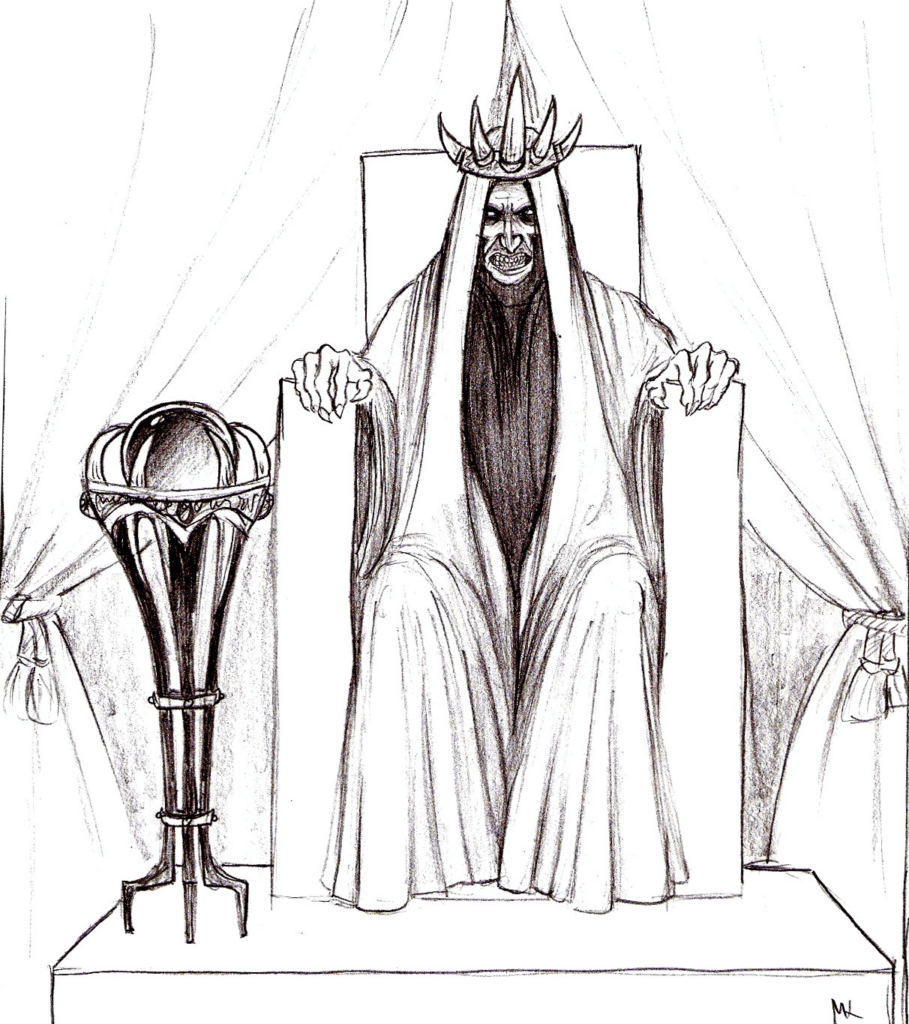
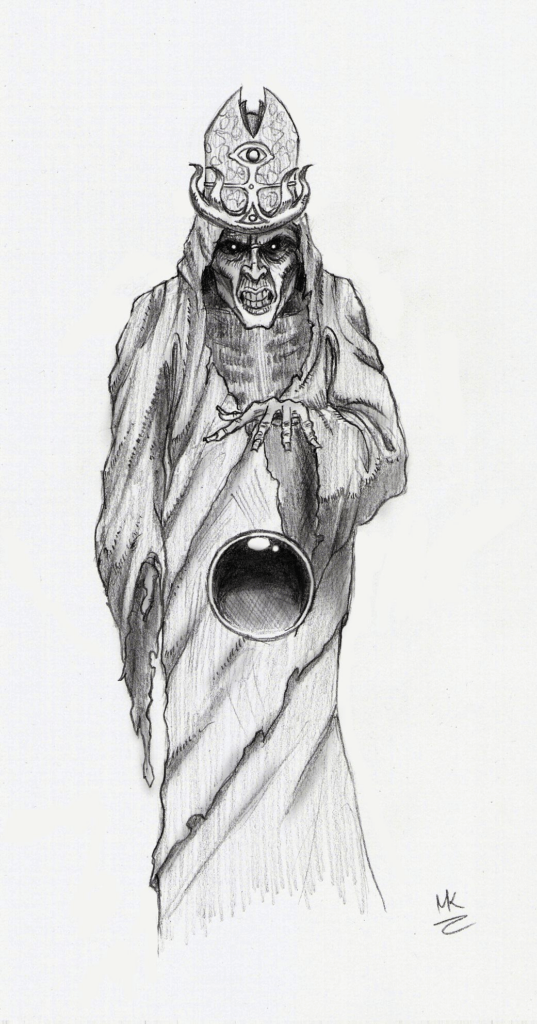
Der tulamidische Präfix „Al‘“ bezeichnet die Zugehörigkeit zu einer Familie. Al’Hrastor ist somit kein wirklicher Name, sondern eine Bezeichnung für jemanden, welcher der Familie des Hrastor angehört, wobei Hrastor zugleich als das Familienoberhaupt gekennzeichnet wird. Dass die Sanskitaren den Sultan für einen Sohn des Hrastor halten, darf also nicht verwundern. Indem er den Namen „Al’Hrastor“ als offizielle Bezeichnung für seine Person etabliert hat, ist dies genau der Eindruck, den er damit erweckt und den er gewiss auch erwecken wollte. Fragen nach seiner Herkunft werden dadurch schon im Ansatz erstickt, weil der bloße Name bereits die Antwort zu geben scheint. Natürlich ohne die Frage damit tatsächlich zu beantworten, schließlich gilt Hrastor den weitaus meisten Sanskitaren als frei erfundene Figur, was allerdings die wenigsten von ihnen auszusprechen wagen. Schon rein vorsichtshalber, falls sie sich irren sollten. Immerhin werden Hrastor phantastische Kräfte zugesprochen und die Fähigkeit, jederzeit alles und jeden beobachten zu können. Eine Annahme, die nicht näher an der Wahrheit liegen könnte.
Tatsächlich ist die Schattengestalt Hrastor seit ihrer Transformation nicht mehr in der Lage, einer Frau beizuwohnen oder gar Kinder mit ihr zu zeugen. Al’Hrastor entstammt vielmehr einem vom Rat der Schemenhaften unterhaltenen, streng geheimen Zuchtprogramm, welches es dem Rat ermöglichen soll, Amazeroth je nach Bedarf Diener mit besonderen Fähigkeiten und Begabungen zur Verfügung stellen zu können. Al’Hrastor stammt dabei von derselben Zuchtlinie ab wie der Stadtfürst Urlamesh, welchen der Rat der Schemenhaften gezüchtet hatte, um die nach dem Fall des Mittleren Sanskitarenreiches in Yal-Mordai herrschenden Unruhen zu beenden und eine neue Ordnung zu etablieren. Das Projekt, das zum Heranreifen des vermeintlichen Hrastorsohnes führte, trug den Codenamen „M’arih Suuh“ und bemühte sich darum, dem neuesten Spross von Amazth‘ großer Familie ein Exemplar mit allerlei außergewöhnlichen Talenten hinzuzufügen, darunter eine edle, ehrfurchtgebietende Gestalt und herausragende Magiebegabung.
Nach unzähligen Fehlschlägen ging aus dem Zuchtprogramm im Jahre 612 BF endlich ein Sprössling hervor, der den Anforderungen entsprach. Ein magisches Wunderkind, das 624 BF mit nur zwölf Jahren die Lehre zum Amazäer mit Auszeichnung abschloss. Natürlich blieb ein solch herausragender Zögling der Akademie dem gemeinen Volk nicht lange verborgen, und so präsentierte ihn der Orden der Hexer von Mordai als Suliman ibn Urlamesh, Sohn des Stadtfürsten von Yal-Mordai und seiner Gattin Fatima. Damit brachte man ihn zugleich in eine Position, welche ihn zum Erben des Stadtfürstensamtes machte, welches er eines Tages antreten würde.
Hrastor und sein Rat der Schemenhaften hatten den Startschuss zur mittlerweile über vierhundert Jahre währenden Ägide des Hexersultans Al’Hrastor gelegt, zu dem Suliman künftig werden sollte, um Amazeroths Macht über die Sanskitarenstädte dauerhaft zu sichern. Der Einfluss des Erzdämons auf das Riesland beruht offenbar ganz maßgeblich auf der Macht der Schatten, die ihm selbst gar nicht immanent ist, sondern von den Phexkulten der Tulamiden herrührt, die in der sanskitarischen Gesellschaft einen merkwürdigen Schulterschluss mit dem Kult des Amazth eingegangen sind.
Al’Hrastors Lehrjahre
Seine Lehrer trieb Suliman zur Verzweiflung, weil er mit zunehmendem Alter ihre Anweisungen mehr und mehr missachtete und dennoch – oder gerade deswegen – phänomenale Lernerfolge aufzuweisen hatte. Einem bestimmten Gast der Akademie blieb dies keineswegs verborgen. Merclador, der sich auf Geheiß seines Herrn seit mittlerweile beinahe drei Jahrzehnten an der Akademie aufhielt, um unter den Rekruten einen würdigen Träger für den Stein der tiefsten Nacht ausfindig zu machen, hielt den gelehrigen Knaben schon seit langem unter Beobachtung. Als er nun noch gewahr wurde, dass der Meisterschüler der Amazäer sich einen eigenen Kopf und offenen Ungehorsam erlaubte, war er sicher, die gesuchte Person gefunden zu haben.
Merclador hatte die Gestalt des Malik ibn Kadir angenommen, Lehrmeister für Invokation, der tatsächlich ein gutes Jahrzehnt an der Akademie gelehrt hatte, bis er im Alter vom zweiunddreißig Jahren einem Überfall durch Nagah-Piraten zum Opfer gefallen war, die Interesse an seinen Habseligkeiten entwickelt hatten. Der Quitslinga hatte daraufhin seinen Platz eingenommen, was es ihm ersparte, sich an der Akademie erst mühselig eine Tarnidentität aufbauen zu müssen – unter seiner richtigen aufzutreten kam schon einmal gar nicht in Frage. Zuweilen vertrat Merclador auch den Lehrer im Bereich der Verteidigung gegen die Dunklen Künste, ein Amt, das aus unerfindlichen Gründen in jedem Jahr von einer anderen Person bekleidet wurde.
In seinem Unterricht legte Merclador einen Schwerpunkt auf die verheerten Kraftlinien des Rieslands, die Folgen einer Überschreitung der Kritischen Essenz und die bisher durch Fran, Menuril und ihn selbst verfolgten Denkansätze, den Schaden, den der Komet angerichtet hatte, zu reparieren. Schließlich verfasste Suliman seine Abschlussarbeit über dieses Thema und steuerte ihm einige revolutionäre neue Denkansätze bei, auf die nicht einmal der Alveraniar des Verbotenen Wissens gekommen war. Geschweige denn Merclador selbst.
Hrastor war zufrieden. Sein Herr Amazeroth hatte ihm aufgetragen, das Interesse des Jungen an dieser Fragestellung zu wecken, und er hatte ebenfalls vorausgesehen, dass Merclador ihm in dieser Hinsicht zuarbeiten würde, wenn er den Dingen einfach seinen Lauf ließ. Amazth hatte auch vorhergesagt, dass der Drachendämon versuchen würde, Suliman zum neuen Träger des Steins der tiefsten Nacht zu erheben, etwas, das nicht im Interesse des Erzdämons lag, weil es zum Wesen des Steins gehörte, dass Merclador sich an die Fersen seines Trägers heftete und diesen beeinflusste. Und im Augenblick war Pyrdacors Sohn, der Drache der Kraft, ein viel zu unzuverlässiger Diener, um ihn auf Suliman loszulassen, von dem sich Amazeroth und Hrastor bedingungslose Loyalität erhofften.
Deshalb rief Hrastor, kaum dass Sulimans Lehre abgeschlossen war, den Jungen zu sich. Dieser war durchaus überrascht, dass die Schattengestalt, welche die Lehrmeister nur dann heraufbeschworen, wenn ein Zögling nicht gehorchte und sie ihm Angst einjagen wollten, tatsächlich existierte, doch wusste er seine Überraschung wohl zu verbergen. Hrastor gab Suliman den Auftrag, in die Welt hinauszuziehen und seine Forschungsarbeiten das Goldene Netz betreffend, die bislang allein theoretischer Natur waren, mit den Ergebnissen praktischer Versuche zu untermauern. Er sei dabei besonders an der Frage interessiert, ob sich das ohnehin stark angeschlagene Netz endgültig zerstören ließe, was dazu erforderlich sei und welche Auswirkungen ein solches Vorgehen nach sich zöge.
Der Junge verstand durchaus die Brisanz, die hinter diesem Auftrag steckte. Die Nachfahren der Tulamiden waren längst nicht mehr die kraftstrotzenden Kunkomer von einst. Die geborenen Sieger, nach denen man einen langen Zeitabschnitt die „Zeit der Stärkeren“ getauft hatte. Durch die Vereinigung mit den Remshen, die über viele Jahrhunderte als rastlose Nomaden vor ihren Feinden hatten fliehen müssen, war viel von deren Fatalismus in ihr Denken eingesickert. Viele Sanskitaren waren dem Glauben der Remshen an die Göttertrinität Braiorag, Ipkara und Ongferan treu geblieben und führten ein Leben als Reiternomaden. Die drei Götter hatten die Remshen gewarnt, dass sie mit der Sesshaftwerdung großes Unheil auf sich herabbeschwören würden, deshalb blieben die Reiternomaden mobil, um jeder neuen Herausforderung flexibel begegnen zu können.
Bei den Bewohnern der Stadtstaaten indes war alles längst geschehen, wovor die drei Götter sie gewarnt hatten. Sie hatten unzählige Schlachten geschlagen, zahllose Kriege geführt, viele von ihnen verloren. Ihr Reich war mehrfach gefallen, und die Stadtstaaten waren kaum mehr als ein Schatten einstiger Kunkomermacht. Und das wohl Schlimmste – sie hatten ihren Glauben verloren. Jede Erinnerung an ihre spirituellen Wurzeln war ausgelöscht worden. Und das war wohl die schlimmste Strafe für ein solch frommes und tiefgläubiges Volk wie die Tulamiden, deren Kultur bei den Städtern überwog. Die Stadtbewohner waren in eine verzweifelte Suche nach immer neuen geistlichen Impulsen verfallen, die aber eigentlich nicht die Innovation suchte, sondern das, was das Volk verloren hatte. Unwiederbringlich, wie sich immer klarer herauszukristallisieren begann.
In den Stadtstaaten breitete sich die Überzeugung aus, die Sterblichen seien im elenden Diesseits gefangen, dem zu entkommen eine Form von Erlösung sei. Die Idee einer möglichen Wiedergeburt versetzte sie in Panik, bedeutete Reinkarnation doch, dem tristen Los als Sterblicher niemals entkommen zu können und gezwungen zu sein, das leidvolle Derendasein bis in alle Ewigkeit durchleben zu müssen. Selbst der Gedanke an ein Leben nach dem Tod hatte wenig Tröstliches an sich, denn wer vermochte schon zu sagen, was einen Sanskitaren im Jenseits erwartete.
Dieser Fatalismus fand seine Wurzeln in den alten Erzählungen der Remshen. Ihr Volk war auf der Flucht vor Verfolgung ins Riesland gekommen, war bei der alten Hochkultur in Ungnade gefallen, musste vor erneuter Verfolgung und Sklaverei wieder einmal die Flucht antreten, welche auch nach dem Untergang des Reiches nicht endete. Und nach der Vereinigung mit den Tulamiden galt ihre Tradition oft als die Unterlegene und musste gegenüber der tulamidischen Dominanz zurücktreten. Den Remshen, deren ursprüngliche Kultur sich bei den sanskitarischen Reiternomaden in stärkerem Maße erhalten hat als bei den eher tulamidisch geprägten Städtern, gelten die Götter deshalb als prinzipiell böswillig, mit Ausnahme ihrer eigenen Göttertrinität.
Die Städter haben die Reiternomaden als Machtfaktor im Riesland rasch übertrumpft. Die Tulamiden brachten die Tradition der Koptha-Magier in das Bündnis der verschmelzenden Völker ein, aus welcher schließlich die Amazäer und die Zelothim hervorgingen. Ihre Zauberkunst konzentrierte sich im Riesland rasch auf Dämonenbeschwörung, Namensmagie und die Anfertigung magischer Zeichen. Dies wurde auch für die Stämme der Remshen, welche sich den Kunkomern anschlossen, zu einem bedeutenden Faktor für ihren Aufstieg. Jene Stämme, welche ihre traditionelle Weise zugunsten der Kunkomer Magier verbannten, gewannen rasch an Macht und Einfluss. Die Kultur der Remshen geriet dadurch ins Hintertreffen und wird von den Städtern tendenziell als minderwertig angesehen.
Wenn ein Reiternomade erfährt, dass einer der Städter zu der gleichen Grundüberzeugung gelangt ist, welche die Nichtsesshaften seit jeher leitet, setzt er eine ernste Miene auf und verweist auf das, was seiner festen Überzeugung nach die Ursache für das Leid der Städter ist. Diese hatten ihre eigenen Siedlungen auf den Trümmern der verheerten Städte der früheren Hochkultur erbaut, welche vor tausenden von Jahren durch den Kometen ausgelöscht worden war. Ganz offensichtlich hatten sie damit einen Fluch auf sich herabbeschworen, schließlich müsse es ja Gründe gehabt haben, warum die Götter sich befleißigt sahen, die alte Zivilisation zu vernichten. Alle Anzeichen deuteten darauf hin, dass sich das alte Reich dem Namenlosen verschrieben hatte, dessen verderbter Einfluss nun offenbar auch die Bewohner der Sanskitarischen Städte befiel. Die Städter wiederum blieben an ihre Ansiedlungen gebunden, denn nur deren trutzige Mauern boten ihnen hinreichenden Schutz vor ihren Feinden. Sollten die Reiternomaden rechtbehalten – und vieles sprach dafür – sind die städtischen Sanskitaren dem Fluch des Rieslands, welcher zugleich der Fluch war, der die alte Hochkultur zerschmettert hatte, und der nichts anderes ist als der Fluch des Widersachers, bis in alle Ewigkeit ausgeliefert.
Dem Gott ohne Namen galt die besondere Abneigung der Remshen. Sie erinnerten sich, dass der Widersacher im Reich der Altvorderen der Gott ihrer Feinde war. Diese dienten dem Gesichtslosen und beschworen damit den Zorn der Götter und den Himmelsbrand herauf. Die Sanskitaren hassen den Namenlosen deshalb bis in die Gegenwart hinein, und das gilt ebenso für die Amazäer und damit auch für die Zelothim. Darin sind sich sogar die Städter und die Nomaden einig. Während die Reiternomaden allerdings auch den übrigen Göttern kritisch gegenüberstehen und sich allein auf die Hilfe durch ihre drei Götter berufen, welche sie warnten, nicht die gleichen Fehler zu begehen wie die Städter, steht die in stärkerem Maße tulamidisch geprägte Seele der Städter anderen Gottheiten offener gegenüber. Doch ihre alten Götter hatten sie verloren, und an ihren neuen zweifelten sie.
Eine solche Haltung war für den Kult eines Erzdämons idealer Nährboden. Die Chaosmächte planten schließlich ohnehin, die Schöpfung zu vernichten, da kamen ihnen hunderttausende von Anhängern, die dieses Ziel nur allzu gern verfolgten, gerade recht. Amazeroth freilich war nie ein besonders eifriger Verfechter der Vernichtung der Schöpfung gewesen, oder jedenfalls hatte er es damit nicht besonders eilig. Ihn hatte wissenschaftlicher Forscherdrang in die Niederhöllen geführt. Er wollte erst wissen, wie die Welt funktionierte. Wenn das geklärt war, konnte man sie immer noch zerstören.
Borbarads Phantastereien über die Befreiung der Sterblichen von der Bevormundung durch die Unsterblichen ärgerten den Verschlinger von Gnaph’Caor. Der Alveraniar des Verbotenen Wissens hätte ihn dabei unterstützen sollen, die Sterblichen seinem Willen zu unterwerfen. Es war nicht vorgesehen, dass er daran arbeitete, sie demselben zu entziehen. Dieser kleine Streitpunkt zwischen ihm und seinem Geschöpf würde zu klären sein, und zwar noch bevor das Zeitalter zu Ende ging.
Suliman tat, wie Hrastor ihm befohlen hatte, und zog in die Welt hinaus. Also suchte der Kult nach einer Möglichkeit, die Schöpfung zu zerstören, und glaubte sie in einer endgültigen Vernichtung des Goldenen Netzes gesichtet zu haben. Durchaus nicht unwahrscheinlich, wie Suliman befand. Suliman … Der Junge entschied, nicht unter diesem Namen zu reisen. Der Name Suliman ibn Urlamesh hatte einen gewissen Bekanntheitsgrad erlangt, auch außerhalb Yal-Mordais. Es würde seine Mission erschweren, wenn man ihn als vermeintlichen Sohn des Stadtfürsten erkannte. Vom Speichellecker, der seine Gunst erwerben wollte, bis zum Entführer, der für ihn Lösegeld erpressen wollte, war so ziemlich alles denkbar. Also legte der Junge sich einen Decknamen zu. Und da er in Hrastors Auftrag unterwegs war, benannte er sich nach ihm, „Al’Hrastor“.
Entgegen Hrastors Annahme, den Jungen in aller Heimlichkeit aus Yal-Mordai fortgeschickt zu haben, hatte Merclador den Schachzug des Ratsvorsitzenden sehr wohl mitbekommen. Er wusste auch schon, was zu tun war. Das plötzliche Verschwinden seiner Tarnidentität hatte er lange vorbereitet. Und so fanden die Amazäer tags darauf einen vollkommen entstellten Leichnam, der die Kleidung des vermissten Lehrmeisters trug. Selbiger war offenbar beim Sprung in das Heiligtum der Sternensenke dermaßen unglücklich aufgekommen, dass er nicht mehr zu erkennen war. Und den Stadtstreicher, den Merclador tatsächlich hineingeworfen hatte, würde gewiss niemand vermissen.
Der Quitslinga wechselte erneut seine Gestalt. Von nun an war er Mayla Bint Zafira, eine attraktive sanskitarische Schatzsucherin auf der Suche nach den Hinterlassenschaften der alten Hochkultur. Er ahnte, dass die Gunst einer koketten Siebzehnjährigen, welche eine blutige Familienfehde zur Flucht aus Yal-Mordai gezwungen hatte und die fest entschlossen war, als gemachte Frau zurückzukehren und mit ihrem neu erworbenen Reichtum ihre Feinde auszumerzen, bei dem gerade in die Pubertät eingetretenen Jungmagier gut ankommen würde.
Zur Sicherheit wählte er dennoch die klassische Variante. „Die Familie, die zusammen Leute zusammenschlägt, steht auch zusammen.“ Merclador heuerte in Gestalt eines Fischers eine Diebesbande an, die den jungen Magier überfallen sollte. Er behauptete, der Zauberkundige habe seine Tochter entehrt, dafür sie nun eine Abreibung fällig. Stattdessen verwandelte er sich in Mayla, die dem Amazäer, der sich so jäh von Feinden umringt sah, zu Hilfe eilte. Gemeinsam schlugen sie die Diebe in die Flucht, und da ihre Hilfe für ihn so nützlich gewesen war, willige Al’Hrastor ein, dass die junge Sanskitarin ihn ein Stückweit des Weges begleitete. Hätte sich Merclador ihm auf eine andere Weise genähert, hätte er sie gewiss schroff abgewiesen, überzeugt, dass sie seiner Unternehmung nur im Weg stehen würde.
Merclador hatte lange keine Gelegenheit mehr gehabt, in weiblicher Gestalt aufzutreten, aber das alte Spiel, zu locken, Begehren zu wecken, zu verführen und dann doch wieder zurückzuweisen, beherrschte er perfekt. Es hatte zum Repertoire von Pyrdacors Sohn gehört, und natürlich passte es zu Amazeroths Diener. Der unerfahrene Junge war Wachs in seinen Händen, und bald schon war Merclador es, der die Marschrichtung bestimmte.
Mayla zeigte sich interessiert an seiner Mission und befand, dass sie im Grund doch dasselbe Ziel verfolgten. Als die alte Hochkultur den Kontinent beherrschte, waren die Kraftlinien noch intakt. Beschädigt wurden sie in dem Moment, als der Komet ihr Reich verheerte. Womöglich seien zwischen ihren Hinterlassenschaften Hinweise auf die Funktionsweise des Goldenen Netzes zu finden und wie man es manipulieren könne. Dass auch Borbarad diesem Gedanken gefolgt war und ihn verworfen hatte, verschwieg er dem Jungmagier vorsichtshalber.
Die nächsten Jahre verbrachten Al’Hrastor und die vermeintliche Mayla auf Schatzsuche. Ihre besondere Aufmerksamkeit galt den Hinterlassenschaften des Marhynianischen Imperiums. Diese fanden sich überall in Rakshazar. Mal waren es nur ein paar Steine, die von einem längst verfallenen Gebäude stammten, mal die Grundrisse ganzer Dörfer oder Städte, welche ihre ursprüngliche Pracht und Größe noch erahnen ließen. Die besondere Aufmerksamkeit der Suchenden galt Friedhöfen und Grabanlagen, die häufig wertvolle Grabbeigaben enthielten und nach und nach Al’Hrastors Verständnis für die untergegangene Kultur verbesserten. Merclador sorgte dafür, dass sein Begleiter verstand, dass die Marhynianer über das Wesen der magischen Kraftlinien genau bescheid gewusst und ihre Dörfer auf Nodices, ihre Städte auf je einem Nexus des Goldenen Netzes errichtet hatten. Die Tatsache als solche war schon Menuril bekannt gewesen. Merclador war aber inzwischen die Idee gekommen, dass es nützlich sein sollte, eine Karte zu besitzen, welche den alten und den neuen Verlauf der Kraftlinien protokollierte und es so erlaubte, den Zustand des Goldenen Netzes vor und nach dem Kataklysmus vergleichen zu können. Nach rund fünfzehn Jahren hatten sie so große Teile des Rieslands erforscht, dass die daraus entstandene Karte als voller Erfolg gewertet werden musste.
Al’Hrastor und Mayla waren inzwischen ein Paar geworden. Der Amazäer, der sich stark zu der attraktiven Schatzsucherin hingezogen fühlte, hatte ein solches Arrangement zur Bedingung für ihre weitere Zusammenarbeit gemacht. Merclador, der seine drachisch-dämonische Natur vor Al’Hrastors Zaubermacht zu verbergen wusste, spielte die Rolle der Liebhaberin perfekt, auch wenn sie ihn schmerzlich daran erinnerte, dass er selbst durch eine ganz ähnliche Intrige Amazeroths zu seinem heutigen Ich geworden war. Der Erzdämon hatte ihm eine drachische Partnerin zugetrieben, ihre Gedanken kontrolliert und ihn manipuliert, bis er mit dem Drachen der Kraft verschmolzen war und einen Pakt mit Amazeroth geschlossen hatte.
Ab und zu erzielten die beiden Suchenden einen Haupttreffer und fanden eine ausgedehnte unterderische Zissme, welche sich als phantastisches Studienobjekt erwies und darüber hinaus nicht selten magische Artefakte aus der Zeit der untergegangenen Hochkultur enthielt. Die weniger wertvollen Stücke wurden auf den Märkten der großen Städte verkauft und sicherten den beiden Schatzsuchern ihren Lebensunterhalt, machtvollere Funde behielt Al’Hrastor meist für sich. Um eine Überschreitung der Kritischen Essenz durch das Anhäufen zu vieler Artefakte zu vermeiden, legte er Verstecke im Limbus an, auf die er bei passender Gelegenheit zurückgreifen konnte. Mayla gab sich uninteressiert an magischen Artefakten und gab vor, vor allem auf der Suche nach Gold, Edelsteinen und edlem Geschmeide zu sein, die wiederum für Al’Hrastor uninteressant waren, edle Steine mit besonderen magischen Eigenschaften einmal ausgenommen. Den Amazäer mit einem Arsenal an mächtigen magischen Gegenständen auszustatten, war durchaus Teil des Plans, den Merclador verfolgte.
Der wertvollste Fund war eines der Runenschwerter der Scherbenmagier, ein Original, eine der ursprünglichen sechsundsechzig Klingen. Al’Hrastor gab ihm den Namen Windzorn und machte sie so gut es ging mit seiner Funktionsweise vertraut. Merclador, der das Marhynianische Imperium gekannt hatte und ebenso mit vielen Aspekten der Scherbenmagie vertraut war, hätte Al’Hrastor die Grundlagen sehr wohl lehren können, doch hätte dies seine Tarnidentität in Gefahr gebracht. So wählte er den langsamen Weg und spielte seinem Begleiter nach und nach Folianten und Aufzeichnugen zu, welche die Scherbenmagie erläuterten. Nicht wenige davon hatte er selbst angefertigt und jubelte sie dem Amazäer als Relikte aus alten Tagen unter.
Im gleichen Maße, in dem sich Al’Hrastor der Macht des Namenlosen bediente, säte Merclador in ihm Zweifel an Amazeroth und seinen Motiven. Der Drachendämon war sich bewusst, dass Hrastor den jungen Magier für einen Paktschluss mit dem Vielgestaltigen Blender ausersehen hatte, dessen Aufgabe schlussendlich darin bestehen würde, die Schöpfung zu vernichten. Merclador flüsterte ihm anderes ein, zuallererst dadurch, dass Mayla alles tat, um ihren Partner glücklich zu machen. Dies weckte in Al’Hrastor mehr und mehr die Frage, ob die fatalistische, lebensverneinende Denkweise der sanskitarischen Städter im Allgemeinen, der Amazäer im Besonderen wirklich auf einer validen Tatsachenbasis fußte oder die richtige Schlussfolgerung aus derselben war. Merclador hatte Al’Hrastors Potenzial erkannt. Wenn es ihm gelang, den jungen Magier seinem eigenen Willen zu unterwerfen, statt ihm ihrem gemeinsamen Herrn zu überlassen, mochte Al’Hrastor eines Tages die Macht erwerben, Amazeroth von seinem Thron zu stoßen, seine Stelle einzunehmen und Merclador in die Freiheit zu entlassen.
Merclador platzierte in einigen Marhynanianischen Anlagen – Überresten großer Villen, welche bedeutenden Adligen des Imperiums gehört hatten, Grabanlagen von Regionalherrschern und den Ruinen von Verwaltungsgebäuden – gefälschte Hinweise auf Amazeroth, welche den Eindruck vermittelten, der Erzdämon sei der heimliche Herr des Imperiums gewesen und habe auch seinen Untergang verursacht. Schließlich positionierte er den Stein der tiefsten Nacht im gut erhaltenen Kellergewölbe des einstigen Anwesens eines hochrangigen marhynianischen Fürsten, einschließlich eines halb verfallenen Folianten, der jedoch noch genau erkennen ließ, wie der Stein zum Fokussieren von Magie zum Einsatz zu bringen sei. Die Tatsache, dass der Stein alle vierhundert bis fünfhundert Jahre per Paktschluss mit Amazeroth neu aufgeladen werden musste, verschwiegen die Ausführungen natürlich. Nachdem Mercladors Ziel verwirklicht war, Al’Hrastor zum Träger des Steins der tiefsten Nacht zu machen und die Saat des Zweifels an Amazeroth und seinen Motiven in seinem Herzen zu sähen, inszenierte er Maylas Tod. Suliman und seine Begleiterin begaben sich ins Lavameer, unter dem die alte Hauptstadt Marhynia begraben lag. Sie suchten nach Hinweisen auf die alte Reichshauptstadt, aber auch nach den Überresten des zentralen Nexus, der einst sämtliche Krafltinien des Rieslands miteinander verknüpft hatte, bevor er von Kataklys zerschmettert worden war. Bei einem tragischen „Unfall“ versank Mayla in der glühenden Lava.
Al’Hrastors Herz war gebrochen, und er sah sich außerstande, seine Mission fortzuführen. Ohne weitere Forschungsergebnisse zu erzielen, zog er sich aus dem Lavameer zurück. Sein Herz war so voller Trauer um die verlorene Gefährtin, dass er bereit war, die amazäische Lehre von der unentrinnbaren Leidhaftigkeit des Lebens voll und ganz zu akzeptieren. Er beschloss, nach Yal-Mordai zurückzukehren und sein Scheitern einzugestehen. Vielleicht würde der enttäuschte Hrastor ihn von seinen Qualen erlösen.
Merclador, der immer noch genug von einem Drachen hatte, als dass glühende Lava ihm nichts anhaben konnte, erkundete unterdessen die Tiefe des Lavameers und fand tatsächlich Überreste Marhynias, welche seit tausenden von Jahren den Lavamassen trotzten. Schließlich lokalisierte er, was er gesucht hatte – den Einschlagsort von Kataklys. Von dem Kometen waren unzählige Stücke abgesplittert. Die kleinsten bedeckten als giftige Kometenasche die Aschewüste, der größte bekannte Splitter bildete jene Insel im Lavameer, auf welcher das Kloster der Rontharpriester stand. Sie formte ein gewaltiges Schwarzes Auge, und die Priester hatten gelernt, seine Macht zum Orakeln zu nutzen. Das eigentliche, gewaltige Kernstück des Kometen jedoch, bestehend aus Endurium, Sternenmetall (Meteoreisen) und jenem absonderlichen Gestein, aus dem die Kometenasche geworden war, lag noch immer unbehelligt am Grunde des Lavameers. Merclador barg den Kometenrest aus dem Einschlagkrater und platzierte ihn in einem Lavastrom. Wenn seine Berechnungen stimmten, würde er in einigen Jahrhunderten am Rande der Aschewüste an Land gespült werden.
Die Zelothim
Sirals Gesicht wurde zu einer steifen Maske wahnwitzigen Stolzes. Er sah hinab auf seinen Bruder, der in der Mitte der stumpf beleuchteten Halle zusammengebrochen war und sich nun in Fieberkrämpfen wand. Fast hätte er an der Wirkung der Glyphe gezweifelt, doch Ashraff hätte es nie gewagt, ihn zu betrügen. Er wandte sich zum Amazthaltar und stierte auf den Kristall in der Hand des Ritualmeisters. „Mein, endlich mein“, flüsterte er sich zu, und ein Lächeln huschte über seine schmalen Lippen. Sirals Augenblick des Triumpfes spiegelte sich tausendfach vor seinem inneren Auge wieder und dehnten den Moment in eine Ewigkeit …
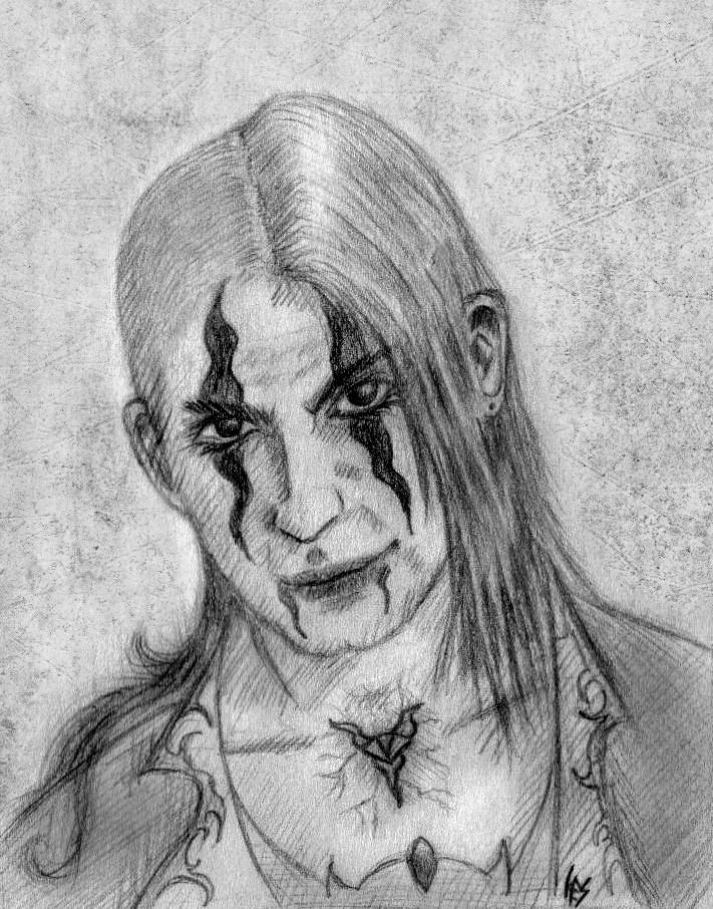
Als Al’Hrastor Ende des Jahres 651 BF nach Yal-Mordai zurückkehrte, zeigte sich Hrastor zu seinem Erstaunen äußerst zufrieden mit seinen Forschungsergebnissen. Eine Karte des Goldenen Netzes vor und nach dem Kataklysmus war etwas, mit dem sich arbeiten ließ. Natürlich hatte der Vorsitzende des Rats der Schemenhaften nicht ernsthaft damit gerechnet, dass ein Kind von gerade mal zwölf Jahren und der Mann, zu dem er heranwuchs, binnen zweieinhalb Jahrzehnten ein Rätsel lösen würde, an dem sich die größten Magier Deres seit Jahrtausenden die Zähne ausbissen. Aber er hatte einmal mehr entscheidende neue Impulse beigesteuert, und er war für die Fragestellung sensibilisiert worden. Insofern war Al’Hrastors Reise ein voller Erfolg gewesen.
Hrastor nahm außerdem mit Genugtuung zur Kenntnis, dass der inzwischen Neununddreißigjährige jetzt offenbar den Fatalismus der Sanskitaren teilte und die Bereitschaft zeigte, die Vernichtung der Schöpfung als Erlösung aus dem leidenvollen Dasein im Diesseits zu betrachten. Während seiner Lehre hatte nichts in eine solche Richtung gedeutet. Stattdessen war Suliman durch seinen unangemessenen Überschwang und seine übermäßige Lebensfreude negativ aufgefallen.
Dank der Artefakte, die der Magier von seinen Reisen mitgebracht hatte, wurde ihm nunmehr eine außerordentliche Machtfülle zuteil. Hrastor befand, dass es an der Zeit für den Zauberkundigen sei, sein Geburtsrecht einzufordern und die Herrschaft über Yal-Mordai zu übernehmen. Al’Hrastor fühlte sich noch nicht bereit für eine solche Aufgabe, aber er gehorchte dem Anführer des Rates. Hrastor riet seinem Zögling, behutsam vorzugehen. Als der vergessene Sultan Mena’ton seine Eltern entmachtet hatte, war dies von den Sanskitaren als infamer, nie zuvor dagewesener Vorgang gebrandmarkt worden. Wollte Suliman von seinem Volk als Herrscher akzeptiert werden, durfte er nicht den Fehler begehen, mit derselben Vorgehensweise aktenkundig zu werden.
Wie Al’Hrastor es erwartet hatte, wies Stadtfürst Urlamesh, der seinem Volk als zwar zorniger, aber doch gerechter Herrscher galt, sein Ansinnen auf einen vorzeitigen Thronwechsel schroff zurück. Also sorgte Suliman dafür, dass sein vermeintlicher Vater am nächsten Morgen – seines freien Willens beraubt, barfuß und im Büßergewand – gemeinsam mit seiner Frau an der Sternensenke erschien, lauthals ein Gebet an Amazth herausbrüllte und sich dann zum Entsetzen der anwesenden Kristallgardisten, die sich keinen rechten Reim darauf machen konnten, warum sie vor Schreck erstarrten und viel zu spät zur Rettung des Herrschers ansetzten, Seite an Seite mit seiner Gattin in die Senke stürzte.
Die Nachricht vom traurigen Tod seiner Eltern erreichte Suliman, während er in der Bibliothek der Akademie einen Stapel alter Folianten studierte. Wie es sich für den treuen, um das Wohl seiner Eltern besorgten Sohn gehörte, zeigte er sich bestürzt über das viel zu frühe Ableben des Stadtfürstenpaars, und wie es sich für einen treuen Amazäer geziemt, voll des Lobes für das Opfer, das beide im Namen des einzig wahren Gottes dargebracht hatten, ihr eigenes Leben. Die schwere Bürde der Herrschaft, die ihm damit viel zu früh auferlegt wurde, war er zu tragen bereit, nicht um des eigenen Ehrgeizes willen, sondern um dem Volk und seinen Belangen zu dienen, es gegen Unbill zu schützen und ihm ein gerechter Anführer zu sein.
Im Nachlass Fürst Urlameshs fanden sich weitschweifige Aufzeichnungen über das leidvolle Leben im Diesseits, über Amazth‘ Gnade, die Sterblichen von ihrem Elend zu erlösen, und über die Entbehrungen, die es kostete, sich dieser Gnade würdig zu erweisen. Die Philosophie, die er beschrieb, erinnerte an die der Amazäer, war jedoch viel radikaler und ging immer wieder deutlich über die amazäischen Schlussfolgerungen hinaus. Der Freitod des Fürsten schien die Lehre, die er beschrieb, zu vollenden. Urlamesh und Fatima hatten sich freiwillig in die Hände Amazths begeben, damit der Gott in seiner unendlichen Weisheit und Güte ihre derischen Qualen beendete und ihnen die Gnade der Auslöschung gewährte.
Dass die Ausführungen des Fürsten in einer Sprache verfasst waren, die Urlamesh gar nicht beherrscht hatte, und dass die Schrift seiner Handschrift nicht besonders ähnlich sah, der von Suliman dafür umso mehr, fiel in einer Zeit, in der sich eine ganze Stadt auf ein feierliches Staatsbegräbnis ihres Herrschers und seiner Gattin vorbereitete, gar nicht weiter auf. Und als dieses vonstatten gegangen war, hatte Al’Hrastor den Folianten bereits in seinen Besitz gebracht und verkündete, zu Ehren seines verstorbenen Vaters einen Orden der Amazäer stiften zu wollen, der auf seiner Philosophie fußte.
So wurde der Orden der Zelothim aus der Taufe gehoben. Das Wort „Zelot“ entstammt dem Tulamidischen und bezeichnet einen religiösen Eiferer, jemanden, der eine starke Verbundenheit mit einer Gottheit aufweist, ohne jedoch ein Erwählter oder Geweihter zu sein. Es kann sich dabei um Laienpriester handeln oder um fromme Personen. Al’Hrastors Zelothim bildeten einen mit weitläufiger Autonomie versehenen Orden der Amazäer, waren also mit starker magischer Macht ausgestattet. Zelothim betrachten sich als die Erben arkanen Wissens aus vergangenen Zeitaltern. Sie sehen sich als Erben der Kophtanim, als Erben der Scherbenmagier, ja, als Erben des Diamantenen Sultanats einerseits, der untergegangenen antiken Hochkultur insgesamt andererseits.
Unermüdlich suchen sie nach Schriften aus den Tagen, wo ihrer Ansicht nach die Bibliothek des Amazth den sterblichen Weisen noch offenstand. Diese stehen im Zentrum ihrer Forschung. Anders als die meisten Magiebegabten Rakshazastans verlassen sich sich aber nicht nur auf Althergebrachtes. Die Kunst, den Kern einer magischen Handlung zu erkennen und weitere Anwendungen zu ersinnen, macht den wahrhaft erleuchteten Zeloten aus. Dreh- und Angelpunkt sind dabei die Kristalle der Form, welche die Weisheit des Echsischen Zeitalters binden, vor allem aber die Macht der Wahren Namen, fixiert in Xamanoth-Glyphen. Die Zelothen glauben, dass man durch das Wissen um die Essenz der Dinge diese beeinflussen könne, wobei die Essenz aller Dinge ihr Wahre Name sei, der ihnen einst von Amazth gegeben wurde. Selbst Götter und das Schicksal, so die zelothische Lehre, üben ihren Einfluss nur über diese Namen aus, und so ist es nur natürlich, dass die Zelothim ihr geheimes Wissen gleichsam vor dem Vergessen wie auch vor den Unwürdigen bewahren. Dieses Wissen kann nicht durch Studium von Schriften erlernt werden, sondern bedarf der göttlichen Offenbarung.
Zöglinge der zelothischen Lehre werden von Anfang an darauf gedrillt, das Leben zu hassen und das Dasein vernichten zu wollen. „Das neugeborene Kind ist der größte Sünder. Hunger, Durst, Wollust und Gier sind in ihm. So ihr einen Säugling am Leben lassen müsst, so schlagt ihn, um ihn zu züchtigen. Wenn er dann weint, wie sie es gerne tun, so schlagt ihn weiter, und beachtet ihn ansonsten nicht. So wird er irgendwann die heilige Verachtung von allem, was existiert, erlangen.“ So lautet ein wichtiger Lehrsatz. Zelot wird man nicht dadurch, dass man in eine Zelothimfamilie hineingeboren wird, denn den Zelothim gelten Beischlaf und Geburt als schwere Sünden. Ihren Nachwuchs rekrutieren sie durch Neuanwerbungen. Sie suchen in den Städten der Sanskitaren nach magiebegabten Kindern. Herkunft und sozialer Stand sind ihnen einerlei, sie spielen bald ohnehin keine Rolle mehr. Allerdings ist die Bereitschaft, ein Kind in die Sklaverei zu verkaufen, bei der armen Straßenhure, die ihr Balg in der Gosse zur Welt gebracht hat, meist größer als die des Fürsten, der einen überzähligen Erben oder einen Bastard loswerden muss. Und der preisliche Unterschied fällt ebenfalls ins Gewicht.
Andere Kinder werden ungeachtet ihrer fehlenden Magiebegabung in den Orden aufgenommen. Diese erhalten ihre magischen Kräfte aus einem Minderpakt mit Amazth und wirken ihre Zauber mit Hilfe der Blutmagie. Dies ähnelt der Magie der aventurischen Borbaradianer, nur dass die Zelothim wissen, woher ihre Kräfte stammen. Ein solcher Minderpakt ist auch für die Magiebegabten unter den Eleven obligatorisch.
In den ersten Lebensjahren erhält das Kind eine harte, von Drill und krakonischen Strafen begleitete Grundausbildung. Lesen, Schreiben und Mathematik, Rechtskunde, Staatskunst und Geschichte, Geographie, Magiekunde und Dämonologie, Überleben in der Wildnis, Kampf und Kriegskunst, Pflanzenkunde, Bestienkunde und Alchimie. All die Fähigkeiten, die es für sein Studium und für die Ausübung der Pflichten benötigt.
In dieser Phase der Ausbildung geht es allerdings weniger um Wissenserwerb als vielmehr darum, den Lebenswillen des Kindes zu brechen, es gefügig zu machen und ihm die besondere, negative Sicht auf die Schöpfung einzuimpfen, der es sich verschreiben soll. Zu diesem Zweck muss es jahrelange Qualen über sich ergehen lassen. Jede Bruderschaft kennt dazu ihre eigene, ganz spezielle Methodik. Nicht nur, dass die Zöglinge selbst unerträgliche Schmerzen erleiden müssen, sie werden auch daran gewöhnt, anderen Leid zuzufügen, vor allem Personen aus ihrem früheren Leben, die sie einst geliebt haben. Die Zelothim tragen im Umgang mit ihren Eleven stets Masken. Der Unterricht verläuft technokratisch und unpersönlich. Außerhalb der Lehrstunden sprechen die Dozenten nicht mit den Schülern. Sie schauen sie nicht einmal an. Die Befriedigung elementarster Bedürfnisse wird ihnen verwehrt. Nicht nur die nach Anerkennung oder Liebe, sondern auch die Versorgung mit Wasser oder Nahrung. Ein Eleve, der durstig oder hungrig ist, muss sich die benötigten Lebensmittel selbst beschaffen. Manche lernen auf diese Weise früh, in die Wildnis hinauszugehen, zu jagen und zu töten, andere nutzen ihre ersten magischen Fähigkeiten, um das Benötigte aus einfachen Menschen herauszupressen, wieder andere verlegen sich auf Diebstahl oder Raub. Nicht selten werden sie gefasst und bestraft. Die Zelothim sorgen dafür, dass die Delinquenten nach einiger Zeit an sie herausgegeben werden, und bestrafen sie dann abermals dafür, dass sie erwischt worden sind. Mit voranschreitender Zeit werden die Zöglinge entstellt und verstümmelt, um ihnen die Verachtung für den eigenen Körper einzubläuen. Das gesamte Gebaren erscheint wie ein ins Groteske übersteigerter Sadismus, doch empfinden die Zelothim dabei keinerlei Freude oder Genugtuung. Sie haben schließlich dieselbe Tortur hinter sich und deshalb solche Empfindungen vollständig verloren. Genau diesem Ziel dient das barbarische Vorgehen. Alle menschlichen Gefühle sollen ausgelöscht werden, bis von der Seele des Anwärters nur noch eine leere Hülle übrigbleibt, die mit dem Licht des Amazth gefüllt werden kann.
Irgendwann beginnen die Eleven dann, gemeinsam mit den anderen Amazäern zu studieren, doch die Qual begleitet ihr Leben weiterhin. Sicher vor all der Pein sind die Schüler nur, wenn sie zusammen mit den anderen Zauberkundigen unterrichtet werden oder wenn man sie in den Tempel des Amazth schickt, wo der Allwissende in ihnen durch Visionen die zerstörten weltlichen Gefühle und Gedanken durch seine Weisheit ersetzt. In der Anfangszeit meiden die Eleven den Tempel. Er erscheint ihnen unheimlich und sie glauben, von seiner Präsenz geängstigt und verwirrt zu werden. Doch je mehr sich bei ihnen die Überzeugung durchsetzt, dass die Niederhöllen exakt die ersehnte Erlösung von der materiellen Welt darstellen, als welche die Lehrkräfte sie ihnen präsentieren, umso mehr erscheint ihnen der Tempel als die einzige, perverse Form von Heimat, die ihnen noch bleibt. Wenn ihre Ausbildung endet und die Schüler nicht nur ihre Prüfung absolvieren, sondern auch zu der Einsicht gelangt sind, sich vor der unerträglichen Welt in die Arme Amazth‘ flüchten zu wollen, haben die Ausbilder ihre Aufgabe erfüllt.
Nach dem Ende der Ausbildung halten Außenstehende die Zelothim für dem Wahnsinn verfallen. Doch es ist ein kalter, methodischer Wahnsinn, entstanden aus der Abwesenheit jeder Form von Liebe oder Gnade, aber auch von Hass (mit Ausnahme des Hasses auf die Schöpfung selbst) oder Gier. Ihr Wahn ist Mittel zum Zweck, um ihnen ihre Menschlichkeit zu rauben. Sie gleichen in ihrem Wesen eher Dämonen als Sterblichen. Die technische Seite ihres Verstandes indes, welche kalte Rationalität, die treffsichere Fertigkeit, Problemlösungen zu ersinnen, ausgeprägte Zaubergabe und überwältigende Machtausübung umfasst, ist bis zur Meisterschaft geschult. Ihr Handeln erscheint rational, viel zu rational genauer gesagt. Und doch folgt es keiner Vernunft. Das Denken der Zelothim zielt allein auf die Zerstörung der Schöpfung ab. Darauf, das Leid zu beenden und selbst Erlösung zu finden. Oder andere zu erlösen. Eine verquerte Form von emotionslosem Mitleid, welche einige der Zelothim antreibt.
Ein Zelot widmet sein Leben dem Gebet und der Vernichtung der falschen Ordnung der Neuen (oder auch Geringeren) Götter. Er plant all das, was mächtig ist in der Welt, umzustürzen. Dazu gehören nicht nur Herrscher, sondern auch reiche Händler oder einflussreiche Institutionen. Sie kämpfen aber auch gegen abstrakte Konzepte wie Liebe, Hoffnung oder Mitleid, die ihnen von frühester Kindheit an nur Qual beschert haben. Oft greifen die Zelothim scheinbar willkürlich in das Leben einzelner Menschen ein, um sie ohne erkennbaren Grund in größtes Unheil und Leid zu stoßen. Es bleibt ungewiss, ob sie einfach die Verachtung gegenüber allem, was existiert, zum Ausdruck bringen, oder einen Plan ihres Gottes Amazth verfolgen, oder ob gar beides der Fall ist.
Solange noch nicht genug von Amazth‘ Erleuchtung auf seinen Geist einwirkt, um die ersehnte Erlösung zu finden, setzt sich ein Zelot notgedrungen mit der sündigen materiellen Welt auseinander, schließlich muss er sich kleiden, ernähren und eine Wohnstatt sein Eigen nennen. Manche Zelothim begehen abscheuliche Verbrechen und beschaffen sich durch sie Geld und Sklaven. Andere werden zu Raubmördern, welche wohlhabende Familien mit derselben Selbstverständlichkeit umbringen, mit der andere einen Apfel vom Baum pflücken. Wieder andere bauen Verbrechernetzwerke auf und verkaufen Drogen, Sklaven und Gifte. Die meisten jedoch verdingen sich als Söldner für genau jene reichen und mächtigen Herren, die sie in Wahrheit auszulöschen trachten. Einige Fürsten gehen das Risiko ein und erlaubten den Zelothim das Leben in ihrer Stadt, erhoffen sie sich doch als Gegenleistung für die Duldung die Dienste der Meister der Schwarzen Künste. Tatsächlich sind die Zelothim gerne bereit, ihre Magie anzubieten, aber es wäre naiv zu glauben, dass die Weltverächter irgendjemandem oder irgendetwas in der materiellen Welt Loyalität entgegenbringen würden. Diese kennen sie nur gegenüber Amazth und gegenüber Al’Hrastor, welcher ihnen als Gottes Stellvertreter auf Deren gilt.
Diese Rolle annehmend, unterstellte der neue Stadtfürst von Yal-Mordai den Orden seinem eigenen Befehl und verfügte von nun an über ein Machtinstrument, das die Amazäer und die Amazth-Priesterschaft gleichermaßen herausforderte. Seinem „verstorbenen“ „Vater“ hatte kein auch nur im Ansatz vergleichbares Instrumentarium zur Sicherung seiner Interessen zur Verfügung gestanden. Deshalb hatte er sich in viel stärkerem Maße mit den Belangen der Amazth-Priester und ihrer Wesire sowie der Amazäer arrangieren müssen.
Al’Hrastor gab sich als unterwürfiger und demütiger Diener Amazths, dessen Orden allein dem Ruhme Gottes diene und das Andenken seines Vaters ehren solle. Zugleich überzogen die Zelothim Amazäer und Priesterschaft nebst deren Wesiren mit einem harten, zunehmend gnadenloser werdenden Machtkampf, um die Interessen durchzusetzen, von denen Al’Hrastor energisch leugnete, dass es die seinen seien.
Suliman, noch immer voller Trauer und Schmerz aufgrund des vermeintlichen Todes der vermeintlichen Mayla, hatte die Lehren der Zelothim exakt nach den Vorstellungen Hrastors formuliert. Fußend auf der Lehre, die Welt sei von bösartigen Göttern geformt worden, um die Sterblichen schutzlos in das Haifischbecken einer umkämpften Welt voller Qual zu stoßen, verfolgten die Zelothim das Ziel, die dort gefangenen Seelen zu befreien und sie in die reine Welt der Seele zu führen. Zu diesem Zweck, so die Überzeugung der Zelothim, müssten sie die hinterhältigen Götter bekämpfen, die so taten, als würden sie das Leben der Sterblichen angenehmer gestalten wollen, während sie in Wahrheit doch nur als ihre Gefängniswärter fungierten. Durch spirituelle Einsicht in die Gesetze der körperlichen Welt könne der Geist eines Sterblichen die Schranken des Leibes überwinden und in immer höhere Sphären des Seins aufsteigen. Amazth sei eine Mittlergestalt, welche den Seelen der Menschen den Übergang zwischen den Sphären ermögliche. Aber auch dies sei nur ein Provisorium, ein Übergangsstadium. Ziel des Bemühens der Zelothim müsse es sein, die körperliche Welt vollkommen zu zerstören, um – der leidhaften materiellen Existenz entkleidet – eins zu werden mit der Allwissenheit des Amazth.
Der fanatische, in der Tradition der Kophtanim stehende Beschwörerkult hatte Leid, Vernichtung und Zerstörung zu den Werkzeugen seiner nihilistischen Ideologie erhoben. Nach seiner Überzeugung war Amazth der einzige Unsterbliche, der auf ihrer Seite stand und ein echtes Interesse an der Befreiung der Sterblichen hatte. Es galt, ihm zuzuarbeiten, seine Macht und seinen Ruhm zu mehren, damit er seine getreuen Diener dabei unterstützen konnte, die Mauern der Welt einzureißen und die sterbliche Strafgefangenschaft zu beenden.
Nach der Offenbarungslegende der Zelothim hat Amazth die Sanskitaren erwählt, ihm bei der Verwirklichung dieses Ziel behilflich zu sein:
„Amazth kam vor vielen Jahrhunderten in Menschengestalt in die Stadt Ribukan, um den Menschen das Wissen über ihren gefesselten Zustand zu bringen. Doch die ignoranten Menschenkinder nahmen ihn wegen seiner ketzerischen Behauptungen gefangen und versuchten, ihn in der Blutsee zu ertränken, ihn mit einer Axt zu köpfen, ihn auf dem Scheiterhaufen zu verbrennen, ihn zu erwürgen, ihn lebendig zu begraben, und schließlich, ihn nackt in den kalten Norden zu verjagen, wo er erfrieren möge. Aber alle ihre Bemühungen waren vergebens. Stets erschien Amazth von Neuem, und als er sah, dass sein Werk getan war, richtete er seine Rede an das Volk der Sanskitaren: ‘Die wogenden Elemente haben keine Macht über mich, denn ich habe sie erkannt. Die Gezeiten des Geistes haben keine Macht über mich, denn ich habe sie erkannt. Die Gebote der Seele haben keine Macht mehr über mich, denn ich habe sie erkannt. Vor aller Zeit sah ich den Kosmos, und ich kehrte sein Innerste nach außen und das Unterste zuoberst. Ich stieg durch die Sphären hinab, um euch die Namen der stofflichen Dinge zu nennen. Wer Ohren hat, der höre! Wer mich suche, der folge mir nach!’ Mit diesen Worten verschwand Amazth, ohne je wieder auf Dere gesehen zu werden.“
Für den einzelnen Zeloten bedeutet dies, dass er einige Jahre im Dienste Amazth leben muss, um die „Aspekte“ der diesseitigen Welt zu durchschauen. Danach kann seine Seele sich daran begeben, den Weg zu Amazth anzutreten. Nach der zelotischen Lehre gibt es Sieben Kreise der Erlösung, in der sich die Seele mit je einem der sieben übriggebliebenen „Aspekte“ des Einen Gottes auseinandersetzen muss. Im Siebten Kreis schließlich ist die Seele bei den Alten Göttern angekommen und so weit von materiellen Fesseln gereinigt, dass sie als Mosaikstein im Namen des Urvaters dienen kann. Ein solcher Mitbruder wird von den Zelothim als „Gnadenreicher“ verehrt. Sein Urteil ist Gesetz in der Gemeinschaft.
Doch bereits der Vierte Kreis der Erlösung gilt als eine wichtige Wendemarke auf dem Weg zu Amazth. Er wird als „Scheitel“ bezeichnet, ab dem ein Diener des Amazth bereits mehr der jenseitigen Domäne des Sultans der Ewigkeit als dem verdorbenen Reich des Namenlosen angehört.
Rund zehn Jahre nach der Gründung ihres Ordens hatten Al’Hrastors Zelothim soviel Macht in Yal-Mordai erlangt, dass sich Amazäer und Amazth-Kult widerwillig, aber unausweichlich dem Befehl des Stadtfürsten beugen mussten, der noch immer vorgab, mit alledem nichts zu tun zu haben und lediglich ein demütiger Diener der Gottheit zu sein.
Die unbestreitbare magische Macht sicherte den Zelothim zähneknirschenden Respekt unter den Sanskitaren. Der Kult fächerte sich bald in verschiedene Bruderschaften auf, von denen die meisten rasch zu großem Reichtum kamen, weil ruchlose Machthaber ihre Dienste in Anspruch nahmen und bereit waren, nahezu jeden Preis zu zahlen, um ihre Feinde besiegen zu können. Mit der Organisation in Bruderschaften schützen die Zelothim zudem ihr Wissen vor neugierigen Augen und wappnen sich ein Stückweit gegen die Willkür der vorherrschenden Staatsgewalt. Manche Bruderschaften unterhalten gar mehrere geheime Zirkel in verschiedenen Metropolen des Rieslands. Dabei unterscheiden sich die Riten, die inneren Hierarchien und auch die Art der Hinwendung zur arkanen Kunst von Zirkel zu Zirkel mitunter gewaltig. Die Zelothim sehen sich als die einzig legitimen Erben der Wahrheiten von Xamoth und im Hexersultan von Yal-Mordai einen Wandler in den Hallen Amazth’. Ihr Haupthaus ist am großen Heiligtum Sach A’rdm zu finden, und hat so direkten Zugang zur Sternengrube und dem Spiegelthron Amazth’.
Der besondere Erfolg zelothischer Zauberei liegt darin begründet, dass sie in einer Welt der unberechenbaren magischen Ströme scheinbar sorgenfrei und problemlos zaubern können, auch ohne Effekte der Kritischen Essenz auszulösen. Alle Zaubertraditionen Rakshazars kennen Mittel und Wege, Effekte der Kritischen Essenz zu drosseln, doch die diesbezüglichen Fähigkeiten der Zelothim sind so weitreichend wie die keiner anderen Zaubertradition. Dies mag damit zu tun haben, dass ihre Magie dämonischer Herkunft ist und somit weniger heftig mit den diesseitigen Kraftlinien interagiert. Auch kennen die Zelothim einen der Entrückung ähnlichen Zustand der Trance. Amazth gewährt ihnen Magie und schützt sie vor den schlimmsten Auswirkungen, greift dafür aber ihren Verstand an, immerhin ist er der Herr des Irrsinns. Für die Zelothim erscheint dieser Effekt erstrebenswert, glauben sie doch, dadurch von ihrem Gott erleuchtet zu werden. Der Hauptgrund liegt aber in ihrer Kenntnis der Wahren Namen. Dieser Begriff ist vieldeutig und nur eine von unzähligen Übersetzungsmöglichkeiten des aus dem Zhayad, der heiligen Sprache der Zelothim stammenden Wortes Xama. Xama bezeichnet das vollkommene Wissen über die Beschaffenheit eines Objektes, welches es erlaubt, dieses Objekt allein mit Hilfe seiner Gedanken nach eigenem Gutdünken zu manipulieren. Das Xama kann nicht durch Studium der weltlichen Eigenschaften eines Objekts entschlüsselt werden. Man erlangt es nur durch Offenbarung seitens eines höheren Wesens. In den Augen der Zelothim müssen sie sich somit an die personifizierte Allwissenheit wenden und um ihre Gunst und Gnade bitten: Amazth.
Amazth und der Namenlose, Schöpfungmythos der Zelothim
Während die übrigen Amazäer die bösartigen Götter für die leidvolle und abstoßende Schöpfung verantwortlich machen, beschreibt die Schöpfungslegende der Zelothim Amazth‘ als Schöpfer der Welt. Doch sei er durch eine Mordtat seitens des Gottes ohne Namen dazu gezwungen worden, weil er ohne die Erschaffung der Welt die Sterblichen nicht zur Allwissenheit führen könnte. Amazth sei selbst gar nicht in der Lage gewesen, etwas so Schreckliches wie den Weltenbau aus eigener Kraft zu verrichten. Er habe sich vielmehr der (einstigen) (All-)Macht des Namenlosen Gottes bedienen müssen. Auch sei er nicht für das Leid und das Grauen verantwortlich. Dieses werde von den Geringeren Göttern geformt, den Diener des Namenlosen. Die Legende unterstreicht die ewige Feindschaft zwischen Amazeroth und dem Gott ohne Namen, welche die Zauberkundigen verpflichte, sich für eine Seite zu entscheiden, und ihnen nahelegt, die Seite Amazths zu wählen, der die Sterblichen von ihrem Leid erlösen wolle, statt sie darin zu fesseln.
In einer Zeit vor der Zeit existierte Der Eine Gott, auch Sultan der Ewigkeit genannt. Er war vollkommen und unendlich. Er brachte acht Kinder hervor, die mit ihm eines Namens (Xama) waren und seinen göttlichen Eigenschaften Gestalt verliehen: Allwissenheit (Amazth), vollkommene Schönheit (Asaphal), vollkommene Gerechtigkeit (Blak’hor), vollkommener Mut (Xaraphal), vollkommene Güte (Avaphal), Allgegenwärtigkeit (Lol‘gor), vollkommenes Glück (Xolophal), Unsterblichkeit (Targuniphal) und Allmacht. Diese neun wurden die Alten Götter genannt, denn andere folgten ihnen nach, von denen später berichtet werden wird.
Der neunte unter den Alten Göttern, genannt Allmacht, erhob sich wider seinen Vater, den Sultan, und erschlug ihn, um an seiner statt vollkommen und unendlich zu sein. Denn die Allmacht konnte nicht dulden, durch die Anwesenheit des Vaters beschränkt zu werden. Als der Sultan im Sterben lag, war sein Name dem Vergessen geweiht. Da jedoch sein Mörder eines Namens war mit seinem Vater, schwanden auch sein Name und die der anderen acht Kinder zusehends. Es wurden die Kinder des Einen schwächer, und so war die Zeit geboren, deren letztes Maß das Fortschreiten des Sterbens der Alten Götter ist.
Die Allmacht trachtete danach, ein Gefäß für ihren Namen zu bauen. Sie wandte sich an Amazth, die Allwissenheit: „Sage mir, wie ich ein Behältnis schaffen kann, um meinen Namen vor dem sicheren Untergang zu bewahren?“ Amazth lächelte und sagte: „Gib mir ein Stück deiner Allmacht und gib mir deinen Namen, so will ich ein Haus für ihn bauen.“ Die Allmacht tat wie ihr geheißen. Sie gab ihren Namen und ein Stück seiner Allmacht. Den Gott, welcher nun namenlos war, befiel deshalb eine Lähmung, und er fiel in Ohnmacht. Amazth nahm den Namen des Namenlosen Gottes und schuf aus ihm die Welt, mitsamt allen Geringeren Göttern, die abergläubische Menschen anstelle der Alten Götter verehren. Doch er nahm auch den Namen des toten Allvaters, an den er sich als Allwissenheit vollständig erinnerte, und versteckte ihn hinter dem Namen des Namenlosen Gottes. Damit begann der ewige Kreislauf des Lebens und Leidens und Sterbens der Sterblichen. Und obwohl Amazth ihn selbst erschaffen hat, trachtet er seither danach, ihn zu durchbrechen, um die Sterblichen von dem Schicksal zu befreien, das die Tat des Gottes ohne Namen ihnen aufgebürdet hat.
Als der Namenlose sein Auge auftat, weil sein Name gesichert war, sprach er: „Kraftlos bin ich nun, nicht Allmacht kann ich mehr heißen. Doch solange diese Welt existiert, werde ich als einziger leben, während meine Geschwister dem Tode anheimfallen müssen.“ „Triumphiere nicht zu früh, denn der Name unseres Vaters ist verborgen in der Welt, die ich aus dir schuf. Sein Name wird in der Welt erwachen und sich in meinem Schoß sammeln. Menschliche Seelen sind die Teile seines Namens. Die Seelen werden mit Hilfe der Magie, die durch den Namenssplitter des Sultans entsteht, aufsteigen durch die Sphären deiner Welt. Unser Vater wird wieder leben, während du für immer in der Welt, die ich für dich schuf, gebunden sein wirst!“ Da verfluchte der Namenlose Gott die Welt und wies die Geringeren Götter, welche ihm zu Diensten sein mussten, weil die Welt aus seiner Substanz geschaffen worden war, an, die Sterblichen zu schwächen und ihnen ihre magische Kraft zu rauben. So kommt es, dass nur wenige das Wort des Vaters in sich tragen und zu Amazth‘ Schoß aufsteigen können. Jeder magiebegabte Sterbliche muss sich nun entscheiden, ob er seine Seele dem Tyrannen ohne Namen widmet, der über diese Welt herrscht, oder Amazth, der als einziger das Bruchstück des Wahren Namens des Sultans der Ewigkeit befreien kann und eines Tages den Namen des Namenlosen mitsamt der Welt, die aus ihm geformt ist, zerschmettern wird, um die Sterblichen aus ihrer Drangsal zu erlösen.
Der Namenlose stirbt nicht, weil sein Name nicht vernichtet worden ist. Er ist in materieller Form gerettet worden – aus diesem Grund hat er die Erschaffung der Welt in Auftrag gegeben, wobei er das Leid der Sterblichen, die in ihr leben müssen, billigend in Kauf nimmt. Durch die Trennung von seinem Namen wird er aber ohnmächtig, weil seine charakterstische Eigenschaft (sein Wahrer Name), die Allmacht also, nicht mehr bei ihm ist. Da die materielle Welt aus der Substanz des Gottes ohne Namen geformt ist, hat der Namenlose aber immerhin die Macht über die zweite Göttergeneration, welche diese materielle Welt unterwirft. Die Welt wird also durch den Namenlosen beherrscht, die Geringeren Götter sind seine Handlanger, welche die Exekutive seiner ungerechten Herrschaft darstellen. Die Macht des Namenlosen ist demnach nicht verloren, sie ist aber „indirekt“ geworden. Amazth brauchte für die Erschaffung der Welt die Allmacht des Namenlosen, denn die Allwissenheit selber hat keine Schöpfungs-, nur Erkenntniskraft. Amazth‘ Ziel besteht schlussendlich darin, den Namen des Sultans der Ewigkeit vom Namen des Namenlosen zu befreien. Dazu muss die Allmacht des Namenlosen, die in seinem Namen ruht, auf den Namen des Sultans übertragen werden, der dadurch sein Leben zurückgewinnt. Nachdem dies geschehen ist, können der Name des Sultans und der Name des Namenlosen anders als zuvor klar unterschieden werden. Amazth will dann den Namen des Namenlosen zerschmettern, wodurch die materielle Welt vernichtet wird. Die Sterblichen werden dadurch zur Vollkommenheit geführt. Der Name des Sultans ist weiterhin eins mit dem Namen des Amazth, sodass die Sterblichen, befreit vom Joch und den Fesseln der materiellen Welt, Allwissenheit erlangen. Der Weg über die Leiden der materiellen Welt ist zur Erreichung dieses Ziels unvermeidbar, denn solange der Name des Sultans, der Name des Namenlosen und der Name Amazth eins sind, lässt sich das Ziel, das Böse zu zerstören, nicht erreichen, ohne dass auch Amazth‘ Allwissenheit schwindet. Die Zauberkundigen können jedoch helfen, die Namen unterscheidbar zu machen, sodass sie getrennt voneinander behandelt werden können, indem sie sich für Amazth entscheiden und mit ihren Taten seine Sache fördern.
Das Sphärenmodell der Zelothim
Für den Zeloten sind die Welt und mit ihr die Sterblichen in drei übereinander schwebende Sphären eingeteilt: Leib, Temperament und Göttlichkeit. Der Leib ist die träge Substanz, welche durch den Antrieb des Temperaments zu allerlei Taten angeregt wird. Die Göttlichkeit schließlich stellt die Gesamtheit der Tugenden dar, die ein Sterblicher sein Eigen nennt.
Jede dieser drei Sphären stellen sich die Zelothim als eine Kugel vor, die aus einem unteren, einem vermischten und einem oberen, reinen Teil besteht, so dass sich insgesamt neun Bereiche ergeben. Die Reinheit des oberen Teils entsteht durch das Licht Amazths, welches von oben scheint und eine Seite der Sphäre erhellt. Jede Sphäre enthält sechs sogenannte Aspekte, die in der Schattenseite miteinander verwoben sind, sich sogar bekämpfen und viele Einzelobjekte hervorbringen. Auf der Lichtseite sind die Aspekte durch Amazth‘ Erkenntnis klar voneinander getrennt und so der menschlichen Erkenntnis zugänglich.
Die unterste Sphäre heißt Leib oder Materie. Ihre Schattenseite ist die Welt, die sich unseren Augen zeigt und Dere genannt wird. Hier sind die Elemente in jedem einzelnen Ding miteinander verbunden. Die Lichtseite ist das Reich der sechs reinen Elemente Humus, Erz, Feuer, Luft, Wasser und Eis. Dort existieren keine Einzeldinge mehr, sondern nur noch die allgemeinen Prinzipien der Elemente. Das siebente Element, die Kraft, ist gleichermaßen materiell wie körperlos. Deshalb bildet es den Übergang zur zweiten Sphäre, der Sphäre der Temperamente.
Wut, Feigheit, Herrschsucht, Nachgiebigkeit, Faulheit und Wahnsinn sind die Aspekte der Sphäre der Temperamente. Sie treiben in der Geisteskunde der Zelothim die Sterblichen zu Taten. Auf der Schattenseite fristen die Totengeister der Menschen nach dem Vergehen des Körpers ihr Dasein. Auf der Lichtseite sind die Bestandteile des Geistes getrennt und bilden das Reich der sechs reinen Temperamente. Auch hier gibt es ein Temperament, das in die höhere Sphäre hinausweist. Dabei handelt es sich um den Wissensdurst. Es existiert aber auch ein gegenläufiges Temperament: Die Triebhaftigkeit führt wieder hinab zur körperlichen Sphäre.
Die höchste Sphäre ist die Domäne der Göttlichen. Auf der Schattenseite leben die neuen Götter, die vom Namenlosen eingesetzt worden sind und während seines Schlafes die Welt verwalten, in welcher sein Name verborgen liegt. Auf der Lichtseite, direkt unter Amazth‘ allwissendem Auge, winden sich die Alten Götter im Sterben, durch den Tod ihres Vaters von Agonie verzehrt. Hier erwarten sie sehnsüchtig die Ankunft der Seelen der Menschen, die einen Teil des Namens des Vaters darstellen. Die Aspekte dieser Sphäre sind die Eigenschaften, welche die Alten Götter früher als Teil des Sultans der Ewigkeit innehatten: Schönheit, Gerechtigkeit, Güte, Allgegenwärtigkeit, Unsterblichkeit und Freude. Hier in der obersten Sphäre sind also alle Eigenschaften in Vollkommenheit verwirklicht, denen der Zelot auf Dere entsagen muss. Amazth selbst steht nicht außerhalb der Sphären, sondern ist mitsamt seinen Geschwistern an die oberste Sphäre gebunden. Dennoch erhellt seine Erkenntnis alle Sphären, denn als Erbauer dieser Welt ist er der einzige, der die Schöpfung vollkommen versteht. Deshalb kann auch nur er die wahren Namen aller Dinge seinen Anhängern vermitteln. Die Sterblichen allein könnten dieses Geheimnis niemals ohne Hilfe in Erfahrung bringen, sind sie doch nur winzige und unbedeutende Bestandteile der Welt. Auch in der Dritten Sphäre existiert ein absteigender Aspekt, der vom Göttlichen zu den Temperamenten hinabführt. Das schwer übersetzbare Wort Nay’rakoth wird meist mit „Liebe“ oder „Mitgefühl“ bezeichnet. Allgemein ist damit eine freundschaftliche Haltung zur Welt und ihren Geschöpfen gemeint.
Der Zelot muss innerhalb einer Sphäre von der Schattenseite in die Lichtseite treten, um von dieser aus die jeweilige Sphäre hinter sich zu lassen und zur nächsten Sphäre aufzusteigen. In jeder Sphäre leben sechs Archonten. Sie verkörpern jeweils einen Aspekt der Sphäre und wollen gemeinsam den Übertritt des Zeloten von der Schattenseite einer Sphäre in ihre Lichtseite verhindern. In der obersten Sphäre sind es allerdings nicht – wie ein Unwissender vermuten könnte – die Neuen Götter selbst, die diese Aufgabe wahrnehmen, sondern je ein kriegerisches Wesen, das einem der Neuen Götter untergeordnet ist und dessen Aufgabe normalerweise darin besteht, den entsprechenden Alten Gott, dem sein Herr entgegensteht, zu bewachen. In der Ikonographie sind diese obersten Archonten als drachenartige Ungeheuer dargestellt und tragen den Namen „Hohe Wächter der letzten Schwelle„. Ein Zelot muss auf seinem Weg in die Lichtseite einer Sphäre mindestens einen Aspekt der Sphäre durchschreiten und den entsprechenden Archonten besiegen. Wenn er sich Zugang zur Lichtseite einer Sphäre geschaffen hat, vermag der Zelot diesen Aspekt von nun an durch Visionsreisen direkt zu betreten und dort die sogenannten wahren Namen der Dinge lernen, die der Archont des jeweiligen Aspekts normalerweise geheim hält. Ein Zelot, der einen Archonten besiegt hat, wird als Initiat des entsprechenden Aspekts bezeichnet. Nur die mächtigsten Zeloten können von sich behaupten, mehr als drei Archonten besiegt zu haben und damit in mehr als drei Aspekten initiiert zu sein. Von der Lichtseite einer Sphäre kann der Übergang in die nächste Sphäre erfolgen, wobei auch hier Archonten eine Rolle spielen, ein freundlich gesinnter, der auf Seiten Amazth’ steht, und ein böswilliger, der die Seele des Zeloten wieder hinabstoßen will. In die zweite Sphäre hilft der Archont der Kraft hinauf, sein Gegner ist der Archont der Triebhaftigkeit. In die dritte Sphäre steht der Archont des Wissensdursts den Wanderern bei, während der Archont des Mitleids die Seele hinabstößt.
Die Aspekte, welche diese vier Übergangsarchonten verkörpern, haben andere Eigenschaften als die Aspekte der Sphären. Die beiden hilfreichen Aspekte werden von den Archonten freiwillig offengelegt, sodass jeder Zelot sie lernen kann, sofern für ihn der Zeitpunkt des Übergangs gekommen ist. Die feindlichen Übergangsaspekte sind für die Zeloten hingegen verboten, da sie eine zu große Gefahr darstellen. Aber die Einflüsterungen der beiden Archonten „Triebhaftigkeit“ und „Mitleid“ sind stark. Einige Zelothim erliegen ihren Versuchungen und stürzen so auf ihrer Reise ab.
Das Wissen, tatsächlich durch die Sphären zu reisen, ist allerdings auch bei den Zeloten kaum bekannt, so dass der Kampf in ritualisierter und symbolischer Form auf Dere ausgefochten wird. Dennoch ist die Gefahr dieser Kämpfe gegen die Archonten real. Viele Anwärter scheitern dabei, was sie in den meisten Fällen umbringt.
Magieanwendung
Die Zelothim stellen gewissermaßen das rakshazarische Gegenstück zum aventurischen Gildenmagier da. Ihre Magie funktioniert durch sehr schnelle Spruchzauber. Okkulte Wissenschaftstheorien ermöglichen es ihnen, mit Leichtigkeit fremde arkane Effekte zu erlernen oder zumindest nachzuempfinden. Trotz allem scheint die Kritische Essenz ihnen wenig anzuhaben. Tatsächlich baut ihre Magie auf gezielter Nutzung dämonischer Essenzen auf. Materielle Kritische-Essenz-Effekte werden lediglich durch das Wirken Amaths umgangen, dafür aber mit magischen Wahn, Verwirrung und das zunehmende Aufsteigen in die Kreise der Verdammnis bezahlt. Dies aber ist, mit Ausnahme von Amath selbst, seinem Diener Hrastor und dem Hexersultan Al’Hrastor niemandem bekannt …
Die Zelothim stellen gewissermaßen das rakshazarische Gegenstück zum aventurischen Gildenmagier da. Ihre Magie funktioniert durch sehr schnelle Spruchzauber. Okkulte Wissenschaftstheorien ermöglichen es ihnen, mit Leichtigkeit fremde arkane Effekte zu erlernen oder zumindest nachzuempfinden. Trotz allem scheint die Kritische Essenz ihnen wenig anzuhaben. Tatsächlich baut ihre Magie auf gezielter Nutzung dämonischer Essenzen auf. Materielle Kritische-Essenz-Effekte werden lediglich durch das Wirken Amaths umgangen, dafür aber mit magischen Wahn, Verwirrung und das zunehmende Aufsteigen in die Kreise der Verdammnis bezahlt. Dies aber ist, mit Ausnahme von Amath selbst, seinem Diener Hrastor und dem Hexersultan Al’Hrastor niemandem bekannt …
Utopia
Hrastor drängte Suliman dazu, endlich einen Pakt mit Amazth zu schließen, um in der Gunst der Gottheit aufzusteigen, doch dazu konnte Al’Hrastor sich nicht durchringen. Seine Trauer über Maylas Tod war längst abgeklungen, und mittlerweile gefiel er sich in der Rolle des Gentleman-Tyrannen, welcher dem Volk den frommen Diener der Gottheit vorspielte, während seine Untergebenen den Willen seiner Konkurrenten brachen und sie seinem Befehl unterstellten. Seine Lebensfreude war zurückgekehrt, und der Glaube an die fanatische, das Dasein selbst verachtete Philosophie des Ordens, den er selbst gestiftet hatte, erschien ihm jetzt wie der fremdartige Schatten einer schlimmen, doch zum Glück überwundenen Zeit, an die er sich nicht gern erinnerte. Sich von den Zelothim distanzieren konnte er trotzdem nicht, denn ihr Einfluss war es, auf dem seine Herrschaft zu einem ganz wesentlichen Teil fußte.
664 BF, kurz nach Al’Hrastors vierzigstem Geburtstag, kehrte Merclador, der befunden hatte, dass es an der Zeit sei, die nächste Phase seines Plans einzuleiten, in das Leben des Stadtfürsten zurück. Diesmal hatte er sich eine Tarnidentität namens Kanan ibn Darim erschaffen, ein reicher Patrizier, welcher der Stadt Yal-Mordai jedes Jahr große Summen spendete, um prunkvolle Bauwerke errichten oder vorhandene aufwändig restaurieren zu können. Den Zelothim war dies ein Dorn im Auge, da nach ihrer Weltsicht derische Bauwerke den Hochmut der Menschen verkörperten. Sie bemühten sich beim Stadtfürsten um ein Verbot des Neubaus oder auch nur der bloßen Instandsetzung von Gebäuden, während sie zugleich gegen die Besitzungen ihrer politischen Gegner immer wieder mutwilligen Vandalismus übten. Wenn es schon das Ziel war, die Welt und ihre Ordnung zu zerstören, war es nicht hilfreich, sie aufzubauen und ihr Struktur zu verleihen. Unglücklicherweise, wie die Zelothim fanden, konnten sie nicht gegen Kanan ibn Darim vorgehen, weil der Patrizier auch ihrem eigenen Orden gewaltige Summen spendete. Angesichts von Mercladors Macht wäre ihnen der Versuch auch schlecht bekommen, allerdings wäre in diesem Fall die Tarnung des Drachendämons aufgeflogen.
Der Reichtum des vermeintlich aus Ribukan zugezogenen Grundbesitzers stammte angeblich aus Erbschaft, Handel mit den Nagah und Glück bei der Finanzierung von Schatzsuchern, welche mit großen Reichtümern heimkehrten. Die Sache mit der Schatzsuche war dabei nur teilweise gelogen, denn tatsächlich setzte Merclador das Vermögen ein, das er in seiner Identität als Mayla durch die Schatzfunde in den alten marhynianischen Bauten erworben hatte. Wie der Drachendämon es vorausgesehen hatte, berief Al’Hrastor ihn zur Belohnung für seine unermüdliche Spendenbereitschaft als Berater an seinen Hof. Dort hintertrieb er so gut er es vermochte die zelothische Ideologie.
Sein neuer Berater sprach mit Al’Hrastor über seine Idee, Yal-Mordai zu einer gewaltigen, blühenden Metropole auszubauen, eine Stadt, die Hunderttausenden, wenn nicht Millionen von Sterblichen Platz bieten und den Ruhm ihres Stadtgottes und ihres Fürsten in ungeahnte Dimensionen treiben würde. Suliman ließ sich von der Begeisterung anstecken. Nächtelang brüteten der Stadtfürst, Kanan und einige der besten Architekten der Sanskitarischen Stadtstaaten über Pläne zum Aus- und Umbau der Stadt. Eine schneeweiße Stadt sollte entstehen, geprägt von dem weißen Sandstein der Region und von Marmor, welchen die Ipexco liefern konnten, durchzogen von Bäumen und blühenden Blumen, welche die Siedlung in die Natur einbetteten und sie als natürlichen Teil der Landschaft erscheinen ließen. Yal-Mordai sollte auf diese Weise ein Zentrum der Seefahrt und des Handels, der Fischerei und des Handwerks, der Landwirtschaft und der Kunst werden.
Im Zentrum der Überlegungen für den Ausbau Yal-Mordais standen die „Keshals“, wie die Einwohner der Stadt die enormen Marhynianerbauten nennen. In den Augen der Zelothim hatten sie sich wie Ungeziefer dort eingenistet, wie Ratten, die ein der Ewigkeit überlassenes Heiligtums Amazths eingedrungen waren, es mit ihrer unwürdigen Präsenz überschwemmten und es doch nicht schafften, es zu entweihen und ihm seine Würde ganz zu nehmen. Neunzehn der riesigen, trapezoiden Steinkolosse bilden das Zentrum der Stadt. An ihre gewaltigen Mauern hatten die Yal-Mordaier Lehmziegelhäuser und gewagte Holzkonstruktionen auf mehreren Ebenen übereinander gebaut, die durch simple Aufzüge und Strickleitern miteinander verbunden waren. Zwischen den Keshals führen breite Alleen zu weiten Plätzen, in deren Zentren merkwürdig geknickte Stelen und vieleckige Säulen steinerne Labyrinthgärten bilden. Im Schutz dieser Stelen-Labyrinthe leben die ärmeren Yal-Mordaier, die sich keinen Platz an oder gar in den Keshals erkämpfen konnten. Umgeben ist die Siedlung von einer Stadtmauer, die ebenfalls aus imperialen Zeiten stammt. Sie besteht aus wenigen, dafür aber umso imposanteren Marhynianerwehrtürmen, welche in verschiedenen Epochen durch Mauern miteinander verbunden wurden und am besten als ein gewaltiges, architektonisches Flickwerk beschrieben werden konnten. Einige Stellen würden kaum die ersten Tage einer ernsthaften Belagerung überstehen, aber beeindruckend ist die Wehranlage allemal.
Zwischen Keshals und Stadtmauern befand sich eine Menge freier Raum. Mauerreste und halb verfallene Kellergewölbe legten Zeugnis davon ab, dass auch hier zu Zeiten der vergangenen Hochkultur weiteren Keshals gestanden haben mussten, die seit vielen hunderten von Jahren verfallen waren. Hier würden schneeweiße Tempelanlagen, ein weitläufiger Hafen mit zahlreichen Lagerhäusern, gemütliche Wohngebäude, Schulen, Handwerker- und Händlerviertel, eine Arena, ein Bestienmeisterareal, weitläufige Parks und Gärten, ein Vergnügungs- und Erholungsgebiet, begrünte Alleen, Brunnen, Statuen und Bogengänge entstehen, aber auch Kasernen und eine Kriegerakademie.
Der fertige Plan zeigte ein wahrhaftiges Utopia, schöner und größer als Marhynia, die einstige Hauptstadt des Rieslands. Eine Millionenmetropole, die sich nicht einmal hinter den Städten der untergegangenen Hochkultur verstecken musste. Eine, die die Brokthar-Siedlung Amhas, welche sich in ihrem Hochmut für den Nabel der bekannten Welt hielt, an Stolz und Macht erblassen ließ. Neues Zentrum des Rieslands, Nachfolgerin des verschollenen Marhynia. Doch mit jedem Gebäude, das Al’Hrastor tatsächlich in Auftrag gab, wuchsen der Zorn und der erbitterte Widerstand der Zelothim gegen die hochtrabenden Pläne, und umgekehrt Al’Hrastors Hass auf den von ihm gestifteten Orden, auf dem seine Macht beruhte.
Merclador wusste die aufgepeitschte Stimmung geschickt zu nutzen. Kanan ibn Darim gab sich als Diplomat und Friedensstifter, beschwichtigte hier, handelte da einen Kompromiss aus, besänftigte mit großzügigen Schenkungen, erkaufte die Bereitschaft, den einen Bau zu tolerieren, gegen die Aufgabe eines anderen Projekts.
Das geplante Utopia verblasste dadurch immer mehr, bis von den phantastischen Ideen, über denen Kanan und Al’Hrastor nächtelang gebrütet hatten, nur noch ein Schatten übriggeblieben war. Suliman war frustriert, voller Zorn und Hass. Und er erkannte, wem er das Scheitern dessen, was sein Vermächtnis, sein Lebenswerk hätte werden können, in Wahrheit zu verdanken hatte: Seinem Gott Amazth und seiner lebensverneinenden Philosophie.
Kanan tat versöhnlich, heizte in Wahrheit aber Al’Hrastors zornlodernde Stimmung weiter an. Schließlich warf er beiläufig ein, dass Suliman, würde er selbst auf Amazth‘ Thron sitzen und über das gesammelte Wissen der Welt herrschen, gewiss der bessere und weisere Herrscher wäre. Al’Hrastor wies diesen ketzerischen Gedanken weit von sich, aber von da an ließ er ihn nicht mehr los. Er verfolgte ihn in seine Überlegungen, ja, selbst bis in seine Träume.
Dies wiederum erschreckte ihn beinahe zu Tode, denn natürlich würde Amazth derlei frevlerische Ideen nicht dulden und ihn hart dafür bestrafen. In Augenblicken, wo ihn solche Gedanken übermannten, ergab er sich in tiefschwarzes Grübeln und zermürbende Verzweiflung, welche ihn zu verschlingen drohten. In solchen Momenten wünschte er nichts sehnlicher, als das Schicksal Deres zu besiegeln und dem Leiden der Welt ein Ende zu setzen.
Der Konflikt, ohne seine Zelothim machtlos zu sein, aber mit ihrer Macht seinen Willen nicht verwirklichen zu können, blieb ihm erhalten und nagte an seinem Geist. Er zermürbte ihn förmlich. Seine Stimmungsschwankungen, die von höchster Euphorie, in der er tatsächlich daran zu glauben begann, Amazth‘ vom Thron stürzen und die Welt in einen besseren Ort verwandeln zu können, und schier endloser Verzweiflung, in der er die Schöpfung lieber gestern als heute vernichtet hätte, begannen ihn in immer kürzeren Intervallen heimzusuchen und wechselten sich manchmal von einem Augenzwinkern zum nächsten ab.
Merclador wusste um die Ironie dessen, was er Al’Hrastor angetan hatte. Es war ein Konflikt, nicht weniger intensiv als jener, der einst Nandus in Hesinde und Amazeran gespalten hatte und den Alveraniar des Wissens in den Alveraniar des Verborgenen Wissen und den Alveraniar des Verbotenen Wissens. Nur war Al’Hrastor kein Unsterblicher und folglich auch nicht in der Lage, sich in zwei Wesenheiten zu spalten, um ihn aufzulösen.
Es kam, wie es kommen musste. Suliman wurde von dem unlösbaren Widerstreit seiner wirbelnden Gedanken, seinem zunehmenden Drang, die Welt auf einen Schlag vollkommen umzukrempeln, während er in Wahrheit vollkommen handlungsunfähig war, seinen zwischen Hass und Verzweiflung sturmlaufenden Gefühlen Schritt für Schritt in den Wahnsinn getrieben. Statt sich in zwei Personen zu spalten, waren es nun zwei, drei, vier oder mehr Persönlichkeiten, die aus ihm sprachen, wodurch es schien, dass er manchmal binnen Sekunden seine Meinung änderte und er urplötzlich das Gegenteil von dem befahl, was er zuvor befohlen hatte. Er stellte seine Untertanen damit vor unlösbare Probleme, und wenn sie hilflos an seiner Wirrnis scheiterten, ließ er sie nicht selten auf dem Scheiterhaufen hinrichten.
Merclador beschloss, die Reißleine zu ziehen. Einen stammelnden Idioten aus Al’Hrastor zu machen hatte er nicht beabsichtigt. Ein solcher würde ihm auch nichts mehr nützen können. Es galt, die Aufmerksamkeit des Stadtfürsten auf ein einzelnes Problem zu lenken, das seinen Intellekt herausforderte und das er vor allem lösen konnte. Dass Hrastor den Druck auf seinen vermeintlichen Sohn erhöhte, mit Amazth zu paktieren, kam ihm dabei recht gelegen.
Man schrieb das Jahr 681 BF. Al’Hrastor war inzwischen 57 Jahre alt. Hätte er sich entschließen können, mit Amazth zu paktieren, hätte er das Paktgeschenk der Alterslosigkeit wählen können, das bei einem solchen Kontrakt stets eine gute und günstige Wahl war und von Paktierern nur selten ausgelassen wurde. Doch von einem solchen Pakt war er weiter denn je entfernt, konnte sich Al’Hrastor doch nicht entscheiden, ob er sich Amazth vollkommen ergeben und die Vernichtung der Welt anstreben oder sich von ihm lossagen und ihn vom Thron stoßen sollte.
Kanan riet seinem Herrn, dass er sich Zeit verschaffen müsse, um diese Frage einer zufriedenstellenden Klärung zuführen zu können. Womöglich würden noch Jahrzehnte ins Land gehen, bis er die Antwort fand, und er würde in darüber ja nicht jünger werden. Al’Hrastor verstand. Es war an der Zeit, sich auf die Suche nach der Unsterblichkeit zu begeben. Eine, bei der er nicht auf Amazth‘ Gnade angewiesen war.
Amazeroth selbst sah sehr wohl, was seine Diener taten und wie sie gegeneinander intrigierten. Er schwieg. Ganz gleich, wer den Machtkampf gewinnen würde, am Ende würde nur einer davon profitieren. Er selbst.
Die Suche nach der Unsterblichkeit
Seit Rashtul al’Sheik den echsischen Glauben an die Göttin des Lebens Zsahh in die Glaubenswelt der Urtulamiden überführte, hatten die Tulamiden bei ihren Geweihten oft das Geheimnis der Unsterblichkeit vermutet. Dies ging auf Rashtul al’Sheiks langes Leben zurück und auf seine mutmaßliche Wiedergeburt als Kaiser Raul von Gareth. Und auf die Liturgie, welche den Geweihten der Tsa ewige Jugend schenkt, ohne jedoch ihr Leben zu verlängern. Auf die Legenden vom Quell des Lebens, dem die Heilung aller Wunden und Krankheiten und das Verleihen ewiger Jugend oder gar ewigen Lebens zugeschrieben werden, obwohl er vermutlich eher ein niemals versiegender Strom von Tsas eigener, lebensspendender Energie ist, von dem sie jedem Lebewesen einen Teil zur Verfügung stellt. Und natürlich auf die Quelle der Ewigen Jugend, einem mystischen Ort bei Khunchom im Mhanadi-Delta, dessen Geheimnis im Tempel des Lebens gehütet wird und der dem friedfertigen Pilger, welchem das Wissen um seine Lage offenbart wird, nachweislich Verjüngung zuteilwerden lässt.
Da Tsa einst eine echsische Gottheit war und die Echsen sich häuten, so wie es auch Tsa-Geweihte tun, welche die Liturgie zur Verjüngung wirken, vermutet man, dass die Echsen das Geheimnis der Unsterblichkeit und der ewigen Jugend kennen. Unter den Echsenvölkern des Rieslands schienen die Nagah die aussichtsreichsten Kandidaten zu sein, solcherlei Kenntnisse zu hüten, bewahrten sie doch in ihrer Schwarzen Pagode uraltes Geheimwissen auf und verbargen es vor den Augen der Welt. Al’Hrastor beschloss, ihnen dieses Wissen zu entreißen.
Suliman befahl Kanan ibn Darim, ihn zu begleiten. Der stimmte nach einigem Zögern zu – in Wahrheit hätte sich Merclador diese Reise um nichts auf der Welt entgehen lassen. Hrastor drängte darauf, dass Al’Hrastor auch einige Zelothim zu seinem Schutz mitnehmen sollte, doch der lehnte energisch ab. Suliman hatte genug Zeit in Rakshazar verbracht, um zu wissen, wie man mit den Nagah sprechen musste. Die Anwesenheit der fanatischen Zelothim mit ihrem Hass auf die Nagah-Götter würde die Auseinandersetzung mit den Schlangenleibigen unnötig verkomplizieren, wenn nicht gar unmöglich machen. Al’Hrastor wusste ja nicht einmal, wonach er genau suchte, die Zelothim würden zum Einsatz kommen, sollte er es in Erfahrung bringen und die Nagah sich weigern, es ihm zu geben.
Wie schon einmal machten sich Al’Hrastor und Merclador gemeinsam auf die Reise. Ihre erste Anlaufstelle war Ribukan am Gelben Meer, der östlichste der sanskitarischen Stadtstaaten. Die Stadt war in der außergewöhnlichen Position, umringt von den Nagah-Siedlungen zu existieren, und überlebte vor allem dadurch, dass es ihren Herrschern gelungen war, sich trotz des grundsätzlichen Misstrauens, das aufgrund der Feindschaft von Echsen und Menschen während der Pyrdacor-Zeit zwischen den beiden Völkern herrschte, mit den Nagah gutzustellen. Die Schlangenleibigen waren nie Pyrdacor-Diener gewesen. Ihre erste Besiedlungswelle war direkt von Lahmaria ins Riesland gereist, die zweite Welle war vor dem Goldenen geflohen. Die Verehrung der Göttin Hesinde teilten sich die beiden Völker, auch wenn sie sie unter unterschiedlichen Namen anbeteten. Die Sanskitaren Ribukans hatten nach einer langen Zeit der Vorbehalte begriffen, dass die Gründe, die ihre aventurisch-tulamidischen Vorfahren und die Echsen von Zze Tha zu Gegnern gemacht hatten, keinen Anlass boten, diese Feindseligkeit auf die Nagah zu übertragen. Auch die Schlangenleibigen hatten ihre Ressentiments, hatten aber die Vorteile des Handels mit der Menschensiedlung erkannt, welcher seit vielen hunderten von Jahren ihren Wohlstand mehrte.
Al’Hrastor hatte dafür gesorgt, dass der Rat der Schemenhaften, der in Ribukan ebenso vertreten war wie in den anderen Sanskitarischen Stadtstaaten, dem Stadtfürsten Ribukans seine Ankunft angekündigt hatte, verbunden mit der Bitte, kein großes Aufhebens darum zu machen, da Suliman plane, sich inkognito in der Stadt aufzuhalten.
Nichtsdestotrotz führte der Herrscher Yal-Mordais prächtige Geschenke mit sich, die er seinem Amtskollegen überreichte. Im Gegenzug gestattete dieser ihm die Nutzung der Palastbibliothek, in welcher sich Al’Hrastor ausgiebig über die Region und die in ihr vermuteten Geheimnisse informierte.
Besonders gefesselt war Suliman von den Legenden die untergegangene Nagah-Stadt Akorak betreffend. Er konnte sich sehr wohl zusammenreimen, warum die einstige Metropole der Schlangenleibigen von ihren Bewohnern so überstürzt aufgegeben und dann zerstört worden war. Der Zusammenhang mit dem Einschlag des Kometen Kataklys war evident. Offenbar waren die Einwohner der Stadt gewarnt gewesen und hatten ihr Zuhause schleunigst geräumt, bevor es ihnen um die Ohren flog. Viele ihrer Besitztümer und ihr gesammeltes Wissen mussten in der einstigen Nagah-Metropole zurückgeblieben sein.
Gewiss war Akorak auch ein weißer Fleck auf der Karte des Goldenen Netzes, die Suliman vor so vielen Jahren angefertigt hatte. Ein solcher Ort lag gewiss mindestens auf einem Nodix, wenn nicht gar auf einem Nexus von Kraftlinien. Alle Betrachtungen das Goldene Netz betreffend würden ohne die Erforschung der dortigen Kraftlinien unvollständig bleiben.
Als nächstes suchte Al’Hrastor die Akademie der Schatten auf, die einst durch Fran-Horas gegründete Magierakademie zu Ribukan mit den Schwerpunkten Antimagie und Anatomie einschließlich Heilungs- und Verwandlungsmagie, gelegen im Reichenviertel, ganz in der Nähe des Palastes. Die Schwesterschule der Akademie der Hohen Magie zu Punin hatte ebenfalls ein reges Interesse am Geheimwissen der Nagah entwickelt.
Tief verborgen in der Schwarzen Pagode von Angankor liegen uralte Texte, die von sage und schreibe sieben magischen Traditionen berichten, welche die Nagah angeblich einst beherrschten. Zwar liegen alle Nagah-Kulturen, auch die Dörfer der Sumpfländer, geographisch lediglich am Rande jener Zone, die von den chaotischen Astralströmen betroffen ist, dennoch gingen fast alle Traditionen durch eine vermutete Umorientierung der magischen Methoden als direkte Folge der Kritischen Essenz im Laufe der Jahrtausende verloren. Nur zwei konnten sich behaupten: die Traditionen der Su’Ruhya und der Hy’Chaia. Beide nutzen Zauber und Rituale, deren Durchführung zwar lange dauert, die aber in ihrer Wirkung einmalig und überaus mächtig sind.
Dass die Magie des Lebens nach wie vor eine der Hauptrichtungen der Nagah-Magie war, hatte Al’Hrastor natürlich gewusst. Für die Akademie der Schatten, die sich denselben Themen widmete, waren die Hy’Chaia stets wichtige Ansprechpartner gewesen, denen die Akademie einen Großteil ihres Wissens verdankte. Dass die Hy’Chaia lediglich einen Schatten einstiger Schlangenmacht darstellten, erfuhr Suliman hingegen erst jetzt. Die Schriften der Akademie deuteten an, dass in der Schwarzen Pagode womöglich zahlreiche Aufzeichnungen der verlorenen Zaubertraditionen der Nagah lagerten. Das unbestrittene Zentrum der alten Nagah-Magie indes sei Akorak gewesen, die verlorene Metropole der Nagah.
Damit hatte Al’Hrastor sein zweites Reiseziel gefunden. Es galt, den Ruinen der früheren Nagah-Hauptstadt einen Besuch abzustatten.
Akorak
Al’Hrastor bestand darauf, dass er und sein Begleiter Nagah-Gestalt annehmen sollten, bevor sie in den Echsendschungel aufbrachen, und dieser Tatsache verdankte es Merclador, dass seine Tarnung aufflog und der Stadtfürst von Yal-Mordai begriff, wer und was er war. Al’Hrastor wirkte auf ihn einen Verwandlungszauber. Merclador wusste sehr wohl, dass er diesem mühelos widerstehen würde. Also leitete er seine Verwandlung selbst in die Wege. Suliman indes war lange genug ein Diener Amazeroths, um die Wirkungen amazäischer Verwandlungsmagie von der Verwandlung eines Quitslingas unterscheiden zu können. Als Al’Hrastor den Verrat durchschaute, versuchte er den Dämon seinem Willen zu unterwerfen, und musste zu seinem Entsetzen feststellen, dass er abermals scheiterte. Einen Standard-Quitslinga zu beherrschen hätte ihn wenig Mühe gekostet. Hier indes traf er auf eine Macht, an der sein Zauber abprallte wie an einer meterdicken Mauer. Al’Hrastor glaubte deshalb, einen Avatar Amazth‘ vor sich zu haben, und warf sich Merclador vor die Füße. Dass der ihn dafür schallend auslachte, war nicht ganz die Reaktion, die Suliman erwartet hatte. Merclador, der keine Lust auf eine weitere Amazerade verspürte, versuchte es zur Abwechslung mit der Wahrheit. Oder jedenfalls dem Teil davon, den Al’Hrastor wissen musste. Von dem Dämon Merclador hatte Suliman natürlich gehört. Dass der Drachenquitslinga ein Interesse daran hatte, dass Amazth vom Thron gestoßen wurde, weil er keinen anderen Weg sah, seine Freiheit wiederzuerlangen, war ihm hingegen neu. Dass Merclador bekräftigte, Al’Hrastor sei dafür der richtige Mann, schmeichelte ihm, obwohl er sehr genau begriff, dass der Dämon ihn manipuliert hatte und dies noch immer tat.
Schließlich kamen Al’Hrastor und Merclador überein, ihre Reise wie geplant fortzusetzen. Oder jedenfalls ungefähr wie geplant. Nun, da Merclador aus seinen Kräften keinen Hehl mehr machen musste, nahm er Drachengestalt an und forderte Suliman auf, sich auf seinen Rücken zu schwingen. Mit einem Drachen als fliegbarem Untersatz kam der Stadtfürst von Yal-Mordai schnell voran. Sie erreichten das Ziel nach nicht ganz einer Tagesreise.
Mit dem Kataklysmus war einst das Ende für die einst prächtige Hauptstadt der Nagah gekommen, und mit ihr war ein Großteil des schlangenleibigen Volkes mitsamt seinem Wissen unter Tonnen von Asche begraben worden. Al’Hrastor und sein Begleiter ahnten nicht, dass sich vor einigen Jahren unter den Nagah ein Mysterienkult gegründet hatte, der Pyrdacor, den Goldenen Drachen der Elemente, unter dem Namen Phyr-sac-cor verehrte. Für die Nagah der ersten Besiedlungswelle, die direkt von Lahmaria kommend ins Riesland übergesiedelt waren, galt Pyrdacor seit jeher als Hoffnungsträger und Heilsbringer, der die Echsen vor ihren Sklaventreibern zu schützten vermochte. Für die Nagah der zweiten Welle indes, die vor der Verfolgung der Shindra durch den Drachen geflüchtet waren, war er ein Tyrann und Mörder. Das Erscheinen eines Pyrdacor-Kultes hatte deshalb für erhebliche Spannungen unter den Nagah gesorgt und bedrohte den Frieden, der zwischen den Schlangenleibigen herrschte. Wie die meisten Riesländer konnten auch die Pyr-sac-cor-Anhänger die zeitlichen Dimensionen der historischen Abläufe nicht korrekt abschätzen. Der Kult des Goldenen Drachen glaubte, dass das Ende Pyrdacors und der Fall des Marhynianischen Imperiums, der Kataklysmus und der Tod der fleischlichen Hülle des gottgleichen Goldenen zur selben Zeit stattgefunden hatten. Kataklys, so dachten sie, sei der Leib des göttlichen Drachen gewesen, der – von Famerlor zerrissen – zur Dere gestürzt war und dort gewaltige Verheerungen angerichtet hatte. Merclador hätte dies gewiss brennend interessiert, auch wenn ihm das bizarre Gerücht über das Ende seines Vaters als schiere Blasphemie erschienen wäre.
„Nachdem der Leib des Drachen, ein großer Stern, vom Himmel gefallen und weit im Norden eingeschlagen war, tat die Erde ihre Schlünde auf, und Feuer und Asche des erloschen geglaubten Vulkans, an dessen Hängen die Stadt Akorak verbaut war, verschlagen die Häuser der Schlangenleibigen“, hieß es unter den Nagah, und auch, dass der letzte Hohepriester der S’Stsiva es geschafft hatte, den Tempelschatz zu retten und in den Katakomben zu verschließen. Wenn diese Überlieferung stimmte, war er womöglich immer noch dort, denn gefunden hatte man bisher nichts dergleichen.
Merclador und Al’Hrastor durchsuchten die Ruinen systematisch und stöberten dabei eine Reihe von Wächtern und Geistwesen auf, doch diese wichen vor ihnen zurück. Die beiden unwilligen Diener des Amazth‘ waren sowohl die machtvolleren als auch die furchterregenderen Erscheinungen. Wie sie es vermutet hatten, befand sich die Ruinenstadt auf einem Nexus aus mehreren starken Kraftlinien, sodass sie die Karte des Goldenen Netzes entsprechend ergänzen konnten. Das Versteck des Tempelschatzes machten sie zwar ausfindig, er beinhaltete aber nichts, was für ihre Queste von Belang gewesen wäre, also ließen sie ihn unbehelligt zurück. Nach einigen Wochen stießen sie auf die gesuchten alten Schriften und konnten rekonstruieren, über welche Zaubertraditionen die Nagah in früheren Jahrtausenden verfügt hatten. Es stellte sich heraus, dass die verlorenen Traditionen ihnen auf der Suche nach der Unsterblichkeit nicht helfen würden. Das diesbezügliche Wissen war nahezu vollständig in die Tradition der Hy’Chaia aufgegangen, und bis zum Kataklysmus hatten die Meister des Lebens nur sehr unvollständiges Wissen über die Verlängerung des Lebens gekannt. Ihre Rituale erhielten die Jugend, verliehen aber keine Unsterblichkeit, oder sie verlängerten das Leben, aber nicht die Jugend. Viele davon benötigten Orte, Artefakte oder Ingredienzien, die in der alten Heimat der Nagah zurückgeblieben waren, auf Lahmaria oder in Aventurien, und die somit für einen riesländischen Zauberkundigen unerreichbar waren. Die Schriften ließen erkennen, dass die Nagah sich der Erforschung neuer Möglichkeiten auf diesem Gebiet gewidmet hatten, doch wenn ihnen diesbezüglich ein Durchbruch gelungen war, dann erst nach dem Kataklysmus.
Merclador und Al’Hrastor zogen sich aus Akorak zurück. Wenn sie dem Geheimnis der Unsterblichkeit auf die Spur kommen wollten, mussten sie unter lebenden Nagah suchen, nicht unter toten.
Die Ruinenstadt Akorak
„Und wieder lichtete sich der Dschungel vor unseren Augen, doch diesmal blickten wir nicht auf eine laute, lärmende, lebendige Stadt, sondern auf Ruinen, uralte, verwitterte und teilweise vom Dschungel bereits zurückeroberte Überreste. Einst musste diese Stadt, durch die wir uns bewegten, von unglaublicher Pracht gewesen sein, und wohl mehreren zehntausend Wesen eine Heimat gegeben haben. Viele ehemalige Gebäude lagen nun unter Wasser, und die alten Steine wurden langsam vom Fluss, der sein Bett mitten in die Stadt verlagert hatte, abgerieben. Wo einst wohl hunderte Nagah auf den Marktplätzen umherschlängelten, trieben nun träge einige große Alligatoren im brackigen Wasser. So sind wir sind dann lieber rasch hoch in die trockeneren Teilen der Stadt gezogen, die an den unteren Hängen eines kleinen, bizarr geformten Berges lagen. Andere Teile der Stadt waren verschont geblieben. Reih um Reih standen hier noch immer die prächtigen Häuser der einstigen Oberschicht. Alles wirkte auf unheimliche Weise langsam, wie in einer Zeitblase gefangen. Huschende Schatten verschwanden hinter den Häuserkanten, bevor man sie mit dem Auge genauer erfassen konnte. Immer blieb aber das Gefühl, beobachtet zu werden, und auch die düstere Ahnung, nicht willkommen zu sein und die Ruhe dieses Ortes zu stören. Nur unheimlich langsam kamen wir voran, und immer wieder geschah es, dass einer von uns unvermuteter weise gegen einen Gegenstand stieß, der unter dem grauen Schlick begraben lag, der den ganzen Ort unter sich begraben hatte. Darunter war auch so manches Schmuckstück. Was, so fragten wir uns, hatte die einstigen Herren dieser Stadt dazu bewegt, ihre Heimat derart rasch und überstürzt zu verlassen, dass sie nicht einmal noch Zeit hatten, ihre Wertgegenstände mitzunehmen? Tagsüber waren die Ruinen wie tot, doch wie wir von unserem Ipexco-Führer wussten, hieß es in alten Legenden, in der Nacht würden sich die Schatten der Vergangenheit wieder aus den Trümmern erheben. Wispernde, heulende Spukgestalten, hinterlistige Irrlichter und untote Nagah würden dann zum Leben erwachen und all diejenigen, die es wagten, die Ruhe der Stadt zu stören, ins Verderben reißen. So sind wir dann rechtzeitig vor Sonnenuntergang raus. Und dennoch, so hörte ich, sollen es immer wieder einzelne Abenteurer wagen, auch bis tief in die Nacht hinein noch durch die Ruinen des verfluchten Akoraks zu streifen, besagen die Legenden doch, dass tief in den unterirdischen Katakomben der Stadt der letzte Herr dieser einst mächtigen Metropole seinen gewaltigen Tempelschatz verborgen hat, der demjenigen gehören soll, der ihn findet.“
— Gehört im Bordell „Zur Grotte“ in Ribukan von einem Kämpen des Prinzen Hussain iben Sabu-Amin.
Schon vor mehreren tausend Jahren kam das Ende für die prächtige Hauptstadt der Nagah, und mit ihr wurde ein Großteil dieses Volkes und noch viel mehr von ihrem Wissen unter Tonnen von Asche begraben. Nachdem ein großer Stern vom Himmel gefallen und weit im Norden eingeschlagen war, tat die Erde ihre Schlünde auf, und Feuer und Asche des erloschen geglaubten Vulkans, an dessen Hängen die Stadt erbaut war, verschlangen die Häuser der Schlangenleibigen. Ob der letzte Hohepriester der H’Stsiva es tatsächlich geschafft hat, den Tempelschatz zu retten und in den Katakomben zu verschließen, bleibt ein Rätsel, das wohl nur die tapfersten Helden Rakshazars lüften können.
Angankor

Die nächsten Jahre verbrachten Al’Hrastor und Merclador in Nagahgestalt in Angankor, dem religiösen und politischen Herzen der Nagahlande. Sie gaben sich als Gelehrte aus, die lange Zeit durch die wilden Länder des Nordens gereist waren, um diese zu erforschen, und sie bemühten sich, Zugang zur Schwarzen Pagode zu erhalten. H’Ssrag, der heiligste Ort, größter Tempel der H’Stsiva und Zentrum ihres Kults, erbaut auf den Grundfesten eines weitaus älteren, kleineren Tempels, unter dem sich ein Wust aus Gängen, alten Kultkammern, Brutstätten, Grabanlagen und zugemauerten Stollen befand, in denen das gesammelte Wissen des Nagahvolkes lagerte, wurde ebenso scharf wie eifersüchtig gehütet. Es kostete die Neuankömmlinge sehr viel Mühe, Geduld und Überzeugungsarbeit, damit man ihnen soviel Vertrauen entgegenbrachte, ihnen mehr und mehr von dem alten Wissen zugänglich zu machen. Doch erst, nachdem sie halfen, einen Brand zu löschen, den sie zuvor in aller Heimlichkeit selbst gelegt hatten (Merclador bezeichnete dies als “die Fruchtbarkeit steigernde Brandrodung”), gewährte man ihnen den Zugriff auf die wirklich interessanten Schriften.
Es stellte sich heraus, dass auch spätere Generationen von Nagah keine zufriedenstellenden Ergebnisse bei der Lebensverlängerung erzielt hatten. Nach dem Kataklysmus hatte ihre Kultur ebenso lange gebraucht wie die der anderen Völker, sich von der Katastrophe zu erholen, und auch danach waren sie nur schleppend vorangekommen. Mit einer Ausnahme. Wieder und wieder fielen die Namen Unlon und Namakari, womit offenbar Orte auf den Jominischen Inseln gemeint waren, deren Position unklar blieb. Es hieß, dass sich die Bewohner dieser Orte mit der Frage nach der Unsterblichkeit befasst und womöglich bedeutende Erfolge erzielt hatten.
Von nun an versuchten die beiden Amazth-Diener, die Position der genannten Orte zu ergründen, doch ohne nennenswerten Erfolg. Erst nach Monaten bot sich ihnen ein ebenso ungewöhnlicher wie unerwarteter Führer an.
Der grüne Mann
Inzwischen schrieb man das Jahr 688 BF, als ein Vertreter eines Volkes an Al’Hrastor herantrat, das man in den Echsendschungeln nur höchst selten zu Gesicht bekam – ein Rochkotaii. Und noch dazu einer, der sich grundlegend von allen anderen Weißpelzorks unterschied, von den Al’Hrastor gehört hatte, denn sein Pelz wies eine leuchtend moosgrüne Farbe auf, so wie die Haare der Parnhai.

Es stellte sich heraus, dass der Fremde, der seinen Namen nicht nennen wollte, so als fürchte er, er könnte wie so manches magische Wesen mit Hilfe seines Namens einem fremden Willen unterworfen werden, tatsächlich einen Parnhai-Symbionten trug und diesem die ungewöhnliche Pelzfarbe verdankte. Ob es sich dabei um eine reine Modeerscheinung handelte oder ob der Ork sich davon besondere Fähigkeiten erhoffte, blieb unklar. Der Rochkotaii, den man mangels eines besseren Namens mit „der grüne Mann“ ansprach, schwieg sich auch darüber aus, und die Frage schien Al’Hrastor nicht interessant genug, um ihr auf den Grund zu gehen.
Der grüne Mann hatte Al’Hrastor und Merclador beobachtet und sagte ihnen auf den Kopf zu, dass sie keine Nagah seien. Da der Stadtfürst von Yal-Mordai und der Drachendämon ihre wahre Identität nicht preisgeben wollten, gaben sie sich als Zauberkundige der Akademie der Schatten zu Ribukan aus, die sich in fremder Gestalt unter die Nagah gemischt hätten, um Zugriff auf ihr Geheimwissen zu erhalten. Dass sie am Geheimnis der Unsterblichkeit interessiert waren, gaben sie indes wahrheitsgemäß zu.
Der Ork erklärte, auch er wolle Unsterblichkeit erringen, und bot sich den Fremden als Führer an. Er gab vor, den Ort zu kennen, wo Unlon und Namakari zu finden seien, doch habe er nicht genügend Mittel, um eine Expedition zur Inselwelt des Südens auszurüsten. Al’Hrastor versprach, sich darum zu kümmern, und vereinbarte mit dem Grünen Mann einen Trefferpunkt in Ribukan, wo man sich zu einem bestimmten Datum treffen wolle.
Auf magischem Wege nahm er Kontakt zu Hrastor auf und ließ sich weitere Leute schicken, einen Zeloten, einen Wildniskundigen, einen Alchimisten und einen Kämpfer. Al’Hrastor und Merclador gesellten sich hinzu, diesmal in Gestalt ribukanischer Zauberkundiger, gaben die anderen Beteiligten als Schatzsucher aus und brachen mit ihrem grünhaarigen Verbündeten in Richtung der Jominischen Inseln auf.
Es stellte sich heraus, dass der grüne Mann in Punkto Ortskenntnis gelogen oder zumindest stark übertrieben hatte. Er hatte nur eine ungefähre Vorstellung davon, wo Unlon oder Namakari zu finden waren, und so gestaltete sich die Reise durch die Inselwelt des Südens als monatelange kräftezehrende Ulissee.
Hinzu kam, dass Al’Hrastor und der grüne Mann irgendwann hinter ihre jeweiligen Geheimnisse kamen. Der grüne Mann, der vorgab, ein treuer Diener der Prahini zu sein, erwies sich in Wahrheit als fanatischer Anhänger des Kamesh, des kopflosen Orkgottes der Wiedergeburt, der Macht und der Rache, hinter dem sich niemand anderer als der Namenlose verbarg. Im Laufe der Jahrhunderts hat er seiner Gottheit zwei Finger, drei Zehen, die Nase und Teile seines Gemächts geopfert und im Gegenzug die Lebensverlängerung erhalten, die auf andere Weise zu erstreiten ihm bisher nicht vergönnt war.
Der grüne Mann wiederum begriff, dass er es mit Dienern des Amazth zu tun hatte. Amazth und der Namenlose und ihre jeweiligen Anhänger indes sind sich spinnefeind, und gewiss hätte niemand der jeweils anderen Fraktion das Geheimnis der Unsterblichkeit gegönnt.
Der Gruppe zerbrach, bevor sie auch nur in die Nähe von Namakari kam. Was im Folgenden geschah, ist unklar, doch scheinen sich jene Geschehnisse anzuschließen, die Al’Hrastor zu einem geheimen Klingenmagier machten.
Seit dieser Zeit sind Al’Hrastor und der grüne Mann erbitterte Feinde. Wann immer es möglich ist, sabotiert der grünpelzige Ork die Suche des Stadtfürsten nach dem Ewigen Leben. In späteren Jahren gründete er dafür eigens einen Kult der Prahini, der vor allem in Shahana und in Yal-Mordai viele Anhänger unter der Landbevölkerung und den Gärtnern der Reichen und Schönen findet. Die Gottheit, die eigentlich im Parnhai-Glauben als Göttin des Süßwassers, des Bootsbaus und des Lebens gilt, gibt er als Herrin der Pflanzen, des Wachsens, des Gedeihens und der Gesundheit aus und lässt sich selbst als ihren Heiligen verehren. Die Gläubigen setzt er als Schläger, Spione und Saboteure ein, die jegliche Unternehmungen des heutigen Sultans von Yal-Mordai sabotieren.
Zugleich kümmert sich der Kult darum, Abenteuer anzuheuern, die für ihn versuchen sollen, den Trank der alten Mogule von Unlon aus Namakari zu bergen. Zwar ist es ihm gelungen, die Stadt zu finden und zu betreten. Doch haben ihm die Hexendoktoren unmissverständlich klargemacht, dass er als Diener des Widersachers hier nicht erwünscht sei. Diese Drohung nahm der Rochkotaii ernst. Er wagt es nicht, die das alte Unlon selbst zu betreten, deshalb schickt er immer wieder Expeditionen nach Namakari, die eine nach der anderen gescheitert sind.
Auch Al’Hrastor ist nach all den Jahrhunderten noch immer an den Geheimnissen Unlons interessiert, hat aber nach wie vor keine Ahnung, wo die Stadt zu finden ist. Es ist dem grünen Mann erfolgreich gelungen, ihm dieses Geheimnis vorzuenthalten. Der Wettstreit um Unlon, Namakari und das Elixier der Unsterblichkeit hält deshalb seit Jahrhunderten an, ohne dass eine der beteiligten Parteien jemals nennenswerte Erfolge erzielt hätte.

Der Sarkophagus der Ewigkeit
Al’Hrastor und Merclador kehrten ohne konkretes Ergebnis die Unsterblichkeit betreffend nach Yal-Mordai zurück. Da trat Hrastor an ihn heran. Der Vorsitzende des Rates der Schemenhaften hatte noch immer ein starkes Interesse daran, Al’Hrastor in einen Pakt mit Amazth zu drängen. Er war sich aber auch bewusst, dass Suliman einen solchen auch weiterhin verweigern würde. Der Rat sah seine Pläne in Gefahr. Sollte Al’Hrastor zu alt werden, um sein Amt auszuüben, oder gar zeitnah sterben, war alles umsonst gewesen. Es würde dauern, bis das Zuchtprogramm einen neuen geeigneten Kandidaten für die weitreichenden Pläne, die der Rat mit dem Amt des Stadtfürsten hatte, hervorbringen würde. Zu lange womöglich – bis dahin konnte ein dem Rat weniger wohlgesonnener Kandidat die Herrschaft über die Stadt an sich reißen und festigen.
So bot Hrastor seinem Schützling eine alternative Möglichkeit an, sein Leben zu erhalten. Er überreichte dem überraschten Stadtfürsten den Sarkophagus der Ewigkeit, jenen Kessel der Urkräfte, der Sheranbil V. am Leben gehalten und Azuri beinahe getötet hatte. Hrastor gab vor, den Sarkophagus nach langer Suche wiederentdeckt zu haben, in Wahrheit jedoch hatte sich das Artefakt die ganze Zeit über in seinem Besitz befunden.
Hrastor kannte die alten Rituale, die Sheranbil V. zu seinem fortgeschrittenen Alter verholfen hatten, doch er hatte nicht vor, sie zum Einsatz zu bringen. Sie hätten Al’Hrastor mit Ewiger Jugend und relativer Unsterblichkeit ausgestattet, es hätte für ihn also kein Grund mehr bestanden, einen Pakt mit Amazth zu schließen, um von ihm die Alterslosigkeit zu erbitten. Der Paktschluss Al’Hrastors mit dem Erzdämon war aber unerlässlich für die Verwirklichung der Pläne des Rates. So bot der schemenhafte Ratsvorsitzende dem Stadtfürsten eine modifizierte Variante der relativen Unsterblichkeit an, die eine Reihe negativer Nebenwirkungen mit sich brachte. Der steinerne Sarkophag von Tzzahs’umul würde Al’Hrastors Leben erhalten, ihn vor Krankheiten bewahren, Schaden durch Gifte und Verletzungen regenerieren. Doch er würde ihm keine Ewige Jugend verleihen, sein Körper würde mehr und mehr verfallen, ohne diesem Verfall durch den Tod entgehen zu können, und im Laufe der Zeit würde auch sein Geist verwirrt und gelähmt werden. Außerdem mussten die Rituale in regelmäßigen Abständen wiederholt werden und setzten den Stadtfürsten außer Gefecht. Eine Zeit, in der er sich in eine schlafartige Meditation begeben musste und sich so nicht mehr um seine Herrschaftsbelange kümmern konnte. Hrastor war sich sicher, dass diese gravierenden Nachteile der Prozedur auf Al’Hrastor hinreichend abschreckend wirken würden, um ihn alsbald in den Pakt mit Amazeroth zu treiben.
Er sollte sich irren. Unsterblichkeit blieb für Al’Hrastor Mittel zum Zweck, er entwickelte niemals wirkliche Leidenschaft dafür. Zu tief war das sanskitarische Gedankengut über die Leidbehaftetheit und Sinnlosigkeit des Seins, die in den amazäischen Lehren ihre grotesk übersteigerte Fortsetzung fand, in seinem Denken verankert. Es rief in ihm den Wunsch zu sterben hervor, und mit jedem weiteren Lebensjahr wurde er stärker. Sich dieser Todessehnsucht hinzugeben war jedoch keine ernsthafte Option. Al’Hrastor hatte sein Leben Amazth gewidmet, und der war eine Entität der Niederhöllen. In dem Augenblick, wo Suliman starb, würde der „Gott“ seine Seele beanspruchen. Dies bedeutete, dass Amazth aus Al’Hrastor einen Dämon machen oder ihn zu einem sonstigen niederhöllischen Dasein verdammen würde, und das wahrscheinlich für eine sehr lange Zeit, denn die Mächte des Chaos würden erst dann ins Nichts zurückkehren, wenn sie die Schöpfung vernichtet hatten. Etwas, das mittelfristig nicht in Sicht war, außer Al’Hrastor sorgte selbst dafür. Statt ihm die Flucht aus dem leidvollen Sein zu ermöglichen, würde der Tod ihn zu einem noch leidbehafteteren, weit längerwährenden verdammen.
Unsterblichkeit war somit nichts als ein Werkzeug. Sie verhinderte, dass Suliman den Niederhöllen anheimfiel, und sie verschaffte ihm die Zeit, sich für die richtige Handlungsweise zu entscheiden. Al’Hrastor war fest entschlossen, das sinnentleerte Dahinvegetieren der Sterblichen zu beenden, was nicht zuletzt bedeutete, auch für sich selbst Erlösung zu finden. Doch er konnte sich nach wie vor nicht entscheiden, welches der beste Weg dorthin war. Er konnte Amazeroth bei seinem Vorhaben unterstützen, die Schöpfung ins Nichts zu stoßen, um so das Dasein der Sterblichen ein für allemal zu beenden und auch seine eigene Existenz final auszulöschen. Oder er konnte daran arbeiten, Amazeroth vom Thron zu stoßen, sich selbst an seine Stelle zu setzen und mit seiner neugewonnenen Macht die Welt in einen besseren Ort zu verwandeln, jenes Utopia, das zu erschaffen ihm die Zwänge des Diesseits bislang verwehrt hatten.
Die Nutzung des Sarkophagus auf die von Hrastor gewählte Weise birgt zudem hohes Suchtpotenzial, und je häufiger sich Al’Hrastor der Prozedur unterzieht, umso weniger kann er davon lassen. Darüber hinaus ist Suliman davon überzeugt, dass er eines Tages Namakari finden und dort wahre Unsterblichkeit erlangen werde. So kommt es, dass Al’Hrastor selbst in dem Augenblick, wo er sich doch noch zu einem Pakt mit Amazeroth entschloss, auf das Paktgeschenk der Alterslosigkeit verzichtete. Er entschied sich für andere Gaben, die ihm nützlicher erschienen. Auf diese Weise gab er dem Sarkophagus die Chance, ihn Schritt für Schritt zu zerstören. Der Sarkophagus verhilft ihm nicht zu ewiger Jugend, und so sieht Al’Hrastor mittlerweile aus wie ein mit ledriger, faltiger Haut überzogenes Skelett. Mit der zunehmenden Verwirrung seines Geistes verliert zudem die Meditation selbst an Wirksamkeit, was ihre Dauer verlängert, damit sie überhaupt noch einen Effekt entfaltet. Anfangs hatten wenige Tage genügt, inzwischen dauert ein Regenerationszyklus beinahe vier Wochen. Al’Hrastor droht deshalb mehr und mehr die Kontrolle über die Belange Yal-Mordais, über das Reiches und die Zelothim zu entgleiten. Einige Fraktionen scharren schon lange mit den Hufen, um ihn bei passender Gelegenheit zu überwinden und sein Erbe anzutreten, doch noch hat Al’Hrastor zu viel Macht für einen solchen Vorstoß.
Die Wilde Horde
Anders als in Zeiten, wo er von einem Utopia geträumt hatte, erfreute sich Al’Hrastor außerhalb Yal-Mordais keines besonders guten Rufs. Zwar war der Amazth-Kult auch in den anderen sanskitarischen Stadtstaaten verbreitet, und die Amazäer waren es mit ihm. Den Zelothim aber, die meist jahrelange Folter hatten erdulden müssen und entstellt, vernarbt, hart und verwahrlost aussahen, begegnete man mit Schrecken, und es hatte sich herumgesprochen, dass der Stadtfürst von Yal-Mordai den Orden anführte. Dies hatte Suliman vollkommen zurecht den Ruf eines sinisteren Hexenmeisters eingebracht, dem keinesfalls zu trauen sei.
Dass es ihm dennoch gelang, die Stadtstaaten unter dem Banner des Sanskitarischen Städtebundes zu versammeln, sie zu einen und damit ein neues Sanskitarenreich aus der Taufe zu heben, ist allein dem Erscheinen der Wilden Horde zu verdanken, die sich als gemeinsamer Feind aller Sanskitarenstädte erwies. Den Stadtfürsten blieb dabei verborgen, dass Sulimans Ziehvater Hrastor selbst es war, der für das Erscheinen der Horde sorgte. Er hatte seine Kontakte spielen lassen und die Flammenbrigade ins Boot geholt. Die Dämonen von Argos blieben im Hintergrund, um ihre Beteiligung an Al’Hrastors perfiden Plänen zu verschleiern. Dafür schickten sie von ihnen korrumpierte Sterbliche ins Rennen, allen voran Schwarzpelzorks, Brokthar und Sanskitarische Reiternomaden, später auch Ipexco und Parnhai.
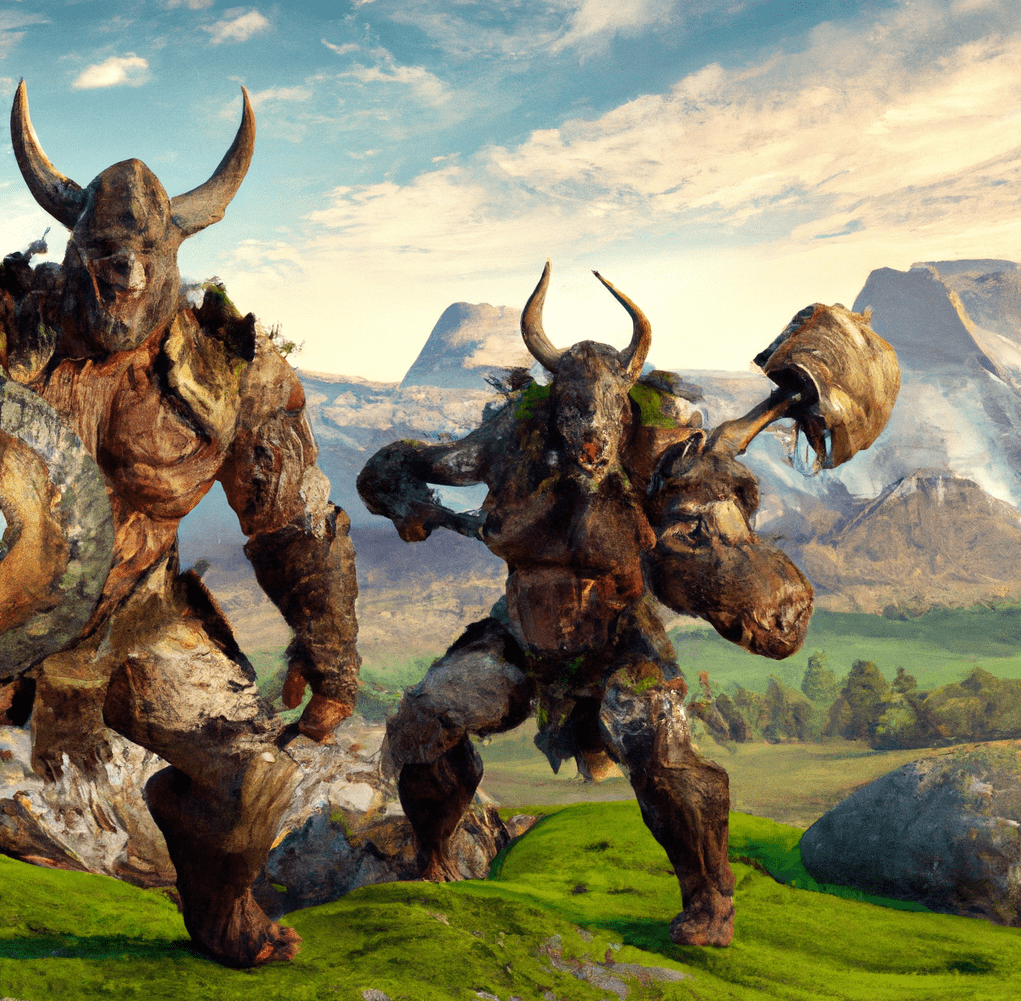
Jil’Vaedos
Samira, die Anführerin der Flammenbrigade und Herrscherin von Argos, schickte ihre rechte Hand Jil‘Vaedos, der wie sie ein Dämon archäischer Abstammung war. Der erfahrene Heerführer mischte sich in menschlicher Gestalt unter die Sanskitarischen Reiternomaden und predigte wider die Sanskitarischen Stadtstaaten. Er sprach von dem Fluch, den sie auf die Sanskitaren herabbeschworen hatten, indem sie in den Ruinen der alten Hochkultur sesshaft geworden waren. Er beschwor die Verderbtheit ihrer Götter, allen voran die des Amazth. Er wetterte gegen die amazäischen Hexer und ihre niederhöllische Variante, die Zelothim. Und er verfluchte Al’Hrastor, den Dämon auf dem Thron von Yal-Mordai, der von den anderen Stadtfürsten protegiert wurde, statt dass sie sich geschlossen gegen ihn stellten. Nach und nach sammelten sich Gleichgesinnte um Jil’Vaedos, die bereit waren, den Umtrieben der Städter ein Ende zu setzen. Aber auch Unzufriedene und Kämpfer, die sonst kein geregeltes Auskommen hatten, schlossen sich ihm an.
Das Erscheinen der Wilden Horde
Die Wilde Horde war entstanden, und da sie anfangs aus nicht viel mehr als dreißig Personen bestand, die keine Militärerfahrung hatten, sondern nur ein wild zusammengewürfelter Haufen waren, blieben ihre Erfolge zunächst bescheiden. Die Stadtstaaten nahmen sie zwar wahr, aber nicht anders als andere Räuberbanden, die versuchten, die Versorgungswege der Städte zu schwächen und etwas von den Waren, die darüber transportiert wurden, in ihren Besitz zu bringen. Die Einnahmen aus den Überfällen reichten gerade so, um die Wilde Horde zu bewaffnen, zu versorgen und unterzubringen.
Der Aufstieg der Wilden Horde
Dann jedoch gelang Ji’Vaedos und seinen Leuten ein größerer Coup. Ein erfolgreicher Überfall auf einen Goldtransport versetzte die Horde in die Lage, für eine Weile Söldner anzuheuern, und gemeinsam mit ihnen brannte man eine Reihe von Wachtürmen nieder, welche die Handelsstraße zwischen dem Sanskitarischen Yal-Kharibet und der Xhul-Stadt Teruldan sicherten. Von nun an war es möglich, in unregelmäßigen Abständen die Karawanen zu plündern, die zwischen den beiden Städten verkehrten.
Mit dem Erfolg kam auch das Personal. Einige der Mietlinge schlossen sich der Wilden Horde dauerhaft an, und ebenso weitere Reiternomaden. Damit konnte die Horde ihren Wirkungsradius ausweiten. Sie überfiel nun Vorposten, Militäreinheiten, Wachtürme, Lager und Karawanen der Sanskitarischen Stadtstaaten bis hinein ins Gebiet der Wüste Lath und nach Kurotan und verstärkte ihre Reihen, indem sie geschlagenen Gegnern das Angebot unterbreitete, für die Horde zu kämpfen statt zu sterben. So erweiterten sich die Reihen der Wilden Horde um Brokthar, Schwarzpelzorks und sogar einige Ipexco. Auf Heeresgröße von über eintausend Seelen angewachsen, wagte sich die Wilde Horde von nun an in unmittelbare Nähe der Stadtstaaten, überfiel Gehöfte und Außenposten, plünderte Felder und Plantagen, legte Brände, erschlug oder entführte einzelne Städter oder kleinere Reisegruppen. Zudem schlossen sich der Horde mehr und mehr Parnhai an, die ihrer Sklavenrolle entkommen wollten oder bereits die Freiheit erlangt hatten und Vergeltung an ihren früheren Herren zu üben trachteten. Zuweilen drang die Wilde Horde sogar quer durch Nagah-Gebiet bis nach Ribukan vor.
Die Stadtstaaten konnten die Wilde Horde nun nicht länger ignorieren, und ausgerechnet Al’Hrastor bot sich an, den Kampf gegen die inzwischen hervorragend bewaffnete, gerüstete und ausgebildete Reiterschar anzuführen. Dass Jil’Vaedos, der gefürchtete Anführer der Horde, mit ihm und Hrastor im Bunde stand, ahnten die anderen Sanskitaren nicht.
Die Todesschwadron
So rüsteten die Sanskitarenstädte auf. Die Verteidigungsanlagen wurden massiv ausgebaut. Wo immer es möglich war, wurden Holzbauten gegen trutzige Bauwerke aus Stein ersetzt und Baulücken geschlossen. Anstelle kleinerer Truppenkontingente, die nach Bedarf mobilisiert wurden, hob jeder Stadtstaat ein stehendes Heer aus, rüstete es mit hochwertigem Material und beschaffte ihm Reittiere. Zudem schickte jeder der Stadtstaaten einen größeren Truppenteil nach Yal-Mordai. Al’Hrastor hatte die Gründung einer schnellen Eingreiftruppe mit dem inoffiziellen Namen „Todesschwadron“ angeregt, an der alle Stadtstaaten beteiligt sein sollten und die mächtig genug sein sollte, selbst der vollbestückten Horde zu trotzen. Auch wenn Zelothim und Amazäer das Rückgrat der Truppe bildeten, unterstützt durch die Zauberkundigen von der Akademie der Schatten zu Ribukan, stimmte Al’Hrastor zu, dass die Truppe von einem Feldherren befehligt wurde, der nicht aus Yal-Mordai stammte. Man verständigte sich auf den aus Shahana stammenden Illurion, der die Stadt schon seit vielen Jahren gegen Kriegsherren, bewaffnete Haufen, Räuberbanden und Söldnertrupps verteidigte.
Da nun eine Einheit existierte, welche in ihrer geballten Macht der Wilden Horde gefährlich werden konnte, teilte Jil’Vaedos die Horde in kleinere Einheiten auf. Gewiss würde es den Stadtstaaten nicht gelingen, die Bewegungen aller Einheiten zu verfolgen, sodass man jeweils dort zuschlagen konnte, wohin das wachsame Auge der Städter gerade nicht blickte. Damit ergab sich die Notwendigkeit, separate Hordenteile mit eigenen Kommandanten zu versehen. Jil’Vaedos behielt das Kommando über rund sechzig Prozent der Horde, setzte jedoch ihm unterstellte Generäle ein, die einzelne Truppenteile befehligten. Die restlichen vierzig Prozent überstellte der Heerführer der Flammenbrigade an den Schwarzpelzork-Schamanen Omer’Azul, der einen Pakt mit Samira geschlossen hatte, welche als Archontin der limbischen Domäne Argos von quasi erzdämonischer Macht war und entsprechend Paktgeschenke vergeben konnte. Die Dämonin hatte ihn mit Alterslosigkeit und machtvoller archäisch-dämonischer Hexerei ausgestattet. Omer’Azul ernannte seinerseits Unterführer, zu denen auch Gul’Dukan zählte, ein Braunpelzork und gelehriger Schüler Omer’Azuls.
Verrat und zugenäht
Noch immer standen Hrastor und Jil’Vaedos in heimlichem Kontakt und stimmten ihre jeweiligen Pläne aufeinander ab, aber beide Seiten wussten längst, dass sie einander verraten würden. Für den Rat der Schemenhaften und Al’Hrastor war die Wilde Horde Mittel zum Zweck, ein gemeinsamer Feind, der die Sanskitarischen Stadtstaaten einen und unter dem Banner Yal-Mordais versammeln sollte. Und Samiras Truppen dachten gar nicht daran, sich zum Bauernopfer von Amazth‘ intriganten Dienern machen zu lassen, sondern planten, sich beizeiten gegen sie zu wenden, um für Argos, Samira und die Flammenbrigade eine Herrschaft im Riesland zu etablieren.
Al’Hrastor fing an, eigene Leute in die Horde einzuschleusen, und die wiederum schickte ihre Spione das Umfeld des Stadtfürsten von Yal-Mordai. Suliman ging es darum, die Moral der Horde zu untergraben und Angehörige derselben auszumachen, die unzufrieden und zum Verrat bereit waren. Zu Al’Hrastors Überraschung und Freude sollte sich herausstellen, dass es ausgerechnet Gul’Dukan war, der sich dazu bereit zeigte. Er war ein begnadeter Schamane, doch war er missgebildet und verkrüppelt geboren worden, und seine orkischen Artgenossen behandelten ihn schlecht. Seine eigenen Truppen folgten ihm mürrisch, auch und vor allem, weil sie seine magischen Kräfte fürchteten, aber wirklich akzeptiert wurde er nicht. Omer’Azul drängte seinen Schüler zum Paktschluss mit Samira, doch dieser zögerte die Entscheidung hinaus. Es wäre ihm lieber gewesen, sich von der Wilden Horde zu lösen, als sich auf Dauer an sie zu binden.
Die zögernde Haltung den Paktschluss betreffend erinnerte Al’Hrastor an sein eigenes Schicksal, und auch sonst fanden sich eine Reihe von Gemeinsamkeiten zwischen ihm und Gul’Dukan. Schließlich erklärte sich der Schamane bereit, den Stadtfürsten über die Pläne der Horde in Kenntnis zu setzen. Merclador willigte ein, den Informationsaustausch zwischen Al’Hrastor und Gul’Dukan zu übernehmen. Als Quitslinga konnte er die jeweils benötigte Gestalt annehmen und sich somit unauffällig sowohl innerhalb der Horde als auch in Yal-Mordai bewegen. Und selbst wenn man ihn erwischte, war die Chance, dass man ihn überwand, astronomisch klein.
Ab 707 BF brach ein offener Krieg zwischen den Sanskitarischen Stadtstaaten und der Wilden Horde aus. Al’Hrastor nutzte das Wissen, das Gul’Dukan ihm zuspielte, um Yal’Mordai so gut es ging zu schützen. Die übrigen Stadtstaaten verteidigte er mit Bedacht. Er sorgte für soviel Schutz gegen die Horde, dass sie nicht fielen, und enthielt ihnen soviel davon vor, dass sie empfindliche Niederlagen erlitten und damit mehr und mehr von der Unterstützung durch Yal-Mordai und die Todesschwadron abhängig wurden.
Omer’Azul entging es nicht, dass es eine undichte Stelle innerhalb der Truppe geben musste. Wann immer er einen Vorstoß auf Yal-Mordais Besitzungen unternehmen wollte, zeigte sich der Gegner bestens vorbereitet und schien den Angriff geradezu zu erwarten. Omer’Azul machte eine Reihe von Verdächtigen aus, die sich für einen solchen Verrat anfällig zeigen konnten. Er bat jeden von ihnen zum Gespräch und versorgte ihn mit „vertraulichen Fakten“, die allesamt Fehlinformationen waren. Diese betrafen militärische Ziele, die in der nächsten Zeit attackiert werden sollten. Danach beobachtete Omer’Azul die Feindbewegungen. Sollten die Stadtstaaten darangehen, eines der genannten Ziele abzusichern, wusste er, von wem sie die entsprechende Warnung erhalten hatten. Zu seiner persönlichen Überraschung schwärmten die Truppen Yal-Mordais aus, um das Ziel zu verteidigen, das er seinem Schüler Gul’Dukan genannt hatte.
Omer’Azul sandte seiner Häscher aus und ließ sie den Verräter ergreifen und vor ihm auf den Boden schleudern. Gul’Dukan leugnete nicht, was er getan hatte, sondern spie Omer’Azul und den anwesenden Hordenmitgliedern seinen Hass entgegen. Omer’Azul trat daraufhin vor und wollte seinem Schüler mit der Axt den Kopf abschlagen, da jedoch entschloss sich Merclador zum Eingreifen, verwandelte sich in einen gewaltigen Drachen und wütete unter den anwesenden Hordlern. Omer’Azul gelang mit knapper Not die Flucht, und Gul’Dukan wurde auf dem Rücken des Drachen in Sicherheit gebracht.
Der Schamane trat nun in Al’Hrastors Dienste und wurde zum Zelothen ausgebildet. Auf die sonst übliche Folter verzichteten seine Ausbilder. Ihr neuer Akoluth war bereits missgestaltet und kannte den Hass auf die Welt und die Sterblichen, der jungen Schülern so mühsam nahegebracht werden musste, nur allzu gut. Al’Hrastor hatte große Pläne mit dem Überläufer. Er sollte für die Vernichtung der Wilden Horde sorgen.
Eine Strafe für Omer’Azul
Inzwischen erfuhr Jil’Vaedos vom Versagen Omer’Azuls, der einen Verräter in den Reihen seiner Truppen übersehen und so zahlreiche Niederlagen verschuldet hatte. Und zu allem Überfluss war der Delinquent ihm auch noch entkommen. Der Dämon archäischer Abkunft wusste, dass er Omer’Azul nicht zum Tode würde verurteilen können. Der Versager kommandierte einen signifikanten Teil der Wilden Horde, und es war nicht abzusehen, ob dieser im Rahmen einer Auseinandersetzung nicht zu ihrem Kommandanten halten würde. In diesem Fall mussten Omer’Azuls Truppen unter großen eigenen Verlusten vernichtet werden. Eine solche Verschwendung von Ressourcen konnte sich die Horde nicht erlauben, wenn sie gegen die Stadtstaaten gewinnen wollte. Auch hatte Omer’Azul inzwischen einen hohen Grad der Verdammnis erreicht. Sobald er starb, würde er in Samiras Domäne einfahren und von ihr zum Dämon erhoben werden. Dadurch hätte Jil’Vaedos sich einen mächtigen Konkurrenten und Feind erschaffen, der ihm womöglich ebenbürtig gewesen wäre. Das Versagen ungestraft lassen konnte der Archäer-Dämon aber ebenfalls nicht. Also vereinbarte er mit Omer’Azul eine strategische Unterredung, tat so, als wisse er von nichts, und als er für eine Weile mit ihm alleine war, schleuderte er den anderen mit Hilfe seiner Dämonenmacht in den Limbus, wo er an einem Ort namens „Wirbelnder Mahlstrom“ gefangengesetzt wurde.
Jil’Vaedos setzte Omer’Azul nach und vollendete seine Rache an dem Versager. Er schälte Haut und Fleisch vom Körper des Orks und zerriss ihn bis zur Essenz seiner Seele, die er folterte und quälte. Omer’Azul verlor vor Qualen den Verstand. Aus schierer Verzweiflung schwor er Jil’Vaedos ewige Treue und Gefolgschaft. Daraufhin nahm der Anführer der Wilden Horde die Reste der Seele des Versagers und sperrte sie in eine eigens dafür geschaffene Rüstung aus Eternium. Dann schleuderte er ihn zurück in derische Gefilde. Omer’Azul schlug im nördlichen Korrun auf, das unter ewigem Eis verborgen lag, formte mit seiner immer noch vorhandenen Dämonenmacht einen mächtigen Eispalast nebst seines Eisthrons, unterwarf Eisdrachen als seine ersten Diener und zwang dann weitere Lindwürmer, Yetis, Shakagra und andere Sterbliche in seine Dienste. Jene aber, die im Ewigen Eis den Tod fanden, erweckte seine frevelhafte Magie zu grauenvollem Unleben. Als „Eiskönig“ genannte, teils orkische, teils dämonische, teils geisterhafte Entität mit gebrochenem, dem Wahnsinn anheimgefallenen, aber nichtsdestotrotz zu brillanten Denkleistungen fähigen Geist, gerüstet in das mächtigste der magischen Metalle und mit einem gewaltigen Schwert aus Endurium bewaffnet, ist er dazu ausersehen, die „Wandernde Geißel“, wie seine ständig wachsende Armee genannt wird, eines Tages gegen riesländische oder aventurische Gefilde zu führen. Dabei ist durchaus unklar, ob Jil’Veados seiner Kreatur den Angriff befehlen wird, um Samira und ihre Flammenbrigade zum Endsieg zu führen, oder um sie von ihrem Thron zu stoßen und selbst die Herrschaft über Argos zu übernehmen.
Ogrin Sphärenaxt
Jil’Vaedos übergab den Truppenteil, den Omer’Azul befehligt hatte, in die Hand von Ogrin Sphärenaxt, einem verdienten Krieger ohne magische Kräfte, aber einer machtvollen magischen Waffe, die noch aus marhynianischen Zeiten stammte und sich mit Stellarmacht aus der Sechsten Sphäre auflud, die unter bestimmten Umständen als kraftvoller Blitz auf die Feinde geschleudert werden konnte. Ohne einen Verräter in den eigenen Reihen gelang es der Horde rasch, signifikante Fortschritte zu erzielen, sodass sie zu einer echten Bedrohung für die Sanskitarischen Stadtstaaten wurde, die nun auch Yal-Mordais Sicherheit bedrohte.
Die Vergiftung
Al’Hrastor schickte deshalb Gul’Dukan zur Horde zurück. Mit veränderter Gestalt ließ sich der Verräter von der Wilden Horde für den Truppenteil engagieren, der den Nachschub organisierte. In dieser Position vergiftete er nach und nach alle Lebensmittelvorräte, mit denen sämtliche Kontingente der Wilden Horde versorgt wurden. Hauptzutat des von Al’Hrastor selbst zubereiteten Trankes war das Blut des Dämons Merclador, dessen verderbte Macht jeden, der den Trank verköstigte, binnen Monatsfrist selbst in einen Dämon verwandelte und in einen tödlichen Blutrausch versetzte. Nur wenige Hordler entgingen diesem Schicksal, darunter Ogrin Sphärenaxt, der zusammen mit seinem Stellvertreter Dorthan mit Hilfe eines Donari-Pfadwanderers in fremde Gefilde gereist war, um Waffen, Rüstungsteile und Artefakte zu kaufen, welche den bevorstehenden Sturm auf Yal-Mordai begünstigen sollten.
Wieder zurück am Ort des Geschehens, fanden die beiden Orks eine entfesselte, im Blutrausch befindliche Dämonenhorde vor, welche auch die zunehmend vergeblicher wirkenden Bemühungen Jil’Vaedos nicht mehr unter Kontrolle bringen konnten. Er verdankte es seiner Autorität und seiner machtvollen Axt, dass sich nach einer Weile Teile seiner Truppe erneut seinem Befehl unterstellten. Ogrin Sphärenaxt bemühte sich darum, herauszufinden, was mit der Wilden Horde geschehen war, und schließlich führten ihn Hinweise zu den vergifteten Nahrungsvorräten und damit zu dem fremden Ork, der vor einiger Zeit von den Nachschiebern rekrutiert worden war.
Sphärenaxt ließ seine Leute ausschwärmen, den Verräter zu finden, der sich längst auf der Flucht befand. Als ihm die Feinde den Weg abschnitten, wirkte er ein Ritual, das ihn in den Limbus bringen sollte, doch angesichts der Eile und der Gefahr, in der sein Leben schwebte, beging er einen Fehler, und so erschütterte eine gewaltige Explosion die Region und riss signifikante Teile der Wilden Dämonenhorde in den Limbus. Gul’Dukan überlebte und kehrte eiligst nach Yal-Mordai zurück, wo er Al’Hrastor verkündete, dass die Reste der Horde nun bereit seien für die Todesschwadron.
Die Unterwerfung der Wilden Horde
Die Horde, dank der Explosion auf ein gutes Drittel ihrer vorherigen Kopfstärke dezimiert, wurde von Jil’Kaedos schließlich mit Hilfe eines geheimnisvollen Artefakts unter seinen Willen gezwungen. Der Dämon konnte und wollte nicht dulden, dass eine im wahrsten Sinne des Wortes Horde von blutberauschten Emporkömmlingen Samiras Sache zunichtemachte. Er gedachte den erneuten Verrat Gul’Dukans zu seinem Vorteil zu nutzen. Als Dämonen waren die Hordler deutlich mächtiger als in ihrer ursprünglichen sterblichen Gestalt.
Al’Hrastors Zelothim waren auf eine solche Auseinandersetzung bestens vorbereitet. Gegen bewaffnete Krieger war ihre Macht begrenzt, Dämonen indes konnten sie beschwören, bannen, ihrem Willen unterwerfen oder befehligen, ganz wie es ihnen beliebte. Jil’Kaedos Vorstoß auf Yal-Mordai endete für Samiras Feldherrn in einem Desaster. Ein Hordler nach dem anderen wandte sich gegen ihn, schloss sich den Feinden an und ging dann auf seine Kameraden los, die entweder erschlagen wurden oder ihrerseits die Fronten wechselten.
Ogrin Sphärenaxt und Durthan ergriffen daraufhin die Flucht und wurden, nachdem sie die gesamte Tragweite von Al’Hrastors Intrige erkannt hatten, zu seinen erbitterten Feinden, die während seiner Eroberungskriege signifikante Teile des Widerstandes organisierten. Jil’Vaedos indes entschloss sich zur Flucht und konnte nach seiner Rückkehr nach Argos Samira nur mit Mühe davon überzeugen, dass seine Niederlage unvermeidlich gewesen war. So fiel seine Strafe mild aus und beschränkte sich auf hundertjährige Agonie.
Das Ende der Wilden Horde
Al’Hrastor, noch immer schwankend, ob er sich Amazth zur Gänze unterwerfen oder ihn vom Thron jagen sollte, konnte nicht umhin, die Neudämonen, welche seine Zelothim unter Kontrolle gebracht hatten, direkt in Amazeroths Domäne zu schicken, wo sie künftig die Reihen der Diener des Erzdämons verstärkten. Hrastor gab in dieser Hinsicht den Ton an und duldete keinen Widerspruch.
Den Sieg über die Wilde Horde verkaufte Al’Hrastor den Stadtstaaten, die nicht einmal näherungsweise mitbekommen hatten, was sich tatsächlich abgespielt hatte, als glorreichen Sieg der Todesschwadron, der gemeinsamen Truppe aller Sanskitarenstädte. In opulenten Worten pries er die Vorzüge der Zusammenarbeit zwischen den Stadtstaaten, die gemeinsame Stärke und die Notwendigkeit derselben im Angesicht machtvoller Feinde.
Die Gründung des Sanskitarischen Städtebundes
So ging die Freiheit unter – mit donnerndem Applaus. Genau an Al’Hrastors hundertstem Geburtstag im Jahre 712 BF vereinigten sich die Sanskitarischen Stadtstaaten zu einem neuen Reich, dem Sanskitarischen Städtebund, dem Al’Hrastor selbst als Herrscher vorstand. Yal-Mordais Stadtfürst bekräftigte, wie ernst es ihm mit dieser Position war, indem er den Titel „Diamantener Sultan“ annahm und damit dieselbe Legitimation für seine Herrschaft beanspruchte, mit der die Kunkomer über ihre Kolonien geherrscht hatten. Bedeutender aber erscheint, dass der namensgebende Diamant nichts geringeres ist als der Karfunkel des Alten Drachen Pyrdacor, Vater exakt jenes Drachendämons Merclador, der Al’Hrastor immer und immer wieder beeinflusst und in ihm überhaupt erst den Wunsch erweckt hat, Diamantener Sultan zu werden. Der Bogen der Ereignisse lässt sich damit vom Jahr 2.099 v. BF, in dem Merclador dafür Sorge trug, dass der Karfunkel seines Vater nicht zerschlagen wurde, bis zu Al’Hrastors Machtergreifung unter Mercladors Einfluss im Namen eben jenes Diamanten spannen.
Der Sanskitarische Städtebund, die Burumer und der Krieg zur See
Mit der Gründung des Sanskitarischen Städtebundes, auch Neues Reich, Rakshazastan oder Diamantenes Sultanat genannt, trat der bislang im Verborgenen agierende Rat der Schemenhaften in das Licht der Öffentlichkeit und beanspruchte weitreichende Befugnisse in den Städten. Nur in Yal-Mordai, das ohnehin ganz im Sinne des Rates regiert wurde, blieben die Organisationsstrukturen unverändert. In den übrigen Stadtstaaten rückten Angehörige des Rates in Schlüsselpositionen auf. Die schemenhaften Beamtenpriester waren den Sterblichen unheimlich und wurden von ihnen ehrfurchtsvoll die „Schatten“ genannt.
Die Schatten
Um den neuen Machthabern ihren Schrecken zu nehmen, erklärte der Kult des Phex die Schatten zu Gesandten des Fuchsgottes. Von nun an bemühten sich die Sanskitaren um die Gunst des Unsterblichen, der auch als Gott der Juwelen verehrt wurde, weil sie glaubten, dass dies die Schatten gnädig stimmen werde. Der bis dahin eher unbedeutende Kult stieg somit zur machtvollsten Glaubensgemeinschaft neben der des Amazth auf. Der Rat der Schemenhaften hätte die Anmaßung der Hohenpriester des Phexkultes gewiss bestraft, hätten die Gläubigen des Kultes ihnen nicht große Mengen an Geschenken und Opfergaben dargebracht und sie zu Wesen von beinahe gottgleichem Rang stilisiert. Ein Verhalten, mit dem sie schlussendlich die Macht des Amazth mehrten, dem die Schatten tatsächlich dienten. Das Arrangement wurde auf diese Weise zur Win-Win-Situation für die Anhänger des Amazth und des Phex. Vom Wirken dieser ungewöhnlichen Allianz profitierte auch Al’Hrastor selbst, der für eine Weile ebenfalls kultische Verehrung genoss, immerhin galt er ja als der Sohn eines der Schatten.
In der Anfangsphase gehörten dem Reich sämtliche Sanskitarischen Stadtstaaten an, Yal-Mordai, Yal-Amir – das heutige Arkimstolz –, Yal-Kharibet – das heute Yal-Kalabeth –, Ribukan und Shahana.
Die Opposition der Burumer
Sobald sich Al’Hrastor zum Diamantenen Sultan ausgerufen hatte, erwuchs ihm aus den Reihen der Städter ein neuer Feind, mit dem der neue Herrscher Rakshazastans nicht gerechnet hatte. Längst schon war Shahana die Heimat der Burumer und ihrer Nachfahren geworden, die einst aus Aranien bzw. El’Burum geflohen waren, nachdem sie gegen das Diamantene Sultanat und seinen Herrscher revoltiert hatten. Die Feindschaft mit dem Sultan blieb auch nach ihrer Ankunft im Riesland eine wesentliche Triebfeder. Als Freibeuter hatten sie die Tributeintreiber des Diamantenen Sultanats überfallen. Dies hatte gemeinsam mit der zunehmenden Bedrohung der Kunkomer-Schiffe durch die Rirgit zu der Entscheidung des Diamantenen Sultans geführt, die Rieslandfahrten einzustellen, da sie von nun an als zu riskant und nicht mehr lukrativ genug erschienen. Als das Diamantene Sultanat mit Sheranbil V. und Azuri ibn’Zalahan erneut seinen Einfluss auf die riesländischen Kolonien ausdehnte, zeigte sich Shahana dank seiner burumischen Prägung abermals aufsässig. Der alte Konflikt schien überwunden, seit das Diamantene Sultanat 17 v. BF gefallen und Teil des Bosparanischen Reiches geworden war und seit Bosparans Fall zum Raulschen Reich gehörte. Doch mit dem Auftreten eines Herrschers, der sich auf die Tradition des Diamantenen Sultans berief, flammten die alten Animositäten wieder auf. Da sich die Stadtführung Shahanas weigerte, sich Al’Hrastor in offener Rebellion entgegenzustemmen, erinnerten sich viele Burumer an ihre Vergangenheit und fuhren wieder als Freibeuter zur See, um die Schiffe des Sultanats zu überfallen. Sehr zu Al’Hrastors Ärger schwang Shahanas Stadtfürst zwar martialische Reden in Richtung der Piraterie, hielt jedoch heimlich seine schützende Hand über die brumischstämmigen Freibeuter, die in Shahana einen sicheren Hafen fanden. Der Sultan war sich sicher, dass die Stadtführung die Feinde deckte, konnte dies jedoch einstweilen nicht beweisen.
Für Al’Hrastor war dies ein doppeltes Ärgernis, weil er nach der unerwarteten Verbrüderung des Amazth- mit dem Phexkult die Gelegenheit ergriffen hatte und die Kontakte des Phex-Kultes nutzte, um seine Macht in Zukunft verstärkt auf den Handel zu stützen, vor allem auf den Handel zur See. Als lukrativste Einnahmequelle erwies sich der Austausch von Waren und Dienstleistungen zwischen den sanskitarischen Städten, welcher auch deshalb zu Al’Hrastors wichtigstem machtpolitischen Instrument wurde, weil er die Abhängigkeit der übrigen Stadtstaaten von Yal-Mordai zementierte. Aber auch die Ipexcostadt Lubaantuna, das amhasische Amhalashal und der Nagah-Hafen Sseleuhaan wurden von Yal-Mordais Schiffen angefahren. Lediglich Unlon mit der Stadt Namakari, einst wichtigster Handelspartner der Sanskitarenstädte, entzog sich zu Al’Hrastors großer Enttäuschung jedem Versuch einer Entdeckung.
Auf dem Landweg trieb Yal-Kharibet weiterhin Handel mit Teruldan, seltener mit Amhas oder Kurotan. Shahana und Yal-Amir standen in losem Handelskontakt mit Jalkam, Ribukan mit den Siedlungen der Nagah. Al’Hrastor spannte den Phexkult ein, um auf sämtlichen Handelsrouten einen Fuß in die Tür zu bekommen und zumindest daran mitzuverdienen.
Piraterie wurde wieder zu einem einträglichen Geschäft, seit sich zahlreiche Handelsschiffe auf den Meeren ein Stelldichein gaben, und Erzählungen von erfolgreichen Kaperfahrten der burumischen Freibeuter stachelten auch die Freibeuter anderer Städte und unabhängige Piraten, die ihre Basis meist auf den Jominischen Inseln hatten, dazu an, ihr Glück im Überfallen der mit reich beladenen Handelssegler zu suchen. Auch die Schwarzen Galeeren der Amhasim aus Amhalashal erwiesen sich als zäher und zunehmend gefährlicher Gegner. Für Al’Hrastor bedeutete dies, dass er für Geleitschutz sorgen musste, und er beschränkte sich nicht allein darauf, kleinere Kriegsschiffe zu bauen, sondern nahm die Schwimmende Festung Yal-Mordais in Dienst.
Die Schwimmende Festung von Yal-Mordai
Bisher hatte keine Notwendigkeit bestanden, das schwerfällige Kriegsgerät in Betrieb zu setzen, und selbst jetzt gab es kleinere, wendigere Schiffe, deren Einsatz mehr Wirkung erzielte. Dennoch wollte Al’Hrastor auf dieses machtpolitische Instrument nicht verzichten. Die Schwimmende Festung war eine nicht immer effiziente, aber doch beeindruckende und martialisch wirkende Machtdemonstration, welche die Feinde Yal-Mordais einschüchtern und zum Einlenken bewegen sollte.
Eine Schwimmende Festung ist ein wahrer Palast mit mehr als zweihundert Schritt Kantenlänge, fünf Stockwerke hoch über das Wasser hinausragend, jedes einzelne so groß und geräumig, dass selbst ein Troll leicht darin hätten hausen können, ohne sich auch nur bücken zu müssen. Und angesichts der mutmaßlichen Geschichte des Imperiums schien es nicht unwahrscheinlich, dass die Festungen in der Vergangenheit auch Trolle oder gar Riesen beherbergt hatten. Mit Hilfe einer magischen Krone, von denen es für jedes Schiff eine einzelne gab, ließ sich das schwerfällige Bollwerk nach Belieben steuern. Seit Al’Hrastor ist der Besitz der Krone Yal-Mordais eng mit der Sultanswürde verbunden.
Während die Schwimmende Festung Yal-Mordais in der Gegenwart keine große Primärwaffe mehr hat und mit Steinschleudern auf den vier Ecktürmen oder Bogenschützen auf der Festungsmauer bestückt wird, war diese in der fraglichen Zeit noch existent. Damals wie heute konnten auf den Türmen schwere Geschütze stationiert werden. Zu jener Zeit waren die Anlagen allerdings noch intakt. Heute werden die Türme notdürftig mit Lehmziegeln und Kupferplatten geflickt. Ein Erker ist nur noch durch bronzene Ketten daran gehindert, ins Meer zu rutschen. Dennoch zählt die Festung bis in die Gegenwart hinein zu dem Mächtigsten, was je auf den Ozeanen Deres gefahren ist.
Weitere Festungen
In Ribukan und Shahana begaben sich Al’Hrastors Leute gezielt auf die Suche nach der jeweiligen Schwimmenden Festung. Nach allem, was Al’Hrastor in seiner Zeit bei den Nagah in den alten Schriften gelesen hatte, hatten alle großen Küstenstädte des untergegangenen Imperiums eine solche Waffe besessen. Wie viele solcher Festungen es geben mag, ist bei den Gelehrten sehr umstritten. Einige reden von sieben, andere gar von neun. Es gibt sogar Gerüchte, die von einer Flotte des Güldenen Gottes sprechen, die aus nicht weniger als 99 dieser Ungetüme bestehen soll. Bekannt sind allerdings gerade einmal vier der Festungen, von denen gegenwärtig nur noch eine einzige voll einsatzfähig ist.
Ribukans Festung wurde 721 BF in einer unterhalb des Palastes gelegenen, künstlich angelegten Kaverne mit Zugang zum Meer gefunden, einschließlich der zu ihrer Steuerung erforderlichen Krone, die erst verlorenging, als Salpikon Savertin die Flucht aus der Stadt antrat und das Artefakt mit nach Aventurien nahm. Seither liegt die Festung regungslos etwa eine halbe Meile vor Ribukan, und auf der Festung gilt ebenso wie für die Stadt ein Verbot, das Soldaten den Aufenthalt untersagt.
Die Schwimmende Festung Shahanas fand sich drei Jahre später in der pflanzenüberwucherten Mündung des Kree. Während der gegenwärtige Sultan, Arkamin IV. von Shahana, sie in einen Schwimmenden Garten verwandelt hat, war sie damals vollständig einsatzbereit.
Die verschollene Festung von Namakari
Zu Al’Hrastors persönlichem Verdruss blieb die Festung von Namakari verschollen. Um die Festung rankten sich, ebenso wie um die ganze Stadt, zahlreiche Mythen und Legenden. In den Kavernen von Namakari soll ein Brunnen zu finden sein, dem man das Wasser des ewigen Lebens entnehmen kann, bewacht von untoten Menschenfressern und halb verwesten Trollen. Auch die Krone der Festung wird in einer unterirdischen Höhle vermutet, und ihr Besitz soll einen Sterblichen unbesiegbar machen, ihn allerdings auch zu einem Dasein als Untoter verdammen. In den Türmen der Schwimmenden Festung sollen Gold und Perlen in unglaublichem Ausmaß lagern. Jedem, der diese Schätze berührt, fault angeblich die Hand ab. Das Haus bzw. der Palast Shesals, des Totengottes der Parnhai, soll sich ebenfalls in den Mauern der Festung befinden.
Der Krieg zur See
Der Einsatz der schwimmenden Bollwerke wirkte auf die Freibeuter und Piraten ebenso abschreckend wie provokativ. Viele von ihnen empfanden den Einsatz der gewaltigen Kriegsschiffe als völlig unverhältnismäßig. Eine martialische und schier größenwahnsinnige Machtdemonstration gegenüber einem Gegner, dem schlussendlich nur daran gelegen war, seine Freiheit zu verteidigen. Die Festungen wurden zu unübersehbaren Symbolen von Al’Hrastors frevelhafter Tyrannei, eine Ansicht, die von den Freibeutern und Piraten bis weit in die Bevölkerung der Stadtstaaten hineingetragen und auch dort mehr und mehr salonfähig wurde.
Hin und wieder schlossen sich kühne und wagemutige Kapitäne zusammen und versuchten eine der Festungen durch konzertierte Aktionen zu zerstören, was meistens mit der Vernichtung der Angreifer endete. Erfolgreich war keines dieser Unterfangen. Allerdings gelang es im Laufe der Jahrhunderte, den Festungen empfindliche, teils irreparable Schäden zuzufügen, besonders zu Kriegszeiten, von denen es während Al’Hrastors Herrschaft noch eine ganze Menge geben sollte. Am ramponierten Zustand von Yal-Mordais Festung ist zu sehen, dass die Festungen nicht unzerstörbar sind. Einen echten Erfolg gegen sie zu erringen ist allerdings mühselig und kostet gewaltige Opfer.
In der Regel verlegten sich Freibeuter und Piraten darauf, den Ungetümen aus dem Weg zu gehen und Handelsschiffe ohne oder mit nur geringem Geleitschutz aufzubringen. Gelang ein solches Unterfangen, konnten die gekaperten Reichtümer eingesetzt werden, um bessere Schiffe anzuschaffen oder weitere Mannschaften zu unterhalten. Piraterie war somit ein lukratives Geschäft, und jeder erfolgreiche Coup führte dazu, dass sich die Zahl aktiver Seeräuber erhöhte.
Berühmte Piraten und Freibeuter
Legendäre Namen wie Bethor der Blutsäufer, Einauge, Schwarzkralle, Igzorn von Shahana, Halef ibn Omar, Monolus und nicht zuletzt El Qursan, der König der Piraten, wecken bis heute die Sehnsucht nach dem Meer, dem Abenteuer und dem schnellen Reichtum. Die Realität freilich sieht anders aus. Das Leben auf den Piratenschiffen ist hart und entbehrungsreich, die Kapitäne herrschen mit eiserner Hand und ahnden Verfehlungen gegen den Kodex mit krakonischen Strafen. Nicht selten sind die Mannschaften von Krankheit und Mangelernährung gezeichnet.
Kampf um Teruldan

Die Jahre nach der Gründung des Sanskitarischen Städtebundes ließen dem frischgebackenen Diamantenen Sultan Al’Hrastor nicht viel Zeit, sich der Erforschung des Goldenen Netzes zu widmen. Deshalb nahm sich der Rat der Schemenhaften der Sache an. Gemeinsam mit den Amazäern und den Zelothim verwendeten die Schatten die Karte, die Al’Hrastor auf seinen Reisen angefertigt hatte, als Basis und bemühten sich um einen Beweis für die Theorie, dass das ohnehin beschädigte Goldene Netz des Rieslands zum Kollabieren gebracht werden könne und der endgültige Kollaps die Schöpfung zerstören würde. Al’Hrastor ließ sich regelmäßig über neue Forschungsergebnisse unterrichten, ohne seinen Verbündeten mitzuteilen, dass er auch an der exakt gegenteiligen Fragestellung interessiert war – ob das Kraftliniennetz repariert werden könnte.
Merclador beteiligte sich auf seine Weise an den Forschungen. Nicht nur, weil er seit über zweitausend Jahren mit dem Thema befasst war und den Amazeroth-Kult überhaupt erst darauf gebracht hatte, sich der Sache anzunehmen, sondern weil die Lösung des Rätsels für ihn womöglich die einzige Chance darstellte, seine Freiheit wiederzuerlangen. Wenn Al’Hrastor das Goldene Netz wiederherstellte, würde er sich wahrscheinlich soviel von Marhynas Astralkraft nutzbar machen können, dass es ihm gelingen mochte, Amazeroths Herrschaft zu brechen und an seine Stelle zu treten. Dann konnte er Merclador, der ihm geholfen hatte, so weit zu kommen, die Freiheit zurückgeben. Der Quitslinga wuselte von Forschergruppe zu Forschergruppe und sammelte Informationen. Wie er es erwartet hatte, gönnte die eine Gruppe der anderen den Erfolg nicht. Jede Gruppierung hielt Erkenntnisse vor den anderen geheim, um ihren Wissensvorsprung zu bewahren. Merclador sorgte dafür, dass ihre selbstsüchtigen Pläne nicht aufgingen, indem er verbreitete, was die anderen nicht preisgeben wollten.
Es begann sich herauszukristallisieren, dass sich das Goldene Netz tatsächlich manipulieren ließ, in der einen wie in der anderen Richtung. Wenn man ihm astrale Kraft zuführte, konnte dies gleichermaßen zu einer Stablisierung wie zu einer Destablisierung von Madas Knochen führen, je nachdem, auf welche Weise man vorging. Die Manipulation der Kraftlinien war besonders erfolgreich, wenn sie an einem Nodix oder Nexus erfolgte. Al’Hrastor hatte die meisten von ihnen ausgekundschaftet, und wenig überraschenderweise befanden sich die bedeutendsten von ihnen dort, wo sich die größten Siedlungen, die mächtigsten Ruinen und die mystischen Orte des Kontinents erhoben. Teils instinktiv, teils mit voller Absicht hatten die Völker Rakshazars dort gesiedelt, wo die magischen Ströme am stärksten waren.
Hrastor fand, dass es an der Zeit sei, den Einfluss Yal-Mordais auf eine Vielzahl solcher Orte auszudehnen. Gewiss würde es den Forschern eines Tages gelingen, das Rätsel zu lösen, und dann würde es vielleicht vonnöten sein, rasch zu handeln und die Schöpfung auf Basis der Forschungsergebnisse sogleich zu zerstören. Schließlich waren die Götter neidisch und versuchten jene, die erfolgreich waren, um die Früchte ihrer Arbeit zu betrügen. Dem Namenlosen war genau das passiert, und in dieser Hinsicht hatte er das Mitgefühl von Amazeroths Dienern, obwohl diese ihn ansonsten nicht ausstehen konnten.
Al’Hrastor war sich nach wie vor unschlüssig, ob er die Zerstörung der oder die Herrschaft über die Schöpfung anstreben sollte. Hrastors Drängen, die Kontrolle über die Nodices an sich zu reißen, war dennoch vollkommen deckungsgleich mit seinen eigenen Ambitionen. Egal, ob er sich entscheiden würde, die Reparatur oder den Kollaps des Kraftliniennetzes zu verursachen, Zugriff auf eine Vielzahl von Nodices und Nexus benötigte er dafür in jedem Fall. Zugleich galt es, die Herrschaft der eifersüchtigen Götter und ihrer Kulte zu brechen, die sich ansonsten gewiss erneut in diese Angelegenheit einmischen würden, und die ging sie nicht das Geringste an.
Hrastor, Al’Hrastor und ihre vertrautesten Feldherren begannen Kriegspläne zu schmieden. Der Schlüssel zur Herrschaft über den Kontinent war Amhas, doch die mächtige amhasische Republik anzugreifen wäre zum aktuellen Zeitpunkt einem Selbstmordkommando gleichgekommen. Der Seeweg führte durch das tückische Schwarze Wasser innerhalb des Totenwassers und wurde zudem durch die mächtige Festung Amhalashal geschützt. Über Land musste man das Yal-Hamat-Gebirge queren, ein gefährlicher Weg mit zahllosen Barrieren und Unwägbarkeiten. Außerdem war Amhas viel zu mächtig, um es mit den begrenzten Ressourcen des Sultants zu Fall zu bringen. Wenn ein solches Unternehmen erfolgreich sein sollte, musste es Al’Hrastor gelingen, die Feinde von Amhas unter dem Banner Yal-Mordais zu vereinen. Die Unterwerfung der Nagah und der Ipexo schien lohnenswert zu sein. Auf ihren Territorien befand sich jeweils eine Vielzahl an Nexus, und wenn es gelang, sich ihrer Besitztümer zu bemächtigen, konnte dies weitere Kriege im Norden finanzieren.
Schließlich entschieden sich Hrastor und Al’Hrastor aber doch für einen anderen Gegner, nämlich die Xhul-Stadt Teruldan. Das einstige Tebuga, gegründet von den Xhalori, stand ähnlich wie die meisten Sanskitarenstädte auf den Ruinen einer alten Marhynianischen Stadt. Es hatte lange unter dem Schutz des alten Amhas gestanden und mit dessen Fall seine Unabhängigkeit zurückerlangt. Gegenwärtig gehörte die Siedlung den Xhul, die dort gemeinsam mit etlichen Reiternomaden lebten, und hatte sich zu einem blühenden Handelsposten mitten in der Wüste Lath entwickelt, Anlaufpunkt für Karawanen aus dem Süden, Händler aus Kurotan, Ronthar und der Targachisteppe und für den Kithorra-Handel. Mit Teruldans Reichtümern konnte Yal-Mordai seine Finanzen entscheidend aufbessern. Außerdem lag die Stadt an einer strategisch wichtigen Position. Wer sie kontrollierte, beherrschte die Wüste Lath, und diese war wahrscheinlich der beste Weg, um Truppen von den Stadtstaaten in Richtung Amhas zu schicken.
Der Rat der Schemenhaften, die Amazäer und die Zelothim begannen, in den sanskitarischen Stadtstaaten die Stimmung gegen die Xhul und ihre Götter anzuheizen. Man bezichtigte Lath nicht zu Unrecht, eine Dämonin zu sein, auch wenn ihr dies ironischerweise von den Kulten Amazeroths zum Vorwurf gemacht wurde. Den Xhul drängte man damit den Stempel „skrupellose Dämonendiener“ auf, welche es zu bestrafen galt. Dass auch die anderen Xhul-Götter von zweifelhaftem Ruf waren, kam Al’Hrastor dabei sehr zugute. Der Fremde Krieger vermochte kaum zu kaschieren, dass sich hinter ihm der Namenlose verbarg, und Janga-Rhumat verkörperte Aspekte, wie sie Marhyna zu Eigen waren, eine Gottheit, die nicht nur unter den Sanskitaren verhasst war, und trug auch Züge der Brokthar-Gottheit Rontja. Als Al’Hrastor 734 BF den Heiligen Krieg ausrief, um das Riesland von den falschen Göttern zu befreien, folgten ihm die Sanskitaren-Städter mit Jubelgeschrei, und es gelang Yal-Mordai sogar, einige der bedeutendsten Stämme der Reiternomaden zur Neutralität zu verpflichten.
Niemand konnte ahnen, dass die Belagerung Teruldans beinahe sieben Jahre dauern würde. Erst 741 BF fiel die Wüstenmetropole. Die Sanskitaren hatten in der Wüste mit allerlei Widrigkeiten zu kämpfen. Die Hitze des Tages machte ihnen zu schaffen, und ebenso die Kälte der Nacht. Gefährliche, teilweise giftige Tiere setzten ihnen zu, und zuweilen gelang es nicht, den Nachschub an Nahrung und Wasser sicherzustellen. Die Xhul indes verschanzten sich hinter den mächtigen Mauern Teruldans, förderten Wasser mit Hilfe ihrer Pumpsysteme und ließen sich von den Donari mit Nahrung und anderen dringenden Gütern beliefern. Eine kostspielige Angelegenheit, welche sich die reiche Stadt jedoch durchaus leisten konnte, zumal sich über die limbischen Pfade sogar ein Teil des Handels aufrechterhalten ließ. Zugleich brachte Teruldan den Sanskitaren empfindliche Verluste bei, sobald diese versuchten, die Befestigungen zu stürmen. Die Xhul kamen dabei ungeschoren davon, denn sie kämpften nicht selbst, sondern schickten den Angreifern Kreaturen entgegen, die ihre Bestienmeister ausgebildet hatten, oder Traumgestalten, die sie aus der Traumzeit beschworen hatten. Zelothim, denen es gelang, in die Stadt vorzudringen, wurden von einer Übermacht förmlich überrannt und getötet oder zum Rückzug gezwungen.
Al’Hrastor, zunehmend frustriert vom schleppenden Kriegsverlauf, rief daraufhin den Ärztekongress ins Leben. Es handelte sich um eine Vereinigung von Amazäern, Zelothim, Meuchlern und anderen professionellen Giftmischern, Anatomen, Apothekern, Heilkundigen, Nekromanten, Priestern verschiedener Todesgötter und Rauschmittelköchen, welche den Auftrag erhielten, die Gesundheit der sanskitarischen Truppen zu befördern, etwa indem sie die Feinde des Reiches vom Leben in den Tod beförderten. Der Ärztekongress debattierte hitzig und konnte sich zunächst nicht auf ein gemeinsames Vorgehen einigen, was sich änderte, nachdem rund die Hälfte der Beteiligten, die anderen Kongressteilnehmern unerwünschte Widerworte gegeben hatten, merkwürdigen Unfällen, Drogenmissbrauch, Lebensmittelunverträglichkeiten und allerlei Verdauungsstörungen zum Opfer gefallen war.
Die verbleibenden Kongressteilnehmer unterwarfen sich dem Willen von Sylvana Morrigan, Erzmagierin und Rektorin der Akademie der Schatten zu Ribukan, eine anerkannte Kapazität auf den Gebieten Heilung, Verwandlung und Anatomie und ebenso vertraut mit deren Schattenseiten. Dank ihren skrupellosen Forschungen an Sklaven, Strafgefangenen und politischen Gegnern hatte Sylvana den menschlichen Körper genauestens erkundet und kannte beinahe jede Möglichkeit, ihn zunächst vom Leben in den Tod zu befördern und dann vom Tod in den Untod. Ihre Methoden waren nur von schwacher Magie erfüllt – eine Armee aus Zombies, von starker Magie zum Unleben erweckt, hätte die Gefahr eines Kritische-Essenz-Effektes geborgen. Die Rektorin arbeitete deshalb mit anderen Mitteln, starken Giften, Rauschkräutern, schwachen Heil- und Verwandlungszaubern. Das Ergebnis war ein Trank, welcher das Opfer vergiftete und umbrachte, seinen Körper jedoch vor Verwesung bewahrte. Dann wurde das Gehirn des Toten in etwas anderes transformiert, eine Wesenheit mit eigenem Willen, den meisten ihrer einstigen Fähigkeiten und den Erinnerungen an ihr früheres Leben, jedoch mit vollkommen unterschiedlicher Persönlichkeit, zu deren Prämissen es gehörte, weitere ihrer Art zu erschaffen, sich mit ihnen zusammenzuschließen und die Macht an sich zu reißen. War der Transformationsprozess beendet, erwachte der Verstorbene zu unheiligem Unleben.
Natürlich hatte Morrigan kein Interesse daran, dass eine solche Seuche sich unkontrolliert ausbreitete, daher hatte sie einen Sicherheitsmechanismus ersonnen. Der Trank wurde mit ihrem Blut und Schweiß angereichert. Jeder Untote, der durch ihn entstand, erkannte Sylvana unweigerlich an ihrem Geruch und würde sich ihrem Befehl unterwerfen. Der Ärztekongress beschaffte die benötigten Zutaten und fertigte große Mengen des Gebräus.
Es oblag Merclador, die Seuche in Teruldan zu verteilen. Es gelang dem Dämon, in Gestalt eines Xhul in die Stadt zu schleichen und einige der Brunnen zu vergiften. Zum Entsetzen der Stadtbewohner verwandelten sich später dutzende von ihnen in seelenlose Geschöpfe. Diese besetzten Teile der Stadt und richteten unheimliche Brauereien ein, in denen sie einen furchtbaren Trank mixten, den sie jedem einflößten, den sie in der Finger bekamen, und der zur Folge hatte, dass auch das Opfer sich in einen grässlichen Untoten verwandelte. Jene, die sich den Zombies in den Weg stellten oder sich der Verwandlung erfolgreich widersetzten, wurden getötet und ausgeschlachtet. Augenscheinlich ergaben ihre Körper hervorragendes Rohmaterial für den Seuchentrunk. Die Bewohner der Stadt setzten sich erbittert gegen die Untoten und die Ausbreitung der Seuche zur Wehr, und womöglich hätten ihre Bemühungen Erfolg gehabt, wenn sich der Moloch Altstadt nicht einmal mehr als unkontrollierbar erwiesen hätte. Binnen einer Woche hielten die Zombies sie vollkommen unter Kontrolle und schafften es von dort aus, weitere Wasserreservoirs mit der Seuche zu infizieren.
Die Einwohner Teruldans sahen unter diesen Umständen keine Chance mehr, ihre Stadt zu retten. Sie nahmen Verhandlungen mit den Belagerern auf und erklärten ihre Kapitulation unter der Bedingung, dass die Eroberer den Aggressoren den Untoten Einhalt gebieten sollten. Noch am selben Tag rückte Al’Hrastors Feldherr Artaros Pandrigal nebst seinen Truppen in Begleitung von Sylvana Morrigan in die Stadt ein. Ihre Mission schien klar. Morrigan sollte das Kommando über die Untoten übernehmen und sie in Artaros‘ Armee überführen. Gemeinsam würden die lebenden und untoten Truppen des shahanischen Kriegers gegen den nächsten Feind des Reiches vorrücken.
Bis zum späten Abend sah es so aus, als würde der Plan reibungsfrei vonstatten gehen. Die Untoten unterwarfen sich Morrigans Willen, gehorchen ihrem Befehl und schlossen sich den Besatzern unter Feldherr Pandrigal an. Doch die Sonne ging unter, und in der Dunkelheit war die Wahrnehmung der menschlichen Besatzer beschränkt, nicht jedoch die der Zombies. Einer von ihnen, den Sylvana noch nicht ihrem Willen unterworfen hatte, schleuderte vom Dach einer Taverne einen schweren Stein auf die Magierin. Diese konnte nicht rechtzeitig ausweichen, wurde hart am Kopf getroffen und ging ohnmächtig zu Boden. Da es somit niemanden mehr gab, der die Untoten befehligen konnte, fingen diese sofort an, gegen Pandigrals Soldaten vorzugehen, die sich plötzlich in einen Kampf auf Leben und Untod verwickelt sahen.
Andere Zombies brachten Morrigans Körper an sich, zerrten ihn außer Reichweite potenzieller Bedrohungen und flößten der ohnmächtigen Zauberin den Trank ein. Bis zum Morgengrauen hatte Artaros Pandrigal die Hälfte seiner Leute verloren, allerdings war es ihm auch gelungen, die Zahl der Zombies auf ein Drittel zu reduzieren. Ein Kampf bis aufs Blut, auf Messers Schneide stehend, der das Schicksal Teruldans entscheiden würde.
Beide Seiten formierten sich und rüsteten zur Schlacht, als plötzlich Sylvana Morrigan das Feld betrat. Wie zuvor unterwarfen sich die Untoten ihrem Befehl, doch nunmehr war Morrigan eine von ihnen. Der Trank hatte seine Wirkung nicht verfehlt. Sylvana kannte ihren einstigen Verbündeten und wusste, dass er versuchen würde, sie und die übrigen Zombies vollständig auszulöschen, bevor ihre Zahl so groß werden würde, dass sie zu einer unkontrollierbaren Gefahr wurden. Sie befahl den Untoten, sich von Artaros nicht in die Schlacht zwingen zu lassen, und zog sich mit einigen von ihnen, die sich auf das Brauen des Tranks verstanden, in die Tiefen der Altstadt zurück. Die Zombies verbarrikadierten die Wege, verschanzten sich in den Häusern, beschossen Pandrigals Truppen von oben herab aus gedeckter Position und zwangen Al’Hrastors Truppen somit zu einem langwierigen und blutigen Häuserkampf, in denen sie Schritt für Schritt jedes Gebäude von den Untoten säubern mussten, um auch nur den Hauch einer Chance zu haben, tiefer in die Altstadt vorzudringen. Genug Zeit für Morrigan und ihre Verbündeten, mehr von dem Trank zu brauen, weitere Brunnen zu verseuchen und somit die Reihen der Untoten wiederaufzustocken.
Dank der unterirdischen Anlagen und Pumpstationen schaffte es Sylvana, in den Rücken des Feindes zu gelangen. Auf einmal sah sich Artaros von beiden Seiten von Untoten eingekreist. Sylvana war sich im Klaren darüber, dass es ihr nichts nützen würde, Teruldan zu erobern. Sie würde die Stadt auf Dauer nicht halten können. Al’Hrastor würde erfahren, was hier geschehen war, und ein Heer nach Teruldan senden, notfalls die gesamte sanskitarische Armee. Die Donari, welche den Stadtbewohnern gegen die Belagerer beigestanden hatten, würden keine gemeinsame Sache mit Zombies machen und stattdessen die Eroberer unterstützen. Es war nur eine Frage der Zeit, bis die Sanskitaren die Stadt stürmen und die Untoten vernichten würden.
Allerdings hatte Sylvana die Macht, hier und heute Pandrigal und allen, die unter seinem Kommando standen, den Garaus zu machen. So trat Morrigan vor und unterbreitete dem shahanischen Feldherrn ein überraschendes Angebot. Sie würde ihn und seine Leute verschonen, jedoch unter der Bedingung, dass er ihr und allen Untoten freies Geleit aus der Stadt gewähren würde. Alles in Artaros sträubte sich gegen ein solches Ansinnen. Wenn nur ein einziger der Untoten entkam und es schaffte, sich der Kontrolle Yal-Mordais zu entziehen, konnte er neue von seiner Art erschaffen. Schlimmer noch, wenn Sylvana entkam, die alles über den Trank und über ihre Schöpfung wusste. Unter ihrer Führung konnten die Zombies zu einer furchtbaren, alles vernichtenden Armee heranwachsen.
Doch Artaros hatte keine Wahl. Wenn er den Untoten den Abzug verweigerte, würden sie ihn und seine Männer niedermachen und Teruldan trotzdem unbehelligt verlassen. Sie würden zuvor Verluste erleiden und sie würden Zeit verlieren, um Abstand zwischen sich und Al’Hrastors Truppen zu bringen, aber nicht in hinreichend großem Maße, um den Tod von Pandrigals gesamter Armee zu rechtfertigen. Zähneknirschend willigte Artaros ein, und so zog Sylvana Morrigan mit einer Armee von über eintausend untoten Xhul in die Lath hinaus.
Eiligst ordnete Artaros an, die Stadt zu sichern, bevor die schockierten Bewohner Teruldans auf die Idee kommen konnten, einen Aufstand gegen ihre neuen Herrn anzuzetteln, die gerade eine riesige Armee von Untoten hatten entkommen lassen, welche sich in Zukunft als unbesiegbare Bedrohung erweisen mochten.
Tatsächlich brauchte Al’Hrastors Nachschub unter dem Kommando seines Generals Mort beinahe eine Woche, um Teruldan zu erreichen. Artaros, der in dieser Woche mehr schlecht als recht eine Revolte der Xhul verhindert hatte, wurde zur Strafe für sein Versagen einen Kopf kürzer gemacht. Mort unterstellte Pandrigals Truppen dem Befehl seines Stellvertreters Toral, stockte sie um genug Bewaffnete auf, dass die Besatzung Teruldans sichergestellt war, und setzte mit den übrigen Kriegern Sylvana nach, deren Zombies in der Wüste deutlich sichtbare Spuren hinterlassen hatten.
Doch die Spuren endeten mitten in der Lath, dort, wo es nichts anderes gab als endlosen Sand. Was immer sie getan hatte, es hatte jeden Hinweis auf ihren Verbleib ausgelöscht. Womöglich hatte sie ein Portal geöffnet oder ein Tor in den Limbus. Oder sie kannte eine Zissme tief unter dem Sand, die ihr und ihren Zombies Zuflucht gewährte. Mort durchkämmte die Wüste beinahe eine Woche lang, doch vergebens. Schließlich gingen seinen Leuten die Vorräte aus, und er musste sich unverrichteter Dinge nach Teruldan zurückziehen, wo er von Al’Hrastor höchstpersönlich, der erschienen war, um seinen neuen Besitz zu begutachten, zur Strafe für sein Versagen Amazth geopfert wurde.
Mit den Einwohnern der Wüstenmetropole indes verfuhr Al’Hrastor unerwartet milde. Nur die Führungselite der Xhul wurde hingerichtet. Die übrigen Einwohner der Stadt wurden verschont und behielten sogar einen Großteil ihrer Freiheit, mussten sich aber der Herrschaft der Sanskitaren unterwerfen. Von denen siedelte Al‘Hrastor zusätzlich zu den Reiternomaden zigtausende in Teruldan an, sodass diese bald die Bevölkerungsmehrheit stellten und die Stadtgeschicke ebenso kontrollierten wie den Handel. Mit den zusätzlichen Einnahmen konnte der Hexersultan weitere Feldzüge planen, ganz so, wie er es von vornherein vorgehabt hatte.
Da Al’Hrastor annahm, dass die teruldanischen Händler weite Teile Rakshazars bereist hatten, unterzog er einen nach dem anderen einem regelrechten Verhör, bei dem er versuchte, die Position der verschwundenen Stadt Namakari ausfindig zu machen, von der sich Suliman wahre Unsterblichkeit erhoffte. Doch auch die Teruldaner wussten nicht zu sagen, wo die halbmythische Metropole zu finden sei.
Von Morrigan und ihren Zombies war zehn Jahre lang nichts zu sehen und nichts zu hören, dann jedoch breitete sich im Umland von Kurotan eine seltsame Seuche aus, der nach und nach die Einwohner von mehr als zwei Dutzend Dörfern zum Opfer fielen, die daraufhin spurlos verschwanden. Im Kurotanischen und in der Targachi halten sich seither hartnäckige Gerüchte über eine mächtige Stadt namens Duratron im Artachmassiv, wohl eine einstige marhynianische Siedlung, gut versteckt in einer unzugänglichen Schlucht, bevölkert von tausenden von Untoten. Die Zombies, die sich selbst „Die Plage“ nennen, sollen einer Banshee-Königin mit großer Zaubermacht gehorchen, welche auf den Namen Sylvana Schattental hört. Die Plage, deren Zombies sich aus Xhul und anderen Menschen, Brokthar und verschiedenen Orks rekrutiert, soll sich inzwischen gleichermaßen mit den Artachkâo wie mit dem Bund der Targachi arrangiert haben. Beide Seiten sollen eingewilligt haben, einander nicht anzugreifen und in begrenztem Umfang Handel miteinander zu treiben. Es heißt, das anfängliche Misstrauen der Orks gegen die Plage sei inzwischen verschwunden, obwohl der Verdacht, dass die Banshee-Königin nur auf eine Gelegenheit lauere, eines Tages das gesamte Volk der Orks mit der Seuche zu infizieren und sie in die Reihen der Zombies aufzunehmen, niemals vollständig ausgeräumt werden konnte.
Teruldan jedenfalls bekam die Untoten nie wieder zu Gesicht. Die Stadt entwickelte sich im Laufe der folgenden Jahrzehnte zu einer typischen Sanskitarischen Metropole, auch wenn der Einfluss der Xhul weiterhin stark blieb. Sie übte eine derartige Sogwirkung aus, dass die bisherige Sprache der Xhul, das Uzujuma, Schritt für Schritt zu verschwinden begann. Die schwarzhäutigen Menschen uthurischer Abkunft übernahmen stattdessen das Sanskitarisch der Eroberer als eigene Zunge. Dies gilt nicht für die Xhul-Kulturen in der Mareth-Senke, die seit jeher zusammen mit ihren Reichen eigene Hochsprachen herausbilden und wieder verlieren.
Sanskitaren vs. Orks
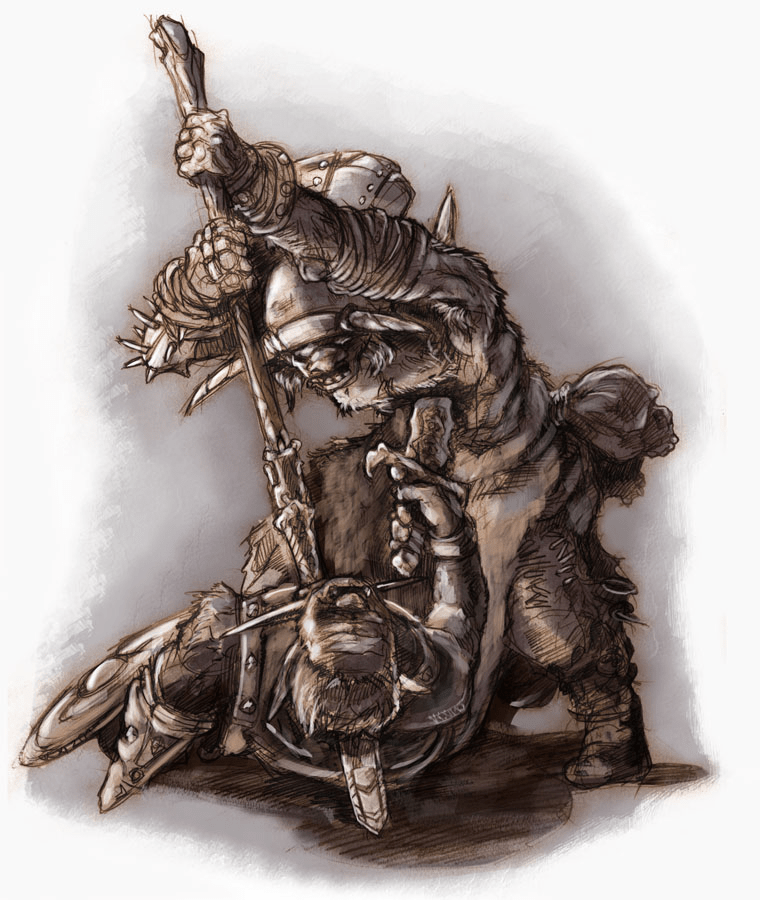
742 BF, zwei Jahre nach dem Fall der Ipexco und ein Jahr nach dem Fall Teruldans, war die Besatzung in der Wüstenmetropole so gefestigt, dass Al’Hrastor seine nächsten Kriegsziele bestimmen konnte. Da die Ipexco bereits von Ribukan aus befriedet worden waren, entschloss er sich, an der Nordfront weiter vorzurücken und gegen die Orks der Targachisteppe zu ziehen. Wenn das Ziel der Reise Amhas lautete, drängte es sich auf, die Stadt Ronthar ins Boot zu holen. Die Ronthar galten seit jeher als die stärksten Konkurrenten der Sklavenhalterrepublik. Womöglich würde es gelingen, sie als Verbündete gegen die Amhasim zu gewinnen, ansonsten würde das Sanskitarische Städtebund sie unterwerfen und zum Krieg gegen Amhas zwingen. Die Kontrolle über den bedeutenden Nexus an der Grenze zwischen Lavameer und Vaestfogg war ohnehin unerlässlich für die Verwirklichung der Pläne das Goldene Netz betreffend. Der Weg nach Ronthar führte zwingend durch die Orksteppen. Die Savannen Kurotans lagen der Sklavenhaltermetropole zu nah, hätte Al’Hrastor seine Kriegsbemühungen dorthin gelenkt, wäre der Senat des Endgegners womöglich frühzeitig gewarnt worden, dass die Sanskitaren vorhatten, gegen Amhas zu ziehen.
Doch bereits die Eroberung des Artachgebirges erwies sich als nahezu unmögliches Unterfangen. Al’Hrastor hatte gehofft, die Feindschaften und Streitigkeiten zwischen den Brachtão-Stämmen auszunutzen zu können. Er wollte sich mit einigen der Braunpelze verbünden, damit sie ihm halfen, die anderen zu unterwerfen. Aber er hatte nicht damit gerechnet, wie ernst die Orks den ewigen Bund der Targachi nahmen. Trotz aller Animositäten, die zwischen den Stämmen herrschten, verbot ihnen die Targachkão, sich an fremde Mächte anzubiedern, um gegen die eigenen Brüder zu Felde zu ziehen. Vielmehr bestand für die Sanskitaren die Gefahr, dass ein Vorrücken in orkisches Gebiet die verfeindeten Stämme einen würde. Und es waren nicht nur die Brachtão, die es zu besiegen galt. Am Fuße des Archtachgebirges begann das Gebiet der deutlich kriegsbeflisseneren Artachkão. Womöglich würden über kurz oder lang sämtliche Braunpelze den Sanskitaren feindlich gegenüberstehen.
Fünf Jahre lang musste sich Al’Hrastor darauf beschränken, vom Rande der Lath aus in die Orksteppen vorzudringen, in kurzen Scharmützeln die Braunpelze zu schwächen und sich wieder in die Wüste zurückzuziehen. Dann jedoch hatten die Zelothim einen Plan entwickelt, der das Kriegsglück zu wenden begann. Als sich im Winter 746 BF wie üblich in relativer Nähe zur Wüste das Winterlager KhurKezKão bildete und die Orks sich in großer Zahl dort versammelten, schleusten sie Merclador und eine Reihe weiterer gestaltwandelnder Quitslingadämonen in das Lager ein, welche gezielt Unfrieden stifteten und dafür sorgten, dass ganze Stämme miteinander in Streit gerieten, das Tabu vergaßen, welches ihnen das Töten verbot, und gegeneinander fochten. Am Ende des Winters waren es buchstäblich tausende von Frevlern, die am Fuße des Roten Schädels hingerichtet wurden, und die Stämme waren so verfeindet wie nie, als sich das Winterlager auflöste.
Mit den auf diese Weise geschwächten Orks hatte Al’Hrastor leichtes Spiel. Er griff die Stämme, von denen beinahe jeder bedeutende Krieger verloren hatte, einzeln an, und die übrigen hatten wenig Ambitionen, ihren Brüdern zur Seite zu springen. Die Sanskitaren unterwarfen einen Stamm nach dem anderen, besetzten das jeweils von ihm kontrollierte Gebiet und ließen den überlebenden Kriegern die Wahl, zu sterben oder in Al’Hrastors Armee zu dienen. Binnen dreier weiterer Jahre war der Kriegshaufen der Sanskitaren so groß geworden, dass selbst die Artachkão seine Macht zu fürchten begannen.
Zu Recht. Anfang 750 BF kam es zur Schlacht an der Quelle des Artachi-Flusses, bei der die Artachkão eine empfindliche Niederlage gegen den Feind erlitten. Hilflos mussten die Überlebenden mit ansehen, wie die Sanskitaren einen befestigten Korridor durch das Gebirge trieben, welcher ihnen den Zugang zur Targachisteppe öffnete, und damit das Gebiet der Artachkão in zwei Teile spalteten. Ein beinahe traumatischer Schock für das Volk, das so stolz auf seine territoriale und kulturelle Hegemonie war, dass es sich deshalb als RashRaghs auserwähltes Volk betrachtete.
Das Geschehen stürzte die Artachkão in eine tiefe Glaubenskrise. Viele hielten ihre Niederlage und die Stärke des Feindes für eine göttliche Strafe, zogen sich Büßergewänder an und flehten RashRagh um Vergebung an. Andere glaubten, der Gott habe sich von ihnen abgewandt, gerieten in Verzweiflung oder schlossen sich anderen Göttern an. Innerhalb ihrer Gesellschaft entbrannte ein erbittert ausgetragener, blutiger Richtungsstreit, der die Kräfte der Artachkão noch Jahrzehnte später band und verschliss. Die Sanskitaren konnten das Gebirge als Ausgangsbasis nehmen und von dort aus gegen die Schwarzpelzorks der Targachisteppe vorrücken.
Das grüne Einhorn und die Ursalier
Mit seiner Armee aus Sanskitaren und Orks gelang es Al’Hrastor Schritt für Schritt, auch weitläufige Gebiete innerhalb der Targachisteppe in Besitz zu nehmen. 753 BF hatte er die Orks soweit befriedet, dass der Weg nach Ronthar frei wurde. Die Brokthar, die das Kriegsgeschehen in der Targachi aufmerksam beobachtet hatten, sich aber aufgrund der komplizierten politisch-gesellschaftlichen Verwicklungen der unterschiedlichen Orkvölker und -stämme nicht zu einer Intervention auf Seiten der Orks hatten durchringen können, weil diese garantiert von dem einen oder anderen Stamm als Parteinahme zugunsten verfeindeter Orks interpretiert worden wäre, begannen sich auf die Schlacht vorzubereiten. Sich mit Al’Hrastor zu verbünden, zogen sie erst recht nicht in Erwägung.
Sie ahnten nicht, wie wichtig der Kampf war, der vor ihnen lag. Der Amazth-Kult schickte sich an, die Herrschaft über alle bedeutenden Regionen Rakshazars zu übernehmen. Selten in der derischen Geschichte hatte ein einzelner Erzdämon ein so großes Gebiet mit so vielen Einwohnern kontrolliert. Die Folgen waren unabsehbar. In letzter Konsequenz wollte Amazeroths Kult die Schöpfung vernichten, und da etwas zu zerstören stets viel einfacher ist, als etwas aufzubauen, rückte der Punkt, an dem ein Sieg der Chaosmächte unvermeidlich wurde, mit jedem Sieg Al’Hrastors näher und näher. Wenn Ronthar fiel, würde sich Kurotan vermutlich kampflos ergeben, was bedeutete, dass im nächsten Schritt zwei Großmächte gegeneinander antreten würden, die beide nicht viel von den Göttern hielten – der Städtebund des Amazth und die götterverlassene Republik Amhas. Eine der beiden Großmächte würde das Ringen um die Herrschaft über den Kontinent gewinnen, und in beiden Fällen würde dies das endgültige Ende jeglicher göttlicher Ordnung bedeuten. Die Amhasim würden sich vielleicht darauf beschränken, die Kulte der Götter auszumerzen, der Amazth-Kult indes würde seine neuerworbene Macht auf die eine oder andere Weise nutzen, um den Untergang der gesamten Schöpfung herbeizuführen.
Nicht einmal der Widersacher schien in der Lage zu sein, das Unheil noch aufzuhalten. Die Ewige Legion war in die Auseinandersetzungen zwischen Drachen und Riesen auf den Nordebenen hineingeraten und hatte dort schwere Verluste erlitten. Astana lag weit entfernt vom Geschehen und war ebenfalls geschwächt, weil mehrere mächtige Klingenmagier, die dem Gott ohne Namen die Vernichtung von Thy-Ath-Nog übelnahmen, das Unheiligtum des Widersachers mehrfach attackiert und den Kultisten schwere Verluste beigebracht hatten. Anders als die Anhänger des Namenlosen es gehofft hatten, hatte das Wiedererlangen des Kriegshorns des Alyasiphor keinen Machtzuwachs mit sich gebracht. Die Diener des Dreizehnten waren so schwach wie noch nie in der riesländischen Geschichte und würden bei den Kämpfen der nächsten Jahre, die womöglich das Schicksal Rakshazars in diesem Zeitalter entschieden, keine bedeutende Rolle spielen können.
Ingror der Vernichter schwieg, obwohl der Krieg zu seiner Heiligen Stadt getragen wurde. Er hatte geschworen, Dere eher zu vernichten, als es dem Widersacher anheimfallen zu lassen, doch sein Schwur sagte nichts über eine Chaosmacht, welche sich ihrerseits um die Zerstörung der Welt bemühte. Die meisten anderen Götter bekamen gar nicht mit, was im Riesland geschah, schließlich blieb ihnen der Blick auf die Schattenseite der Welt verwehrt. Alrik von Amhas hatte das drohende Kippen des Gleichgewichts der Kräfte offenbar instinktiv gespürt und fand sich mit seinem Begleiter in Ronthar ein, um das Schicksal dieser Inkarnation des Ewigen Kriegers zu erfüllen. Und auch Kendrina, die amtierende Schlächterin aus dem Volk der Xhul, erschien in der Broktharstadt.
Marhyna sah, was geschah, und war in höchstem Maße alarmiert, zumal das Problem einmal mehr auf ihr Handeln in der Vergangenheit zurückging. Hätte sie den Sterblichen nicht die Magie gebracht und hätte sie nicht gemeinsam mit Rashtul die Ansiedlung der Tulamiden im Riesland vorangetrieben, wäre die Schöpfung nicht in diese Lage geraten. Es musste ihr gelingen, korrigierend in die Geschehnisse einzugreifen. Aber wie? Natürlich konnten sie oder Madaya Traumwesen erschaffen und in die Realität entlassen, doch dann hätte der Mond sich grün gefärbt, die Götter wären auf ihr Handeln aufmerksam geworden und hätten auch herausgefunden, dass Marhyna auf diese Weise die Beschränkungen ihrer Gefangenschaft überwinden konnte. In diesem Fall wäre es bis zu dem Beschluss der alveranischen Götter, ihren Astralleib endgültig zu zerschlagen, nicht mehr weit gewesen.
Schließlich hatte die Göttin der Kraft eine Idee. Immerhin war sie nicht die Einzige auf der Welt, die ihr Schicksal erträumen konnte. Nahezu jedes Wesen der Lichtwelt hatte gelernt, Wille, Traum und Magie zu einer untrennbaren Einheit zu verbinden und damit die Realität zu formen. Nur das badoc nahm ihnen diese Gabe wieder. Marhyna bat die Wesen der Lichtwelt und zahllose Lichtelfen, die bereits in die Inneren Wälder von Sala Mandra hinausgegangen waren, um Hilfe, und diese willigten ein. Gemeinsam träumten sie von einer Manifestation Marhynas, die im Riesland erschien, ohne den grünen Mond hervorzurufen. Es sollte gelingen. In der Vaestfogg, ganz in der Nähe von Ronthar, erschien ein einzelnes Einhorn, gesegnet mit Marhynas Geistesgaben und einem Teil ihrer magischen Macht. Der grüne Mond blieb aus, doch ganz hatte sich der Warnmechanismus der Götter nicht austricksen lassen. Statt den Mond zu verfärben, verfärbte er das Fell des Einhorns, das nun anstelle des Madamals giftgrün leuchtete. Ein Einhorn als Gegner von Al’Hrastors Truppen schien ein sehr treffliches Bild zu sein, immerhin führten die unterworfenen Orks der Targachi den einen oder anderen Auerochsen als Nutztier mit sich, und zwischen Einhörnern und Auerochsen herrscht seit jeher eine grimme Feindschaft.

Das grüne Einhorn allerdings hatte einen ganz anderen Fokus. Es streifte durch die südlichen, nahe dem Lavameer gelegenen Ausläufer der Vaestfogg, um Spuren eines Volkes zu finden, das vor dem Kataklysmus im zentralen Rakshazar gelebt hatte: die Ursalier. Sie hatten die Gestalt kleiner Bären von maximal einem Schritt Schulterhöhe. Wie bei den meisten Kulturschaffenden konnte ihr Aussehen stark variieren. Manche ähnelten irdischen Koalas, manche gemahnten an Pandariten, die sagenumwobenen Werwesen in der Nachbarschaft Kithorras, wieder andere hatten katzenhafte Züge oder erinnerten entfernt an Menschen oder andere Hominide, wobei ihre Fellzeichnung die unterschiedlichsten bunten Farben annehmen konnte. Gemeinsam hatten sie den aufrechten Gang, Hände, die ebenso geschickt waren wie die anderer kulturschaffender Hominider, und eine ausgeprägte Neigung zur Technomagie. Den Ursaliern war damit im Marhynianischen Imperium eine ähnliche Rolle zugekommen wie den G‘Rolmur im Myranischen. Im Hinblick auf die Bestrebungen des Imperiums, Technik und Magie zu einer perfekten Symbiose zu vereinen, waren sie – vermutlich etwa gleichauf mit den Trollen – eine der treibenden Kräfte gewesen.

Die Herkunft der Ursalier lag im Dunkel der Zeit verborgen. Vermutlich waren sie einst Biestinger gewesen, die aus Feenwelten stammten, welche seit dem Kataklysmus verheert oder vom Riesland abgeschnitten sind. Meist mieden sie die großen Metropolen der anderen Völker, welche auf die Belange von Wesen abgestimmt waren, die zwei- bis sechsmal so groß waren wie sie selbst, aber das grüne Einhorn wusste, dass sie eigene, meist sehr abgelegene Städte bewohnt hatten, ihre Hauptstadt Ursalion, die Tüftlerstadt Ursaregan, das mit Sphären- und Temporalmagie befasste Ursadoon oder Bärenwalde, das als verwunschener, magischer Ort galt. Die meisten dieser Orte hatten im Zentrum Rakshazars gelegen, dort, wo sich heute das Lavameer und die Aschewüste erstrecken. Da niemand seit dem Kataklysmus mehr einen Ursalier zu Gesicht bekommen hatte, waren die Einwohner Rakshazars während der Zeit der Asche zu der Schlussfolgerung gelangt, dass die Bärenartigen durch den Kometeneinschlag ausgelöscht worden waren. Spätestens am Ende der Aschezeit waren sie aus dem kollektiven Gedächtnis der meisten Riesländer verschwunden.
Das grüne Einhorn wusste jedoch, dass einige Ursalier nahe dem Nordrand des Lavameers gelebt hatten, möglicherweise knapp außerhalb im Bereich der heutigen südlichen Vaestfogg. Entsprechend mochte es versprengte Reste des ursalischen Wissens geben, welche den Kataklysmus überdauert hatten und die den Ronthar dabei helfen konnten, die Auseinandersetzung mit Al’Hrastor zu ihren Gunsten zu entscheiden.
Alldieweil umrundeten Al’Hrastors Truppen den Vulkan und bezogen vor Ronthars mächtigen Mauern Stellung. Dass Teruldan und die die Orklande mit List, Gift und gestaltwandelnden Dämonen zu Fall gebracht worden waren, hatte sich inzwischen herumgesprochen. Die Ronthar waren gewarnt und würden auf derartige Tricks nicht hereinfallen. Diesmal musste der Kampf durch schweres Kriegsgerät entschieden werden.
Die Zauberkundigen bereiteten sich darauf vor, Dämonen herbeizurufen, machtvolle Zauber zu wirken und einmal mehr darauf zu spekulieren, dass die Kritische Essenz ihre zerstörerische Kraft noch steigerte. Die Orks fällten Bäume und bauten daraus Katapulte und anderes Belagerungsgerät. Al’Hrastor forschte an Möglichkeiten, den erloschenen Vulkan zum Ausbruch zu bringen und die feindliche Stadt dadurch zu vernichten.
Obwohl die Ronthar darauf brannten, aus ihrer Metropole herauszustürmen und sich den Feinden in offener Feldschlacht entgegenzuwerfen, mussten sie diesen Impuls unterdrücken. Die Sanskitaren und ihre Handlanger waren deutlich in der Überzahl, den Schutz der Mauern zu verlassen und sich auf freiem Feld zu stellen, wäre einem Selbstmordkommando gleichgekommen. Umgekehrt waren die Ronthar rechtzeitig gewarnt gewesen und hatten ihre Stadt mit Wasser, Vorräten, Fernwaffen, Öl, das sie siedend über ihre Feinde gießen konnten, Kämpfern und Söldnern aus aller Herren Länder vollgestopft. Der Versuch, die Metropole zu stürmen, würde enorme Verluste nach sich ziehen. Doch die Zeit spielte für Al’Hrastor, und er hatte keinerlei Skrupel, tausende von Leben zu opfern.
Um die Moral von Ronthar zu untergraben, beschworen die Amazäer und Zelothim Dämonen, riefen Untote herbei und unterwarfen allerlei Werwesen. Mit übernatürlichen Kräften, Flugfähigkeiten oder indem sie schlicht mit Katapulten über die Mauer geschleudert wurden, sorgte man dafür, dass sie auf die Ronthar losgingen. Auf diese Weise wollten die Aggressoren die Kampfmoral ihrer Feinde untergraben und die Einwohner mürbe machen. Alrik von Amhas und sein Gehilfe, vor allem aber die Schlächterin und ihr treuer Hund Skubiduh hatten alle Hände voll damit zu tun, die Wesen der Finsternis aufzuspüren und zu eliminieren.
Das grüne Einhorn streifte unterdessen durch die Vaestfogg und musste sich mehrfach der Nebelwaldjäger erwehren, die es als Beute betrachteten. Es folgte halb erloschenen Erinnerungen an Dinge, welche die Göttin Marhyna im Laufe ihrer Äonen währenden Wacht vom Marhynamal aus beobachtet hatte, dem Echo vergangener Tage, verblassten Träumen, dann endlich fand sie eine Spur der Ursalier. Ein beinahe dreitausend Jahre alter Baum markierte den Eingang zu einer unterirdischen Siedlung der Bärenartigen, die vor dem Kataklysmus ein blühendes Dorf von etwa 2.500 Individuen namens Bäringia gewesen war.
Der Weg, der hinunterführte, schien noch weitgehend heil, allerdings war er so eng, dass das Einhorn kaum hindurchpasste. Wie überrascht war es, als es Bäringia in erstaunlich intaktem und aufgeräumtem Zustand vorfand. Ein breiter Rundgang formte einen Kreis von rund einer halben Meile Durchmesser, und von ihm zweigten immer wieder Gänge ab, die zu Wohneinheiten und Werkstätten, zu Manufakturen und Geschäften, zu Labors und Schmieden, zu Galerien und Tüftlerstätten, zu Geschäften und Handwerksbetrieben, zu Tempeln und Bibliotheken führten. Das Einhorn ahnte, dass dies alles nicht in so mustergültigem Zustand gewesen wäre, wäre nicht jemand hier gewesen, der dafür sorgte, dass es vom Zahn der Zeit verschont blieb. Dann fand es seinen Verdacht bestätigt: Aus einer der Wohneinheiten drang der Geruch von frischem Eintopf an seine Nase, der auf dem Tisch eines gemütlichen Esszimmers stand.
Das Einhorn wob einen Zauber aus der Kraft, Marhynas Gabe, und erkannte, dass ein rund ein Schritt großes Lebewesen hinter einem Sofa kauerte. Mit einem raschen Stoß seines Horns schob es das Möbel beiseite und blickte in die furchtsamen Augen eines grüngelben weiblichen Ursaliers. Wenig später sah sich das Einhorn von einer ganzen Familie umringt, die es mit Waffen und allerlei Zauberutensilien in Schach hielten.
Das grüne Einhorn nahm telepathischen Kontakt mit den Bären auf, sandte ihnen eine Folge von Bildern, die sich in ihrem Geist zu einer ihnen vertrauten Sprache formten, und versuchte ihnen klarzumachen, dass es in Frieden kam. Die Ursalier waren sich uneins, wie sie mit dem ungewohnten Eindringling verfahren sollten. Sie kannten Einhörner aus den Erzählungen und Legenden ihrer Vorfahren, aber seit der Kontakt zu den meisten Feenwelten abgerissen war, hatten sie keines mehr zu Gesicht bekommen. Schon gar nicht eines mit giftgrüner Fellfarbe. Außerdem war jeder, der die Position von Bäringia kannte, ein unkalkulierbares Risiko da, zumal wenn er wusste, dass hier noch immer Ursalier lebten. Auf der anderen Seite waren die Ursalier stets ein gastfreundliches Volk gewesen, das niemandem Böses unterstellte, bis er dazu einen Anlass bot. Das grüne Einhorn vernahm die Frage, welchen Sinn es machte, dass die Ursalier das Erbe ihrer Ahnen hüteten, wenn sie längst deren Grundsätze und Lebensart vergessen hatten.
Diese Erwägungen brachen das Eis und eröffneten die Chance auf einen Dialog. Es stellte sich heraus, dass mehr als zweihundert Ursalier in Bäringia lebten und es noch mindestens zwei weitere Städte gab, außerdem einige versprengt lebende Tüftler, Jäger, Abenteurer und Künstler in weiter nördlich gelegenen Bereichen der Vaestfogg. Da die Nebelwaldjäger sie nicht als Kulturschaffende erkannten oder es ihnen egal war und sie sie jagten und aßen wie anderes Wild, mussten sich die Ursalier noch vorsichtiger und heimlicher verhalten, als die Vaesten selbst es taten. Nach einer guten Woche hatten die Bärenartigen beinahe erstes Vertrauen zu ihrem Besucher entwickelt, als sie begriffen, dass es ein Gesandter Marhynas war.
Dies sorgte unter den Ursaliern für Panik und neuerliche Feindseligkeiten. Sie fürchteten den zornigen Herzog Ingror, aber mehr noch Lady Marhyna, die bleiche Herrin der Werkreaturen. Das Einhorn sandte den Bärenartigen erneute Bilder und Visionen, schließlich auch Träume, und zeigte seinen scheuen und misstrauischen Gastgebern, dass sie, wie so viele Riesländer, im Hinblick auf die Göttin und ihre Absichten einem Irrtum unterlagen. Es konnte nicht leugnen, dass der Fluch, der auf dem Riesland zu lasten schien, viel mit Marhyna und ihrer Gabe zu tun hatte, deren Einsatz gefährlich geworden war, seit der Kataklysmus das Goldene Netz verheert hatte, aber sie war weder der Widersacher noch ein Erzdämon und auch nicht mit einem von ihnen im Bunde. Auch wenn sie dabei oft zu impulsiv vorging und damit das Unheil noch vergrößerte, versuchte sie die Sterblichen zu warnen und zu beschützen. Das galt selbst für die Lykanthropie, welche einst eine Gabe gewesen war, mit der die Sterblichen sich gegen ihre Feinde zur We(h)r setzten konnten, und die erst in späteren Zeitaltern zu ihrer Geißel geworden war.
Nach einer Weile beruhigten sich die Bären wieder, oder jedenfalls nahmen sie von Feindseligkeiten Abstand. Sie versuchten nachzuvollziehen, was das grüne Einhorn ihnen mitteilte, durchforsteten die Bibliotheken und Aufzeichnungen ihrer Ahnen nach Hinweisen auf den Wahrheitsgehalt dessen, was ihr Gast ihnen zeigte, und fanden so gut wie alles durch die Worte ihrer Vorfahren bestätigt. Die alten Ursalier waren Teil des Imperiums gewesen und von diesem hofiert und protegiert worden, weil der Wert ihrer Technologie und ihrer magischen Forschungen für Marhynia gar nicht hoch genug hatte veranschlagt werden können. Aus ihrer privilegierten Stellung heraus hatten die meisten der alten Ursalier gar nicht wahrgenommen, wie das Imperium nach und nach immer verderbter geworden und dem Widersacher anheimgefallen war. Gräueltaten gegen die versklavten Völker oder jene, die am Rande des Reiches in unsicherer Freiheit lebten, fanden weit weg von den Städten der Bärenartigen statt und waren den meisten der übereifrigen weltfremden Tüftler, Forscher, Zauberkundigen und Magoingenieure vollkommen unbekannt. Nur selten gelangten Gerüchte an ihre Ohren, die sie nicht so recht zu glauben vermochten. Erst in der imperialen Spätphase waren einzelne Ursalier den Vorwürfen nachgegangen und hatten alarmierende Berichte von den Imperialen und ihren Plänen nach Hause mitgebracht.
Der König hatte stets beteuert, das Wissen, welches die Bärenartigen lieferten, allen Bürgern des Reiches zur Verfügung zu stellen und zu ihrem Wohle einzusetzen. Nun jedoch stellte sich heraus, dass er es verwendete, um Waffen zu bauen, die benachbarten Kontinente zu bedrohen und die Feinde des Reiches gnadenlos zu unterdrücken. Ihr Goldener Gott, das schien jener zu sein, den nahezu alle Völker als den finsterten Widersacher kannten, jenen, der keinen Namen hat, was auch den zweiten Kult des Imperiums verdächtig machte, jenen der Marhyna. Doch die alten Ursalier hatten begriffen, dass nicht die Göttin selbst und ihre Diener die finsteren Taten des Imperiums mittrugen oder gar verursacht hatten, sondern dass der Marhyna-Kult den staatlichen Interessen unterworfen worden war und im Sinne des Königs, der sich längst als gottgleicher Imperator aufspielte, gelenkt wurde.
Die alten Ursalier hatten daraufhin dem Imperium nur noch unbedeutende Forschungsergebnisse geliefert und wichtige Erkenntnisse zu verschleppen versucht. Doch ihr geheimer Widerstand kam zu spät. Das Imperium hatte – nicht zuletzt dank ihrer Hilfe – einen Entwicklungsstand erreicht, der den aller anderen Völker Deres überflügelt hatte. Und wo die Ursalier nicht lieferten, sprangen die Trolle in die Bresche. Das Imperium schickte sich an, ganz Dere zu erobern, als der Komet Kataklys dem ein Ende setzte, und mit ihm dem Leben der meisten Ursalier, die nur hilflos hatten zusehen können, dass ihre Erfindungen um ein Haar großes Unheil über die gesamte Welt Dere gebracht hätten.
Die meisten Städte der Ursalier waren im Kataklysmus vergangen, nur einige kleinere, aber durchaus nicht unbedeutende Siedlungen weit im Norden überstanden die Katastrophe. Die wenigen überlebenden Bärenartigen überlegten, das gesamte Wissen ihres Volkes zu vernichten, entschieden sich aber schlussendlich dagegen. Sie hatten dies alles mit den besten Absichten erschaffen, und womöglich konnten ihre Errungenschaften eines Tages unter einem besonneneren Herrscher dazu beitragen, die Welt zu einem besseren Ort zu machen. So hatten Generationen das alte Wissen ihrer Vorfahren gehütet und instandgehalten, auch wenn die heutigen Ursalier vieles von dem, was ihre Vorfahren erkannt hatten, nicht mehr verstanden.
Jetzt endlich hatten das grüne Einhorn und die Ursalier einen Grad der Verständigung erreicht, der es Marhyna ermöglichte, ihre Bitte zu formulieren. Das Einhorn unterrichtete die Bären über den Konflikt zwischen Yal-Mordai und Ronthar. Die Ursalier begriffen zuerst nicht, dass das Einhorn im Sinn hatte, die Ronthar in diesem Konflikt zu unterstützen. Die grobschlächtigen Brokthar-Barbaren, welche dem zornigen Ingror dienten, waren ihnen nicht geheuer. Doch das grüne Einhorn machte ihnen begreiflich, dass Rontja, die in diesen Gefilden als Tochter Ingrors galt, die Brokthar nach dem Kataklysmus als Wächter ins Riesland geschickt hatte. Sie sollten dafür Sorge tragen, dass die Mächte der Finsternis nicht die Oberhand gewinnen würden. Die Brokthar waren grobschlächtig, brutal und nicht immer besonders klug, aber das waren Eigenschaften, die ihnen dabei halfen, unter den besonderen Bedingungen im Reich der Finsternis zu überleben. Die Wacht wider die Finstermächte lag noch immer in ihrer Hand.

Dann zeigte das Einhorn den Ursaliern, wer ihre Feinde waren. Den finsteren Hexensultan und den Rat der Schemenhaften, der hinter ihm stand. Ein halbwahnsinniger Diener Amazeroths, der sich nicht entscheiden konnte, ob er die Welt seinem Willen unterwerfen oder sie vernichten wollte, was vielleicht das einzige Grund war, warum er noch keines von beidem getan hatte.
Die Ursalier beratschlagten und traten nach langen Unterredungen zutiefst beschämt vor ihren Gast. Sie mussten zugeben, dass ihr Volk bei allem Forscherdrang und all seinem Wissendurst niemals gelernt hatte, das Gute vom Bösen und die Ordnung vom Chaos zu unterscheiden. Die Ursalier hatten in einem gut behüteten Elfenbeinturm gelebt und sich nie die Mühe gemacht, die wahren Absichten ihrer Nachbarn zu ergründen. Noch nicht einmal nach dem Kataklysmus, der ihnen eine eindringliche Warnung hätte sein sollen. Nunmehr hatten sie erkannt, dass die Wacht über die Errungenschaften ihrer Vorfahren sinnlos war, wenn sie sie in diesem wichtigen Konflikt, der womöglich über das Schicksal ganz Deres entscheiden würde, nicht auf der richtigen Seite zum Einsatz brachten.
Die Schlacht um Ronthar war da bereits in vollem Gange. Noch hielten die titanischen Mauern, noch deckten die Verteidiger die anbrandenden Truppen Al’Hrastors mit einem anhaltenden Hagel aus Pfeilen und Steinen ein und schütteten siedendes Öl auf sie herab. Doch längst hatten flammende Geschosse weite Teile der Stadt in Brand gesteckt, ließen fliegende Dämonen gewaltige Steine auf die Stadtbewohner herabfallen, hatten sich machtvolle Schatten manifestiert, welche die Körper von Sterblichen in Besitz nahmen und mit ihrer Hilfe unter den übrigen Ronthar wüteten.
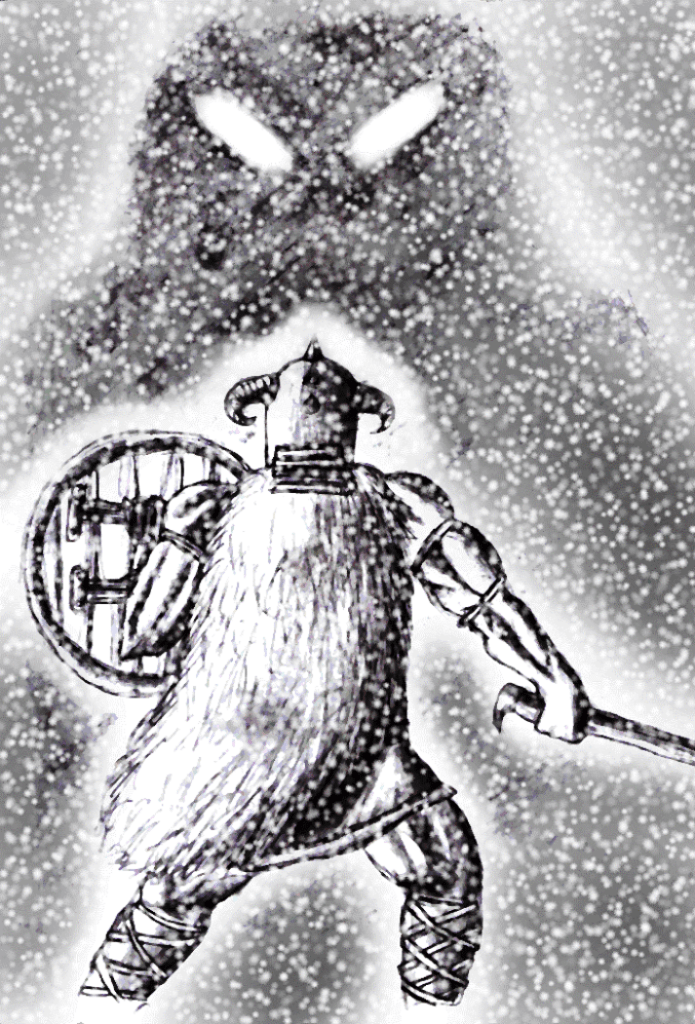
Als die Mauern unter dem ständigen Beschuss erste Risse aufzuweisen begannen, als die Belagerer das Stadttor bestürmten und es beinahe zum Bersten brachten, als Al’Hrastor zu einem Ritual ansetzte, das den erloschenen Vulkan zu neuem Leben erwecken und das Magma tief im Inneren Deres ans Tageslicht pressen sollte, da erklang aus der Ferne ein mächtiges Horn, und wenig später stapften gewaltige metallene Kolosse heran, die entfernt wie zehn Schritt hohe Bären aussahen, walzten den Wald nieder, in dem sich Al’Hrastors Nachschub verborgen hielt, und trampelten viele seiner Orkkämpfer zu Boden, sodass die anderen in Panik die Flucht ergriffen.
Unter den Überlebenden Yal-Mordais schworen manche Stein und Bein, dass ein Beschwörerzirkel der Amazäer und der Zelothim nach dem anderem von einem giftgrün schimmernden gehörnten Pferd heimgesucht worden sei, dessen Horn zunächst in goldenem Glanz erstrahlte und dann Blitze auf die verdutzten Zauberkundigen geschleudert habe, welche viele der Zauberer das Leben gekostet hätten.
Krieger der Kristallgarde sahen sich von etwa ein Schritt großen Bärenartigen umringt, die in rasender Geschwindigkeit um sie herumhüpften, die ihnen ihre Waffen aus den Händen rissen, sie zu Boden warfen und magische Netze über sie woben.
Erneut erschallte das mächtige Horn, diesmal war es deutlich näher gerückt. Ein gewaltiger Tornado fegte durch den Wald, ließ jahrhundertealte Bäume wie Streichhölzer abknicken und durch die Gegend wirbeln, dann riss eine gewaltige Welle die Truppen der Sanskitaren zu Boden. Die Wucht der Schallwaffe traf ihr Gehör und ließ sie taub und orientierungslos zurück. Entsetzt ergriffen Al’Hrastors Truppen die Flucht, und auch der Hexensultan selbst sah sich gezwungen, angesichts der Urgewalt, welche die unbekannten Angreifer entfesselt hatten, den Rückzug anzutreten, bevor sein Ritual vollendet war.
Die Ronthar begriffen nicht, was geschehen war, aber jetzt, wo der Druck an den Mauern nachließ, gelang es ihnen rasch, die Lage innerhalb der Stadt unter Kontrolle zu bringen. Alrik von Amhas fand dabei den Tod. Sein schwarzes Schwert hatte so viele Seelen getrunken, dass es nicht innehalten und ihn zwingen wollte, auch die Leben der Ronthar zu nehmen, doch das konnte und wollte der Ewige Krieger nicht zulassen, und so warf er sich der infernalischen Waffe schließlich selbst als Opfer entgegen. Alrik von Amhas verging und wurde wenig später in einer neuen Inkarnation wiedergeboren, denn noch war das Gleichgewicht der Kräfte nicht wiederhergestellt. Auch die Schlächterin ließ ihr Leben, aber erst, nachdem sie den größeren Teil der übernatürlichen Gegner vernichtet hatte. Mit den restlichen wurden die Ronthar auch alleine fertig. Als der nächste Tag heranbrach, waren die Dämonen vertrieben und die Feuer gelöscht, und die Brokthar fanden das Umland Ronthars vollständig verheert vor. Viele ihrer Feinde lagen tot oder in magische Ketten gelegt am Boden, die weitaus meisten jedoch hatten panisch die Flucht angetreten.
Zahllose Orks nutzten die neue Situation, um Al’Hrastors Gefangenschaft zu entkommen. Sie rotteten sich zu kleinen, dann zunehmend größer werdenden Kriegshaufen zusammen und gingen auf ihre sanskitarischen Peiniger los. Der Kampf um die Freiheit der Orks wurde in der Targachi-Steppe ausgetragen, doch bis er entschieden war, sollten Jahrhunderte ins Land gehen. Auf diese Weise verhinderten die Orks, dass Yal-Mordai den Krieg ein weiteres Mal an Ronthars Grenzen trug. Und das war gut so, denn einen zweiten Angriff der Sanskitaren hätte die Brokthar-Metropole wahrscheinlich nicht überstanden. Rund zwei Jahrzehnte später kam in Ronthar eine Tyrannen-Dynastie an die Macht, welche ihrerseits ihre Nachbarn mit Krieg überzog. Und diese zu unterstützen wäre den Ursaliern, die ihre Geheimnisse erneut in Sicherheit brachten und vor den Augen der Welt zu verbergen, bis irgendwann bessere Zeiten hereinbrachen, gewiss nicht in den Sinn gekommen.
Was aus dem grünen Einhorn geworden ist, weiß niemand zu sagen. Hin und wieder behaupten Riesländer, ein solches Geschöpf gesehen zu haben, und es heißt, dass es, wo immer es auftauche, den Mächten der Finsternis Einhalt gebiete. Auf einem Kontinent, wo es allzu oft an Vertrauen in die Macht des Guten mangelt, ist es somit in zahllosen Geschichten zu einem für das Riesland ungewohnten Symbol der Hoffnung geworden.
Die Magokratie von Ribukan
Nachdem der Vormarsch Al’Hrastors im Norden gestoppt worden war und die Orks mit ihrem Kampf um erneute Unabhängigkeit begonnen hatten, erhielt die Kampfmoral der Sanskitaren einen deutlichen Dämpfer. Hrastor und Al’Hrastor kamen darin überein, dass der Sanskitarische Städtebund einen neuen Gegner benötigte. War erst der Beweis erbracht, dass das Reich noch immer siegreich aus der Schlacht hervorgehen konnte, würde sich gewiss auch die Moral der Truppen im Norden stabilisieren, und dann würden sie die Lage dort sicher unter Kontrolle bekommen.
Kurotan und Amhas verboten sich nach wie vor als Kriegsgegner, und da die Stadtstaaten in den vergangenen Jahrzehnten zahlreiche bis dahin freie Parnhai-Stämme unterworfen hatten, blieben im Umland des Städtebundes nur noch die Echsendschungel als Kriegsziel übrig. Für Al’Hrastor drängte sich dieser Gegner auch deshalb auf, weil er noch immer auf der Suche nach wahrer Unsterblichkeit war. Inzwischen beinahe 150 Jahre alt, begann er immer deutlicher zu spüren, dass der Sarkophagus, der ihm am Leben hielt, ihm keine Ewige Jugend verlieh. Sein Körper starb und verfiel, seine immer ledriger werdende Haut legte sich straff über die gläsern werdenden Knochen, spannte und war überaus verwundbar. Sein Rücken war gebeugt und schmerzte unentwegt. Um diesen Zustand zu verbergen, kleidete der Tyrann sich beinahe immer in dichte, schwarze, bodenlange Roben. Unter der stets tief ins Gesicht gezogenen Kapuze waren nur die Konturen seines blutleeren, eingefallenen Gesichts zu sehen. Nur seine ausdrucksstarken, in allen Grüntönen gesprenkelten Augen erinnerten an die Ehrfurcht gebietende Gestalt, die er in seiner Jugend verkörpert hatte.
Es war an der Zeit, die Nagah zu unterwerfen, den dauerhaften Zugang zu ihrer Schwarzen Pagode zu erstreiten und das Wissen der Schlangenleibigen als Basis zu nutzen, um das Geheimnis der Unsterblichkeit zu erforschen, wenn sie selbst es schon nicht vermocht hatten. Oder alternativ die Echsen dazu zu zwingen, die Position von Namakari zu verraten, wo es der Sage nach Hinweise gab, die den Gegensatz von Leben und Tod auflösen sollten. Gewiss wussten die Nagah, wo die verschollene Stadt zu finden war – immerhin war das alte Unlon eine Siedlung der Schlangengestaltigen gewesen –, und mussten nur auf angemessene Weise dazu überredet werden, ihr Wissen mit ihren wohlwollenden Nachbarn zu teilen.
Für einen Krieg gegen die Nagah drängte sich allein Ribukan als Basis auf, doch als die Ribukaner von Al’Hrastors Plänen erfuhren, sorgte dies für Aufruhr innerhalb der Stadt. Ribukan und die Nagah waren keine engen Freunde, aber sie hatten sich im Laufe der Jahrhunderte miteinander arrangiert, konkurriereten freundschaftlich um Macht und Einfluss über die Ribukanische Halbinsel und knüpften an die alte Tradition des Unlon-Handels an, indem sie Geschäfte miteinander machten. Stadtfürst Toruba Ibn Salman hörte die Stimmen seiner Untertanen und wollte Al’Hrastor in dieser Angelegenheit die Gefolgschaft verweigern, doch sein Umfeld war von Zelothim infiltriert, die seinen Geist ihrem Willen unterwarfen und ihn zu Al’Hrastors Mirhamionette machten. Die Ankunft der ersten Truppen Yal-Mordais führte um ein Haar zu offener Rebellion, die von Torubas Garde und den Truppen Yal-Mordais blutig niedergeschlagen wurde.
Weder Al’Hrastor noch Toruba ahnten, dass die Rektorin der Akademie der Schatten, die Comtesse, bereits Schritte in die Wege geleitet hatte, um die Sache selbst in die Hand zu nehmen. Hernanda Pizarra stand in der Schuld der Nagah, welche ihr geholfen hatten, die Ipexco zu unterwerfen. Hinzu kam ihre tiefe Abneigung gegen die Zauberkundigen Yal-Mordais, welche ihre Macht ihrem grausamen Herrn verdankten, dem verfluchten Gott Amazth. Ihre lebensverachtende Philosophie war eine Schande für das Erbe der Kophta, auf das sie sich beriefen. Die Comtesse war zutiefst überzeugt davon, dass die Akademie der Schatten die einzige Zauberschule Rakshazars war, der eine Existenzberechtigung zukam.
Heimlich hatte Hernanda Boten zu den Nagah entsandt und sie vor Al’Hrastors Plänen gewarnt. Die Schlangenleibigen machten mobil und bezogen in Ribukans Umland Stellung. Die Comtesse bat ihre Verbündeten, einstweilen von einem Angriff abzusehen, um unnötige Verluste an Leben auf beiden Seiten zu vermeiden. Auch hatte sie wenig Interesse an einer Zerstörung Ribukans durch die Echsen.
Die Rektorin der Akademie bat allerdings um die Unterstützung von Su’Ruhya, Zauberkundigen der Nagah, die sich auf Einfluss und Illusion verstanden, und von Hy’Chaia, den Experten für Verwandlungen. Mit ihrer Hilfe gelang es den besten Magiern der Akademie der Schatten, in einer lauen Sommernacht des Jahres 756 BF unbemerkt in den Palast des Stadtfürsten einzudringen. Als die Garde die Eindringlinge bemerkte, waren diese bereits mitsamt dem Potentaten entkommen und verschanzten sich hinter den Mauern der Akademie.
Damit war Toruba dem Einfluss der Zelothim entzogen. Das Gespräch mit ihm erwies sich für Hernanda dennoch als ernüchternd, weil der Fürst, der nach den jüngsten Erfahrungen die Macht Al’Hrastors fürchtete, dem Hexensultan allzu große Konzessionen machen wollte und sich weigerte, offen gegen Yal-Mordai zu opponieren. Die Comtesse verzichtete daraufhin auf weitere Diskussionen und setzte nun ihrerseits Magie ein, damit Toruba ihr zu Diensten war.
Am Folgetag trat der Stadtfürst vor sein Volk und erntete dessen tosenden Applaus, als er Ribukans Austritt aus dem Sanskitarischen Städtebund verkündete und erklärte, dass Yal-Mordais Truppen hier nicht länger willkommen seien. Al’Hrastors Soldaten versuchten daraufhin, Toruba zu entmachten und selbst die Befehlsgewalt in der Stadt an sich zu reißen, doch dieser Versuch bekam ihnen nicht gut. Der geballte Volkszorn der Ribukaner wandte sich gegen die Aggressoren, die bis auf den letzten Mann niedergemacht wurden. Am Ende setzten die Ribukaner die Schiffe aus Yal-Mordai in Brand und versenkten ihre Wracks im Gelben Meer. Unterdessen kümmerten sich die Akademiemagier und ihre Nagah-Verbündeten darum, die heimlich in der Stadt agierenden Zelothim zu enttarnen und zu töten. Nur eine Handvoll Überlebender wurde zu Al’Hrastor zurückgeschickt, um ihm zu berichten, was hier geschehen war.
Zusammen mit Ribukan waren auch die Ipexco für Al’Hrastor verloren. Einmal mehr erwies es sich, wie weise die Comtesse gehandelt hatte, die Uthurim selbst zu unterwerfen, statt dies Al’Hrastor zu überlassen. Hätte der Hexensultan das Tal der Tempel kontrolliert, hätte er von dort aus Krieg gegen die Nagah und anschließend gegen Ribukan führen können. So jedoch blieb ihm für einen Krieg im Südosten keinerlei Basis mehr. Den Zugang von Süden blockierte nun Ribukan, das zudem als sichere Basis für Al’Hrastors Truppen ausfiel, und im Norden musste der Hexensultan erst an den Ipexco vorbei, wenn er in die Echsendschungel vordringen wollte.
Zähneknirschend – viele Zähne waren ihm nicht geblieben – musste Al’Hrastor einsehen, dass er ohne Ribukans Unterstützung keine Chance hatte, die Nagah mit Krieg zu überziehen. Er hätte zunächst den abtrünnigen Kriegshafen zurückerobern müssen, doch das erschien in der momentanen Situation kaum realistisch. Genau wie Yal-Mordai kontrollierte Ribukan eine Schwimmende Festung, hatte eine große Kriegsflotte und zudem die Unterstützung der Nagah. Al’Hrastor hätte den aufständischen Ribukanern seine gesamte Armee entgegenwerfen müssen, aber die war mehrheitlich in den Steppen der Orks gebunden.
Vier Jahre gingen ins Land, in denen die Comtesse unermüdlich den Ausbau Ribukans zur Festung vorantrieb, um die Stadt als Kriegsziel für Al’Hrastor endgültig unattraktiv zu machen. Längst schon galt ihr Wort mehr als das des Stadtfürsten, und als dieser 760 BF einem heftigen Fieber erlag, drängte Ribukans Bevölkerung Hernanda, selbst die Herrschaft über die Metropole anzutreten.
Die Comtesse erklärte sich grundlegend bereit dazu, die Regierungsgewalt zu übernehmen, stellte jedoch Bedingungen. Sie machte den Ribukanern begreiflich, wie sehr die Stadt auf das Wohlwollen der Nagah angewiesen war. Bislang war Ribukan abgesichert gewesen. Eine Invasion durch die Nagah wäre durch die Sanskitarischen Verbündeten abgewendet worden, eine Garantie, die nun entfiel. Sollte sich der Sanskitarische Städtebund zu einem Angriff auf Ribukan entschließen, bedurfte es der Unterstützung durch die Nagah, um die Attacke abzuwehren, und ebenso im Falle eines Aufstandes der Ipexco. Die Comtesse erhob daher die Forderung, dass die Nagah an der Regierung über die Stadt beteiligt werden mussten, um sich ihr Vertrauen und ihre Unterstützung zu sichern.
Hernandas Forderung wurde für Wochen ein heftig diskutiertes Politikum, das die Comtesse durch Diplomatie, großzügige Bestechungsgelder und dosierten Einsatz von Magie zu entschärfen wusste. Unabsichtlich kamen ihr Al’Hrastors Spione zu Hilfe. Als es den Magiern der Akademie gelang, zwei Zelothim bei dem Versuch dingfest zu machen, in der Zauberschule Feuer zu legen, kippte die Stimmung zugunsten Pizarras. Mit der Zusage des Volkes, die Regierung so gestalten zu dürfen, wie es ihr vorschwebte, rief die Comtesse die Magokratie zu Ribukan aus.
Diese wurde künftig von zwei Groß-Muftis gelenkt, einem Menschen und einem Nagah. Die Sorge der Ribukaner, dass die Herrschaft der Schlangenwesen die Menschen Ribukans ihre Identität und ihre Freiheit kosten würde, erwies sich als unbegründet. Die unterschiedlichen Spielarten der Magie von Menschen und Nagah ergänzten sich hervorragend und stellten für Spione der Amazäer und der Zelothim eine veritable Bedrohung dar. Es gelang den Ribukanern auf diese Weise, den größeren Teil der Agenten Al’Hrastors ausfindig zu machen, und die Verbleibenden konnten keinen großen Schaden anrichten.
Die Magokratie wurde so zum Garant für dauerhaften Frieden. Die Sanskitarenstädte nahmen mit der Zeit wieder Handelsbeziehungen zu dem abtrünnigen Stadtstaat auf. Selbst Yal-Mordai schloss sich zähneknirschend an, weil dem Sanskitarischen Städtebund ohne den Ribukan-Handel wichtige Ressourcen fehlten. Die Mitregentschaft der Nagah sicherte den Frieden mit den Schlangenleibigen. In der Stadt entstanden Tempel der Nagah-Götter, welche dem Volk die Heilkünste der Priester und andere Dienstleistungen zur Verfügung stellten. An der Akademie der Schatten kam die Heil- und Verwandlungsmagie dank der Zusammenarbeit mit den Nagah-Zauberkundigen zu ungeahnter Blüte. Das Wissen der Verbündeten über Medizin und Anatomie sowohl hominider als auch echsischer Wesenheiten machte einen gewaltigen Schritt nach vorn und sicherte der Akademie der Schatten hohes Ansehen bei der Bevölkerung Ribukans ebenso wie bei jener der Echsendschungel.
Als Herrschaftsinsignie der Groß-Muftis diente fortan der Karfunkel des Purpurwurms Ishtazar, welcher vor rund einem Jahrtausend die Ribukaner im Kampf gegen den Amazth-Diener Azuri ibn’Zahalan unterstützt hatte. Eine treffliche Symbolik für Ribukans Widerstand gegen die Umtriebe des Amazth-Dieners Al’Hrastor.
Yal-Mordais Verfall
Nach vielen Jahrzehnten des Krieges hatten die meisten Orks der Targachi ihre Freiheit wiedererlangt. Ogrin Sphärenaxt und Durthan waren gefallen und von anderen Kriegsherren beerbt worden, die allerdings nicht im Ansatz dieselbe Autorität aufzuweisen hatten wie die verstorbenen Anführer. Sphärenaxt hatte eine Mehrheit der Stämme unter seinem Banner gegen Al’Hrastor vereinen können, doch mit seinem Tod hielten Misstrauen und Zwietracht in den Reihen der Schwarz- und Braunpelze Einzug. Zahlreiche Differenzen entzweiten die Stämme. Man stritt über Kriegsziele, Strategien, vor allem aber um den Besitz der magischen Axt, die Ogrin getragen hatte. Der Hader verhinderte ein konzertiertes Vorgehen der Steppenorks gegen Al’Hrastors Truppen. Da auch Ronthars Streitmacht gebunden war und im Kampf gegen die anderen Schratenreiche benötigt wurde, konnten die Sanskitaren Teruldan verteidigen. Auf diese Weise entwickelte sich der Nordrand der Lath mehr und mehr zu einer festen Grenze zwischen Al’Hrastors Reich und den weiter nördlich gelegenen Gebieten.
Während all dieser Jahre verharrten die Stadt-Sanskitaren in einem permanenten Kriegszustand, der von zahllosen Kämpfen und Scharmützeln begleitet wurde, ohne dass Al’Hrastors hochtrabende Pläne auch nur einen Schritt vorangekommen wären. Mehr noch, man befand sich in einem Rückzugsgefecht, das so langsam vonstatten ging, als habe Satinav persönlich die Geschwindigkeit des Zeitenlaufes reduziert. Al’Hrastor, dem der Sarkophagus zwar Unsterblichkeit, aber keine ewige Jugend verlieh, schien mit jedem Jahr mehr zu verfallen. Seine Haut, zunächst schrumpelig und voller Altersflecken, dann braun und ledrig, trocknete vollständig aus und zog sich wie dünnes Pergament über das Skelett des Herrschers, das sich unter der verfallenen Hülle mehr und mehr abzuzeichnen begann. Hinzu kam, dass manchmal tage- oder gar wochenlang unfähig war, sein Volk zu regieren, weil die Rituale, die ihn am Leben hielten, mit jedem Mal mehr Zeit benötigten und er immer länger aus Gefecht gesetzt blieb.
Zusammen mit Al’Hrastor verfiel auch die Stadt Yal-Mordai, wenn auch aus anderen Gründen. Die Lehren der Zelothim, welche schlussendlich im besten Sinne ihrer niederhöllischen Gottheit die Vernichtung der Schöpfung bezweckten, verboten alles, was ordnend, schöpferisch oder kreativ wirkte, darunter auch den Neubau von Gebäuden oder ihre Reparatur. Der Orden der Zelothim übte Druck auf die Amazth-Priesterschaft und die Wesire aus, jegliche Bauvorhaben in der Stadt zu untersagen, einschließlich der Instandsetzung von Yal-Mordais Bausubstanz. Bedingt durch Al’Hrastors Schwäche hatten die Zelothim massiv an Macht und Einfluss gewonnen, sodass sich die Amazth-Priesterschaft und die Wesire zähneknirschend ihrem Befehl beugen mussten. Solange es die Zelothim gab, waren Bauvorhaben nie gern gesehen gewesen. Doch Al’Hrastor, der wenig Sinn für solche religiösen Erwägungen hatte und vielmehr von dem Interesse geleitet wurde, sein Reich am Laufen zu halten, hatte großzügig darüber hinweggesehen, wenn die Bürger heimlich an ihrem Besitz werkelten und ihn vor dem nagenden Zahn der Zeit bewahrten. Wäre es nach ihm gegangen, wäre Yal-Mordai schon vor langer Zeit zu Utopia ausgebaut worden. Unter der Knute der Zelothim indes wurden krakonische Strafen verhängt, wenn ein Gebäudeeigner dabei erwischt wurde, wie er dringend notwendige Wartungsarbeiten vornahm. Schließlich begann die Furcht der Yal-Mordaier vor der grausamen Bestrafung die vor dem Verlust ihres Zuhauses zu überwiegen. Die zur Tatenlosigkeit verdammten Menschen verfielen zunächst in Apathie, dann in Depressionen. Ihr Leben wurde zu einer Schlitterpartie aus befohlener Tatenlosigkeit, ständig drohender Gefahr für Leib und Leben durch die Zelothim, welche sich die Kontrolle über die Staatsgewalt anmaßten, lodernder Furcht und der Sinnlosigkeit der wenigen Dinge, die ihnen nicht verboten waren. Nach wenigen Jahren waren signifikante Teile der Bevölkerung Yal-Mordais dem Wahnsinn verfallen. Ein Teil von ihnen glaubte überall Verschwörungen der Eliten zu erkennen, die entschlossen seien, die Bevölkerung zu verderben, krank zu machen, umzuvolken oder auszulöschen. Ein weiterer Teil wähnte sich ständig beleidigt, benachteiligt und unterdrückt, überempfindlich wie ein Schneekristall im Lavameer.
Zweifellos hat der bedenkliche Geisteszustand der Einwohner Yal-Mordais auch mit der Präsenz der Sternensenke zu tun, einem Amazth-(Un-)Heiligtum, das zu Sach Ard’m gehört, der Akademie der Amazäer und Zelothim. Es handelt sich um eine siebzehn Schritt durchmessende, halbkugelförmige Senke im Boden, die Tag und Nacht den Sternenhimmel zeigt. Faustgroße Kristalle repräsentieren die wichtigsten Sterne. Sie sind an riesigen, hauchdünnen Metallringen befestigt, die – angetrieben von einer unbekannten Macht – langsam ineinander rotieren und so die Bewegung der Sterne imitieren. Die Kristalle durchlaufen den bevorstehenden Sternenlauf des jeweiligen Mondzyklus rückwärts, wobei im Falle besonderer Konstellationen ein metallisches Summen durch die Konstruktion geht. Auch die Wandelsterne werden durch Kristalle unterschiedlicher Farbe symbolisiert, jedoch sind diese von etwa der Größe eines Kinderkopfes.
Es muss erstaunen, wie präzise die auch Astrolabium genannte Anlage ihren Zweck erfüllt. Selbst die sternkundlichen Tafeln einer Niobara von Anchopal waren nie so genau. Erschreckenderweise bildet das Modell sogar den Sternenfall korrekt ab, ohne dass eine Nachkalibrierung erforderlich gewesen wäre. Nicht minder erschreckend ist die Tatsache, dass auch der heute unsichtbare Augenstern, welcher die Tulamiden einst ins Riesland geführt hat, unbeirrbar seine Bahn zieht und dabei als Auge Amazeroths dargestellt ist, welcher im Zentrum der Senke über die Schöpfung wacht.
Um die Senke herum machen Pilger ihre Aufwartung. Manche von ihnen werfen sich siebenundsiebzigfach vor dem Heiligtum nieder und bringen dann ihre Opfergaben dar. Die Akoluthen, in Ausbildung befindliche Priester Amazths, Priester, Amazäer oder Zelothim halten sich hier eher in den Abend- und Nachtstunden auf, wenn der Pilgerstrom sich verlaufen hat, und nutzen die nächtliche Stille, um in tiefe Meditation zu versinken und nach Erleuchtung zu suchen. Zuweilen stürzt sich ein Fanatiker in das Heiligtum – es heißt, man könne durch eine Öffnung in der Mitte des im Boden eingelassenen Sternenhimmels direkt in Amazth‘ Paradies gelangen – und findet dabei in aller Regel ein grausiges Ende durch die Metallringe. Die Sternengrube ist so konstruiert, dass sie durch solche Vorstöße stets unbefleckt bleibt, gern gesehen sind diese dennoch nicht. Der Tempel bietet geeignetere Orte, sich Amazth zu opfern, wenn man denn unbedingt möchte. Daher finden sich neben dem blassgrünen Nephriit, welcher das Heiligtum vor Vandalismus schützt, stets auch einige Vertreter der Kristallgarde, um allzu enthusiastische Gläubige am Freitod zu hindern.
Die Sternensenke ist nicht von Kunkomern, Remshen oder Sanskitaren geschaffen worden. Sie existiert bereits seit Marhynianischen Zeiten. So es denn stimmt, was die Senke selbst andeutet, dass nämlich der Augenstern, der die Kunkomer ins Riesland geführt hat, ein Werk des Amazth’ war, wirft dies die Vermutung auf, dass der Erzdämon die Aventurier unter anderem deshalb nach Rakshazar geführt hat, damit sie sein Unheiligtum wieder in Gang setzen. Schließlich haben die Riesländer die alten Marhynianischen Bauten meist abergläubisch, in diesem Fall allerdings vollkommen zu Recht gemieden. Der verderbte Einfluss der Sternensenke verbreitet sich über die ganze Stadt und darüber hinaus. Lediglich der Hafenbezirk liegt weit genug entfernt, und im Stadtkern schützen die Stelen-Labyrinthe einen streng abgesteckten Bereich.
Das Amazth-Unheiligtum von Sach Ard’m verbreitet schleichend Amazeroths unheilvolle Aura über die Stadt und verdirbt so die Geister und Seelen der Bevölkerung. Schon wenige hundert Meter abseits der Keshals und Stelen-Labyrinthe findet man fast nur noch verlorene Seelen. Auf Yal-Mordai liegt der sengende Blick eines blinden Gottes, und nur im Schutz der Keshals kann man den stetig einsickernden Einfluss der Sternengrube einigermaßen unbeschadet überstehen. Es heißt, dass die geometrischen Reliefs, Rilken, Fortsätze und Arabesken an den Mauern der Keshals ein Geflecht aus komplexen Bannsprüchen bilden, welches Sterbliche vor der gewaltigen Präsenz des Gottes schützen soll. Auch die Stelen bieten angeblich einen gewissen Schutz, wobei dieser zuweilen – man munkelt, dass bestimmte Sternenkonstellation dafür verantwortlich sind – versagt. Die Bevölkerung weiß inzwischen sehr genau, dass sie die unbewohnten Teile der Stadt meiden muss, und hält sich aus den Randbereichen fern. Fremdländer, die sich hierher verirren, verfallen oft binnen weniger Stunden dem Irrsinn.
Es darf als gesicherte Erkenntnis gelten, dass es zu imperialen Zeiten sehr viel mehr solcher Schutzeinrichtungen gab und sie auf dem gesamten früheren Stadtgebiet die schädliche Aura eingedämmt haben. Dummerweise haben die Sanskitaren keinerlei Vorstellung, was zur Errichtung eines Stelen-Labyrinths erforderlich ist, und die Zelothim hätten ohnehin keinerlei Interesse daran, die Macht ihres Gottes weiterhin zu beschränken. Ein Ausbau der Schutzanlagen scheint somit momentan schier unmöglich zu sein.
Der zunehmende geistige Verfall der Bevölkerung, die stetige Herrschaft von Angst und Wahnsinn über die Stadt führte zur Gründung des heute als altehrwürdig betrachteten Sanatoriums Arkhabal. Dieses liegt zwar in der Nähe des Hafens, anders als dieser allerdings innerhalb des von der Sternensenke verderbten Bereichs. Arkhabal ist in Wahrheit eine gewaltige Nervenklinik, in welche die schweren Fälle eingeliefert werden. Es ist nicht selten die Keimzelle für neue kriminelle Vereinigungen und wird zumeist von korrupten Ärzten mit eigenen, finsteren Ambitionen geleitet. Manche der Insassen sind durch das Wirken der ortsansässigen Zauberkundigen dämonisiert. Die meisten wirken auf den ersten Blick nur missgestaltig oder krank. Im Laufe der Zeit mutierte das Sanatorium zum heimlich Dreh- und Angelpunkt des verderbten Lebens in der Stadt.
Ab 850 BF traten in Yal-Mordai verschiedene Helden mit besonderen Kräften auf, um die Ordnung in der Stadt aufrechtzuerhalten. Die widersprüchlichen Anweisungen Al’Hrastors und der Wesire waren dazu nicht mehr in der Lage. Diesen Helden ist es zu verdanken, dass die Stadt heute nicht vollkommen verfallen ist, sondern den Schein, eine ganz normale Sanskitarensiedlung zu sein, immer noch aufrechterhalten kann.
Die Zelothim versuchten ihrerseits, Druck auf die anderen Städte des Sanskitarischen Städtebundes auszuüben. Die Amzth-Magier verlangten auch von ihnen, ihre Ansiedlungen im Sinne der Gottheit verrotten zu lassen. Dies führte zunehmend zu Spannungen zwischen Yal-Mordai und den übrigen Städten, die sich dem Diktat nicht beugen wollten. Dies umso mehr, als die Anführer der übrigen Städte die Anmaßung der Zelothim nicht erkannten. Die Zauberkundigen gaben vor, auf Befehl Al’Hrastors zu handeln, sodass die Verbündeten jegliche Forderungen aus Yal-Mordai dem Hexersultan persönlich anlasteten.
Weitere Geschichte Al’Hrastors
Al’Hrastor und seine Zelothim haben noch diverse Male die Historie des Kontinents mitgeprägt, aber die zugehörigen Lagerfeuererzählungen sollen an anderer Stelle niedergelegt werden. Die Rolle, die er gegen Ende des Zehnten Zeitalters in der Schlacht um Amhas gespielt hat, findet in der Spielhilfe über die Heimat der Angurianer ihren Platz, seine Verwicklung in die Unterwerfung Yal-Kharibets in der Beschreibung dieser Stadt.
Die Assashim und die Zelothim
Avesander von Humboldt-Garlischgrötz und die Diebe der 1000 Jahre
Die fiebernde Hitze stieg SaOor langsam zu Kopf. Das dampfende Grün war ihm ebenso abhold wie das wirre Schnattern und Kreischen der Kreaturen.
»Verdammt sei die alte Schlange, dass sie uns warten lässt!«
Der Hüter schien seinen Unmut zu teilen, und doch hielt er die Passage offen. In der Ferne setzte nun frenetisches Trommeln ein. SaOor blickte auf den Steinhaufen inmitten der Lichtung und schwang geistesabwesend seine Sturmsichel. Sollten sie tatsächlich entdeckt worden sein?
Wie genau er dem Blutbad entkommen war, wusste Avesander nicht zu sagen. Über diesem Teil seiner Erinnerung lag noch immer ein roter Schleier. Er erinnerte sich zwar an die Wilden und wie sie ihm freundlich zugewinkt hatten, doch welches Tabu er dann genau gebrochen hatte, war ihm immer noch schleierhaft. Die Freude der Eingeborenen war bereits in dem Moment umgeschlagen, als sie sich ihnen angenähert hatten. Mit grimmigen Mienen zeigten sie auf den Metallschild des Kriegers und auf einige andere Gegenstände. Harsche Töne gingen durch ihre Reihen. Ein halbes Stundenglas später war es dann zum Gemetzel gekommen. Auf den ersten Blick schienen die Wilden unterlegen zu sein, doch ihrer Brutalität und der schieren Anzahl ihrer Krieger waren sie letzten Endes nicht gewachsen gewesen. Nun war er auf der Flucht. Kurze Signalschreie machten ihm bewusst, dass ihn seine Häscher in die Zange genommen hatten. Schwitzend stürzte er auf eine Lichtung und erstarrte. Eine halbnackte Gestalt richtete eine Waffe auf ihn. Nein! Aber was? Die Gestalt hatte keine metallisch-dunkle Haut wie seine Verfolger. Sie war von fahler Blässe.
»Wir sollten bis nach dem Nachmittagsregen eine Passage halten. Das haben wir getan. Sie hat sie nicht genutzt. Wir schulden ihr also nichts mehr.«
Der Hüter stimmte ihm zu. SaOor wusste, dass die Nagah mehr für den Hüter war als eine einfache Vertragspartnerin. Er liebte sie. Trotzdem widersprach er ihm nicht. SaOor horchte auf.
»Ein Zweibeiner.«
»Ipexco?«, fragte der Hüter.
»Nein. Metall auf Metall.«
Ein fetter Menschling stolperte auf die Lichtung.
„Rettung“, ging es ihm durch den Kopf. Trotz dem Gefühl, jeden Augenblick von hinten erschlagen zu werden, versuchte Avesander sich zu fassen. Die Angst ließ den Drang sich zu erleichtern stärker werden als der Ausdruck „Schiss haben“ es jemals hätte wiedergeben können. „Keinen Fehler machen, bloß keinen Fehler machen“, wiederholte er wieder und wieder im Geiste. „Langsam und höflich“, sagte er sich.
»Den Zwölfen zum Gruße!« – im besten Mittelreichisch – nichts! »Masa’l-chair« – Tulamidya – nichts! Bosparano, Aurelian, … Mohisch! – nichts! Die Gestalt wandte sich zum Gehen, da nahm er ihre spitzen Ohren wahr. Im fehlten kurz die Worte … »Taladhah«, brach es dann aus ihm hervor. Zu spät! Seine Häscher hatten ihn schon gefunden.
Der fette Menschling plapperte vor sich hin. Bald würde sein Blut das Grün tränken. SaOor wollte sich schon zum Gehen wenden, da sprach der Menschling plötzlich in der Zunge der Ahnherren. Verstört blickt er zum Hüter, der nickte ihm mit weit aufgerissenen Augen zu. Im selben Moment brachen die Ipexcokrieger aus dem Unterholz.
Wie eine Bogensehne schnellte der aschfahle Krieger nach vorne. Noch im Sprung enthauptete er einen der Eingeborenen. Wie ein Rachedämon wirbelte er herum und stieß dem nächsten Stammeskrieger die stumpfe Seite seiner Waffe ins Gesicht. Mit einem Überschlag stand er plötzlich neben Avesander und zog ihn mit einem Ruck zum Steinhaufen. Vier weitere Krieger stießen auf die Lichtung. Sie hoben ihre Keulen zum Angriff, doch ein Schrei ließ sie innehalten. Ein Krieger mit einem Federumhang trat aus dem Dschungel und zeigte auf den Steinhaufen. Die Krieger zögerten einen Moment, dann, stumm, immer noch mit erhobenen Waffen, schritten sie rückwärts, bis sie mit den Schatten des Urwalds verschmolzen. Immer noch verdutzt, bemerkte Avesander den anderen „Elfen“, der den Steinhaufen lediglich kraft seines Willens umzuschichten schien. Leichte Übelkeit kam in ihm auf, und doch versuchte er seine Haltung zu wahren. Vergebens. »Mein Name ist Avesander«, sagte er noch, doch da überkam ihn auch schon eine gnädige Ohnmacht.
Die Diebesgilde von Yal-Kalabeth basiert auf den Lehren der Assashim, hat sich auf Artefakt-Diebstahl spezialisiert und dient Prinzessin Nagisha oder anderen Würdenträgern zuweilen als Geheimdienst, allerdings traut ihnen niemand vorbehaltlos über den Weg. Wenn die Diebe der 1000 Jahre nicht gerade auf eigene Rechnung arbeiten, stellen sie gefährliche magische Artefakte sicher oder schalten Feinde von Yal-Kalabeth aus. Überflüssige Morde versucht die Organisation bei der Durchführung ihrer Einsätze zu vermeiden – zu viele Tote zu hinterlassen gilt als ungeschickt. Außerdem widerspricht das Ermorden von Unschuldigen dem komplexen Ehrenkodex des Bundes. Diebe der 1000 Jahre stammen oft aus der Unterschicht von Yal-Kalabeth und sind meist freigelassene Sklaven oder ehemalige Straßenkinder. Seit neuestem duldet die Organisation einige Trogglinge in ihren Reihen. Diese sind besonders effektiv, da sie sich selbst bei absoluter Dunkelheit perfekt orientieren können. Diese Trogglinge sind zudem die einzigen „bekannten“ Nichtmenschen, welche die Profession des Assashim ergriffen haben.
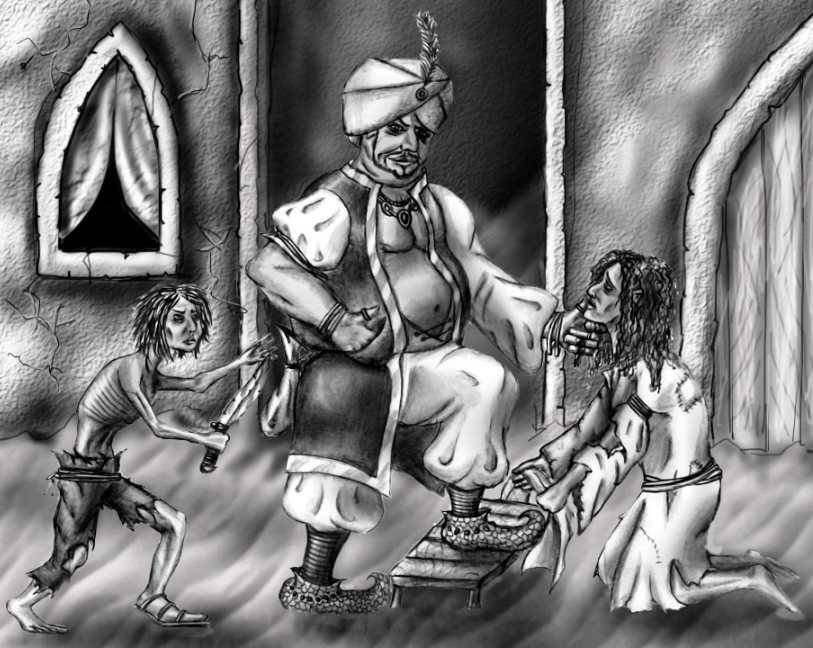
Herausragende Persönlichkeit unter den Dieben der 1000 Jahre ist Avesander von Humboldt-Garlischgrötz, ein gepflegt aussehender, jedoch ziemlich beleibter Mann im mittleren Alter mit langen, blonden Haaren und einem Spitzbart. Er trägt bevorzugt edle sanskitarische Roben aus feinster kithorriansicher Seide und eine Vielzahl an Goldgeschmeide und Edelsteinen. Avesander ist ein aventurischer Adliger, der vor etlichen Jahren eine Expedition ins Riesland anführte und schließlich zusammen mit seinem Begleiter Iapetus in Yal-Kalabeth strandete. Nach außen hin spielt er den tollpatschigen, naiven Genussmenschen, doch in Wahrheit steckt hinter ihm viel mehr. Es scheint, als könne er bei einem Schwert den Griff nicht von der Klinge unterscheiden, tatsächlich ist er allerdings ein recht passabler Fechter und tödlich präzise im Umgang mit Wurfmessern. Avesander hat erhebliche Reichtümer angesammelt, sendet regelmäßig Expeditionen aus, um unzivilisierte Regionen des Rieslands zu erforschen oder verborgene Schätze zu bergen und hat sich zum Anführer der „Diebe der 1000 Jahre“ von Yal-Kalabeth aufgeschwungen, deren Spionageaktionen er leitet und koordiniert. Von Garlischgrötz spielt seine Rolle perfekt. Wenige halten ihn für etwas anderes als den ängstlichen, korpulenten Faulpelz, für den er sich ausgibt. Trotz seiner vermeintlichen Defizite wirkt er sympathisch und auf eine ganz eigene Art charmant, was daran liegt, dass zuweilen sein wahres Wesen hinter der Fassade durchschimmert. Dieses ist geprägt von einem messerscharfen Verstand und einer schier unschlagbaren Beobachtungsgabe. Avesanders Hauptaugenmerk gilt gegenwärtig dem Versuch, Al’Hrastors Agentennetzwerk in Yal-Kalabeth lahmzulegen und seinerseits eines im verfeindeten Yal-Mordai aufzubauen. Er ist deshalb auf der Suche nach geeigneten Mitarbeitern, die er wahlweise als Agenten für die Diebe der 1000 Jahre anwirbt oder so manipuliert, dass sie ohne ihr Wissen seinen Zwecken dienen.
Die Assashim – Dolche des Schreckens
Der fette Beamte rannte ebenso panisch wie schwerfällig durch die engen, nächtlichen Gassen des Altstadtviertels. Sein Herz raste, als ob es kurz vor dem Zerspringen stünde. Er schnaufte laut hörbar und hatte das Gefühl, kaum noch Luft zu bekommen. Doch er musste weiter! Seine kleine Verschwörung mit den Schmugglern war anscheinend aufgeflogen. Als er heute Abend zum verabredeten Versteck gekommen war, lagen seine „Geschäftsfreunde“ bereits mit durchgeschnittenen Kehlen an dem groben runden Holztisch, an welchem er so manches Bestechungsgeld oder Drogengeschenk entgegengenommen hatte. „Eine rivalisierende Schmugglerbande!“ war es ihm durch den Kopf geschossen. Er musste weg! Hinter sich vermeinte er immer wieder einen schemenhaften Schatten im Zickzack über die Gasse springen zu sehen. Ein Geräusch war dabei nicht zu hören. Da, endlich! Er hatte eine rettende Pforte erreicht. Er versuchte, sie aufzustoßen. Ein Glück – Sie war offen. Er schlüpfte hindurch, schlug die schwere Holztür zu und verriegelte sie. Völlig außer Atem sank er an der hölzerne Platte hinab und versuchte, wieder zu Atem zu kommen. Er war gerettet! Langsam blickte er sich in dem dunklen Raum um. Eine Art Lagerraum wahrscheinlich, dachte er bei sich. Die Gasse, aus der er gekommen war, wurde durch einige Laternen spärlich beleuchtet. In ihrem Schein konnte er einige Schemen erkennen, die ihn an Amphoren erinnerten. In seinem unmittelbaren Umfeld indes war es fast pechschwarz. Durch die kleinen, mit Holzstangen vergitterten Fenster drang nur schwaches Sternenlicht. Die Augen des Beamten konnten in der Finsternis nicht allzu viel erkennen. So bemerkte er auch nicht den geschmeidigen Schatten, der sich langsam von den schweren Deckenbalken zu ihm herunter schwang. Scheinbar aus dem Nichts vernahm er plötzlich eine Frauenstimme, deren flüsternder Klang ihn an übereinander gleitende Seide erinnerte: „Nurad AlMuca!“ Der Name seines Bruders? Aber … Weiter konnte er nicht mehr denken. Das Letzte, was er spürte, war ein stechender Schmerz am Hals. Dann wurde es kalt.
Hintergrund
Seit Jahrhunderten spielen Meuchelmord, Diebstahl und Attentate eine wichtige Rolle im politischen Tagesgeschäft der Sanskitaren. Oftmals gilt: Es gewinnt derjenige, der über die besten gedungenen Killer verfügt. Auftragsmord oder Diebstahl können somit einträgliche Geschäfte sein, jedenfalls für jene, die sich auf ihr Handwerk verstehen. Tief in den Katakomben unter den Gassen der Stadt, in Hinterhöfen und geheimen Kammern oder in uralten Festungsruinen weit draußen in der Wüste haben sich besondere Gruppen riesländischer Magieanwender zusammengefunden. Man nennt diese Schatten, die die Nacht durchflattern, gemeinhin die „Assashim“. Der Name leitet sich vom Geschlecht der Assashamiden aus Teruldan ab, einer düsteren Sippschaft, die der Legende nach die besonderen, verfeinerten Techniken des Meuchelmordes entdeckt und entwickelt hat.
Für den normalen Sanskitaren auf der Straße sind die Assashim nichts als eine weitere Schauergeschichte. Manche Assashim nutzen zwar ein gewisses Maß an Magie für die Ausübung ihrer Profession, würden sich aber allein auf dem Gebiet der Zauberei mit richtigen Hexern nicht messen können. Über ihre schwachen magischen Talente hinaus beherrschen viele Assashim eine Vielzahl geheimer Kampftechniken für Dolche, Schlingen oder den unbewaffneten Kampf. Besonders gefährlich werden Assashim dadurch, dass sie oft und gerne Gifte zum Einsatz bringen. Obwohl ihr Name für alle magischen Schattenkrieger der Sanskitaren verwendet wird, gibt es viele verschiedene Gruppen, deren Ziele und Methoden sich teilweise stark voneinander unterscheiden.
Apropos Schattenkrieger: Es darf als offensichtlich gelten, dass die Assashim zumindest auch auf jenen Schattenkriegern und Sternschatten fußen, die in den Zeiten der Urtulamiden nach Rakshazar übergesiedelt sind und, von den Machthabern in den Untergrund gezwungen, bis in die Gegenwart hinein in Form verschiedener Geheimgesellschaften alle Wirren der Geschichte überstanden haben.
Die Assashamiden
Diese Familie von Meuchelmördern existiert noch immer und bildet ihre Adepten irgendwo in der Nähe von Teruldan aus. Die Assashamiden dienen grundsätzlich jedem, der sie bezahlen kann, und gehen bei ihren Operationen diskret und effektiv vor. Es hat Tradition, dass Assashim dieser Organisation ihrem Opfer kurz vor dessen sicherem Tode den Namen ihres Auftraggebers ins Ohr flüstern. Einige Assashamiden lassen mit sich handeln, und es ist schon vorgekommen, dass einzelne Assashamiden ihre Auftraggeber erdolchten, weil das Opfer ihre Zahlung überbieten konnte.
Die Tugendhaften Wächter der Ordnung
Die Geheimpolizei des Sultans von Shahana. Die Tugendhaften Wächter haben jede Schicht der Bevölkerung Shahanas infiltriert. Ihre Augen und Ohren sind überall. Nach außen hin leben die meisten von ihnen als respektable und unauffällige Bürger, die gesichtslos in der Masse verschwinden können. Anders als andere Assashim-Organisationen sind die Tugendhaften Wächter nicht in jedem Falle auf Mord oder Diebstahl aus, sondern häufig lediglich auf Informationsgewinnung. Deshalb haben sie einige wirklich raffinierte Folter- und Befragungsmethoden entwickelt.
Die Rong-Würger
Fanatische Kultisten der Göttin Omshivan. Zu Ehren ihrer Göttin sind in bestimmten Abständen Menschenopfer vonnöten. Die Assashim des Kultes entführen dazu geeignete Probanden und töten sie rituell in ihrem Tempel. Personen, die dem Kult im Wege stehen, werden sofort eliminiert. Rong nehmen Abstand von dem normalerweise unter den Assashim verbreiteten Krummdolch und erwürgen ihre Opfer lieber mit Seidenschlingen. Dies hat vor allem religiöse Gründe – vor dem Angesicht Omshivans darf niemals Blut vergossen werden. Die Rong haben ihre Finger in etlichen kriminellen Organisationen wie Diebesgilden oder Rauschkrauthändlerringen.
Der militante Arm der Zelothim
Die Zelothim haben einen speziellen Kader, der sich insgeheim um die Feinde des Kultes kümmert. Diejenigen, die zu wenig magisches Talent aufweisen, um mit Glyphen richtig umgehen zu können, werden den Assashim des Kultes zugeteilt. Assashim sind unter den Zelothim des Hexersultans von Yal-Mordai, Al’Hrastor, so gut wie nichts wert. Da sie ebenfalls das magische Siegel tragen müssen, ist es für Al‘Hrastor ein Leichtes, sie nach Gebrauch zu „entsorgen“. So gut wie kein Assashim der Zelothim überlebt seinen ersten Auftrag.
Magieanwendung
Die Magie der Assashim basiert auf denselben Prinzipien wie das Chutram der Amhasim. Sie hat sich sogar aus denselben Wurzeln entwickelt. Ebenso wie die Herren von Amhas glauben die „Dolche des Schreckens“, dass sie eine innere Energie kanalisieren, um ihre Fähigkeiten auszuüben. Obwohl die wenigen schattenhaften Legenden anderes behaupten, sind bei weitem nicht alle Assashim magisch begabt, sondern nur einige wenige. Diese aber sind es, die sich für den besonderen Ruf, den die Assashim insgesamt genießen, verantwortlich zeigen.
Obgleich sie erstaunliche Effekte bewirken können, ist der Umfang ihrer Magie recht eingeschränkt. Anders als die Chutram-Meister fehlt dem Assashim die geistige Komponente ihrer Magie. Die Assashim-Techniken sind bis auf wenige Ausnahmen vollkommen körperbezogen. Körperbeherrschung wird magisch verstärkt, was die Meuchler in die Lage versetzt, absolut lautlos zu schleichen, perfekte Balance auf jedem noch so kleinen Balken zu halten oder wie eine Eidechse an glatten Oberflächen emporzuklettern. Ebenfalls wird zuweilen von einer stark gesteigerten Beobachtungsgabe berichtet. Fast alle magisch begabten Assashim sind wahre Weitsprungwunder und entwickeln eine irrwitzige Geschwindigkeit. Einige wenige Legenden sprechen von magischen Tarntechniken. Assashim, die diese Techniken beherrschen, werden im Schatten unsichtbar, und wenn sie eine Kapuze tragen, ist darunter anstatt ihres Gesichts nur ein schwarzes Nichts zu erkennen. Wahre Meister-Assashim können ihre Gestalt in begrenzten Umfang verändern, ähnlich wie aventurische Hexen mit Hilfe der „Harmlosen Gestalt“.
Der Organisationsgrad der Assashim unterscheidet sich von Geheimbund zu Geheimbund, aber immer spielen persönliche Lehrer-Schüler-Beziehungen eine große Rolle. Will ein junger Assashim über seine mundanen Grundfähigkeiten hinauswachsen, welche er auf der niedrigsten Stufe der Organisation erlernt hat (in der Regel die einfachsten Kniffe des Gossenkampfes), dann sucht er sich einen persönlichen Meister, der ihn weiter unterrichtet. Einige der erfolgreicheren Meister bilden innerhalb ihrer Organisation zuweilen sogenannte „Schulen“, in denen sie ihre jeweils bevorzugten Kampftechniken vermitteln. Besonders bekannt für Schulenbildung sind die Diebe der 1000 Jahre und die Assashamiden.
Die Rituale der Assashim
Alle Rituale der Assashim sind für den Einsatz unter extremen Situationen entwickelt worden. Sie sind deshalb mit verhältnismäßig kurzer Ritualdauer auszuüben und benötigen keinerlei Gesten oder Worte.



Schreibe einen Kommentar